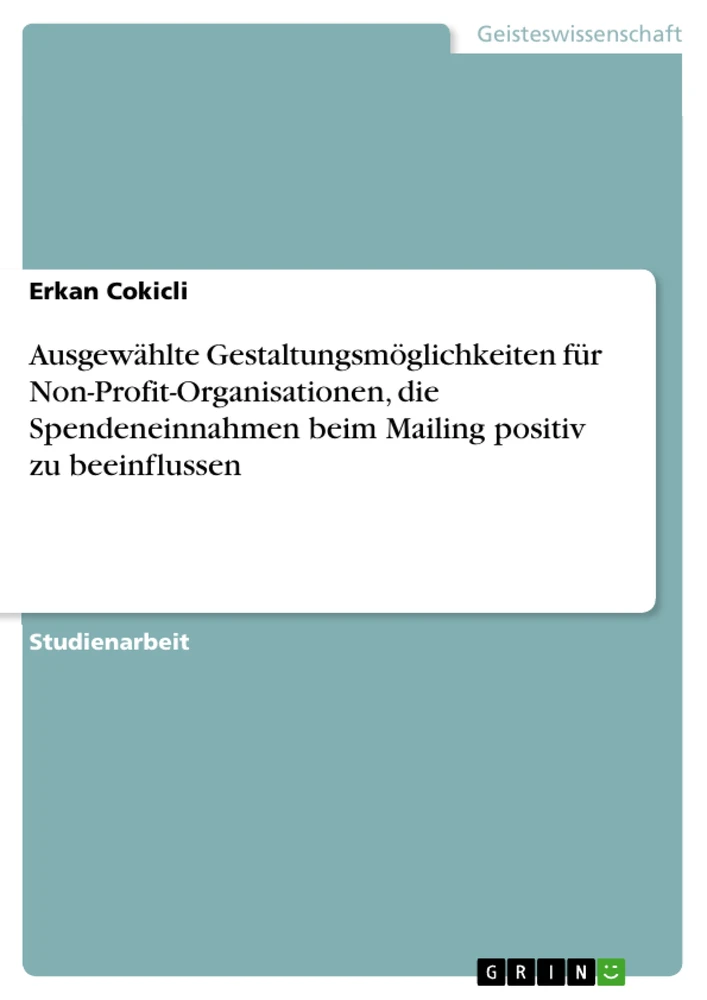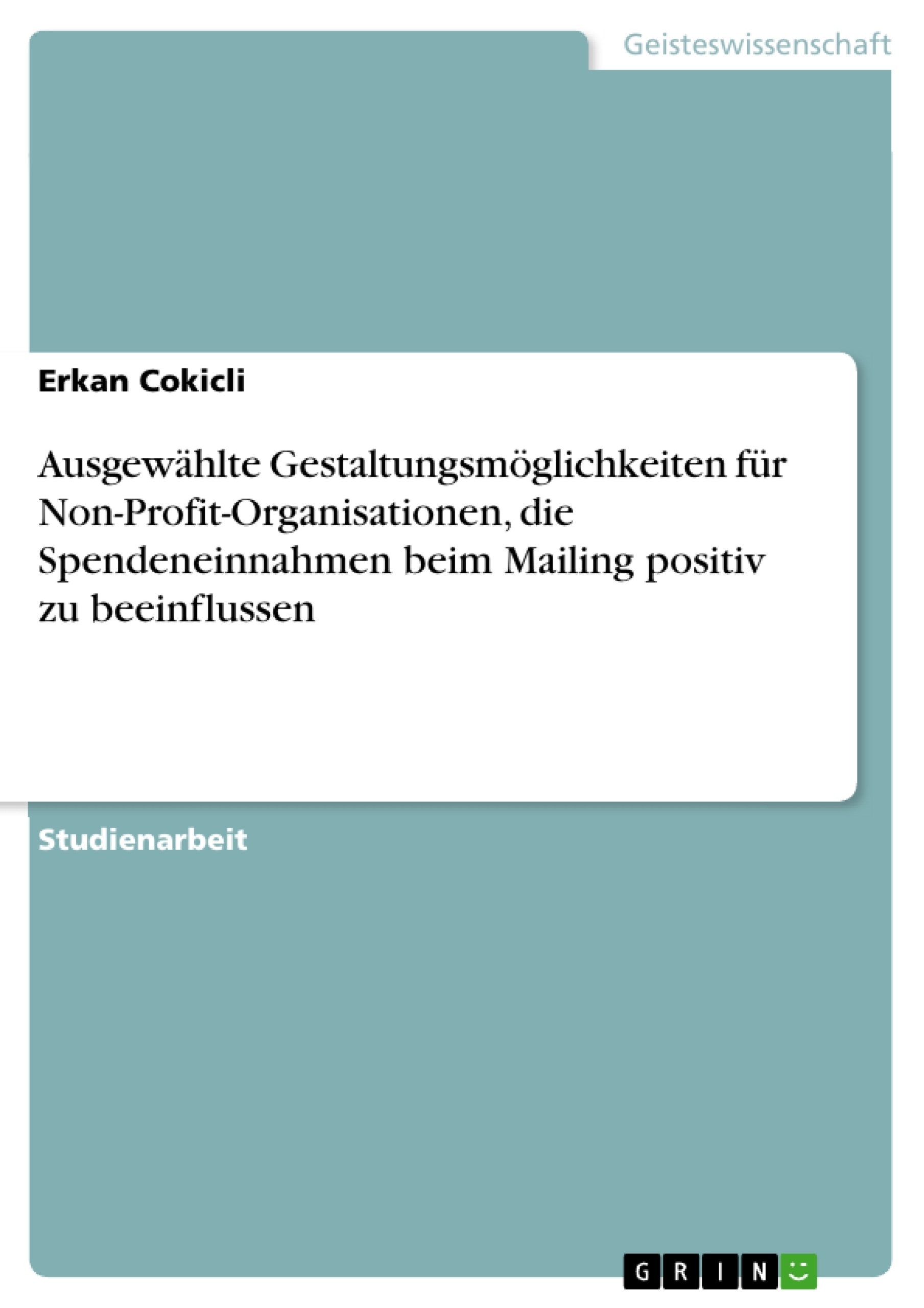Die Semesterarbeit geht auf ausgewählte Gestaltungsmöglichkeiten für Non-Profit-Organisationen ein und zeigt mithilfe der jeweils dazu passenden Theorie auf, wie die Spendeneinnahmen positiv beeinflusst werden können. Die Literaturarbeit geht auf Theorien der unterschiedlichen Disziplinen der Psychologie ein und weist am Ende der Arbeit auf Empfehlungen für die Praxis hin.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Zweck der Arbeit und Themenabgrenzung
- Theoretische Grundlagen
- Non-Profit-Organisationen
- Entstehung von Non-Profit-Organisationen
- Typologien von Non-Profit-Organisationen
- Finanzierung von Non-Profit-Organisationen
- Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Urteilen
- Wahrnehmung
- Aufmerksamkeit
- Urteilen
- Verhalten
- Praxisempfehlungen
- Briefumschlag
- Brief
- Einzahlungsschein
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit ausgewählten Gestaltungsmöglichkeiten für Non-Profit-Organisationen, die zum Ziel haben, Spendeneinnahmen durch Mailings zu erhöhen. Die Arbeit untersucht psychologische Theorien der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und des Urteils, um Empfehlungen für die Praxis zu entwickeln.
- Die Bedeutung von Spendeneinnahmen für Non-Profit-Organisationen
- Die Gestaltung von Mailings zur Steigerung der Spendenbereitschaft
- Der Einfluss von Briefumschlag, Brief und Einzahlungsschein auf die Wahrnehmung und das Urteilen potenzieller Spender
- Die Anwendung psychologischer Prinzipien zur Beeinflussung des Spendenverhaltens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik der Non-Profit-Organisationen ein, beleuchtet die Bedeutung von Spendeneinnahmen und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Das Kapitel „Theoretische Grundlagen“ bietet einen Überblick über die Entstehung, Typologien und Finanzierung von Non-Profit-Organisationen. Es behandelt zudem die psychologischen Prozesse der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und des Urteils im Kontext des Spendenverhaltens. Das Kapitel „Praxisempfehlungen“ präsentiert konkrete Gestaltungsmöglichkeiten für Briefumschlag, Brief und Einzahlungsschein, die auf den Erkenntnissen aus der Theorie basieren und darauf abzielen, die Spendenbereitschaft der Empfänger zu erhöhen.
Schlüsselwörter
Non-Profit-Organisationen, Spendeneinnahmen, Mailing, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Urteilen, Verhalten, Gestaltungsmöglichkeiten, Praxisempfehlungen, Psychologie, Spendenbereitschaft, Schweiz.
Häufig gestellte Fragen
Wie können NPOs ihre Spendeneinnahmen durch Mailings steigern?
Durch die gezielte Gestaltung von Briefumschlag, Spendenbrief und Einzahlungsschein unter Berücksichtigung psychologischer Erkenntnisse zur Wahrnehmung und Aufmerksamkeit.
Welche Rolle spielt die Psychologie beim Spenden?
Theorien zur Wahrnehmung und zum Urteilen erklären, wie potenzielle Spender Informationen verarbeiten und welche Reize sie dazu bewegen, eine Organisation als vertrauenswürdig einzustufen.
Warum ist der Briefumschlag beim Mailing so wichtig?
Der Umschlag ist der erste Kontaktpunkt; er entscheidet darüber, ob das Mailing überhaupt geöffnet wird oder ungeöffnet im Abfall landet.
Was sind typische Praxisempfehlungen für Spendenbriefe?
Empfohlen werden eine persönliche Ansprache, eine klare Struktur, die Nutzung emotionaler Bilder und ein einfach auszufüllender Einzahlungsschein.
Welche Typologien von NPOs gibt es?
Die Arbeit unterscheidet NPOs nach ihrer Entstehung, Finanzierung und ihrem Zweck, um maßgeschneiderte Kommunikationsstrategien zu entwickeln.
- Arbeit zitieren
- Erkan Cokicli (Autor:in), 2018, Ausgewählte Gestaltungsmöglichkeiten für Non-Profit-Organisationen, die Spendeneinnahmen beim Mailing positiv zu beeinflussen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442211