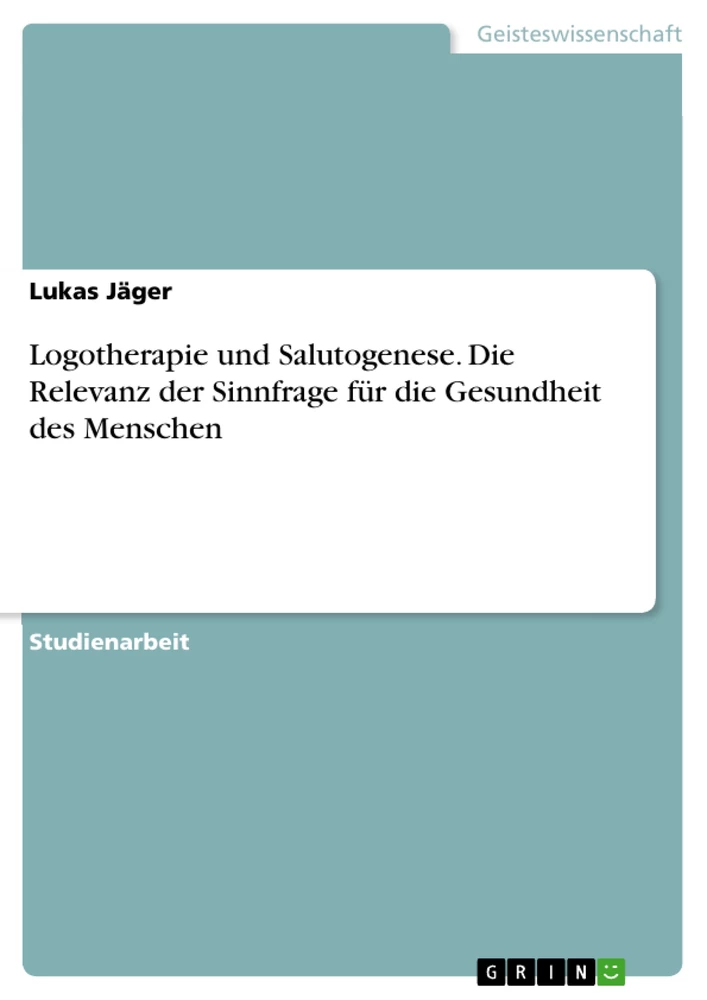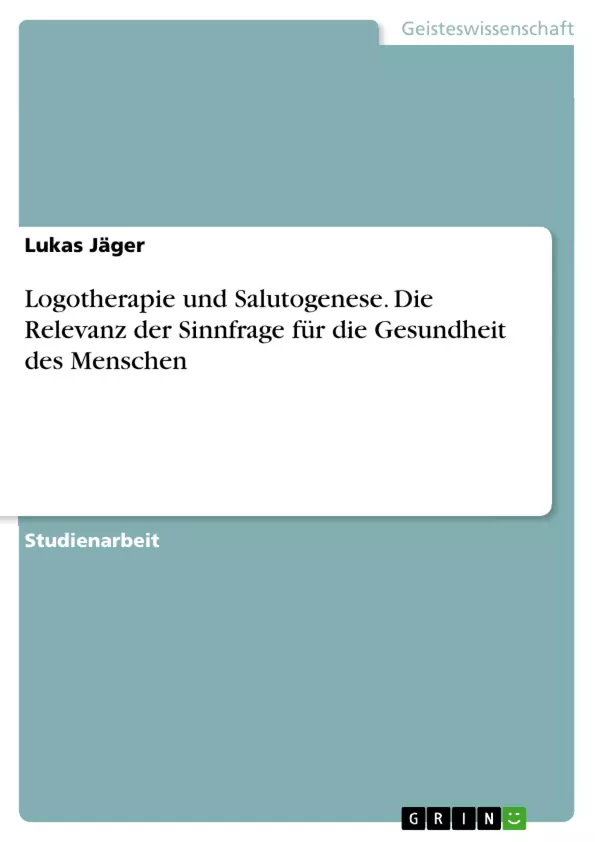Viktor Frankl (1905-1997), der Begründer der Logotherapie, erlebte von 1941 bis 1945 das Konzentrationslager. Seine Eindrücke schrieb er 1945 in dem Buch "...trotzdem Ja zum Leben sagen" nieder und legte damit ein Zeugnis ab, zu welcher unglaublichen Leistung der Mensch fähig ist. Trotz der unwürdigsten und grausamsten Bedingungen kann er überleben.
Dieses Buch hat mich erschüttert, denn es lässt meiner Meinung nach erkennen, welche ungeheure Macht der Mensch im Handeln besitzt. Dies meine ich im doppelten Sinne: zum einen von Seiten des barbarischen NS-Regimes, zu welchem Leid und Unrecht der Mensch fähig ist; und zum anderen die Sicht Viktor Frankls der beschreibt, wie man "trotzdem Ja zum Leben sagen kann", als ein unbedingter Glaube an den Sinn des menschlichen Daseins, des Lebens und der Gemeinschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Viktor Frankl und die Logotherapie
- ...trotzdem Ja zum Leben sagen...
- Der logotherapeutische Ansatz...
- Die existenzielle Fragestellung..
- Salutogenese
- Die Entwicklung der Salutogenese..
- Das salutogenetische Modell
- Sense of coherence (Kohärenzgefühl) ..
- Zusammenführung beider Konzepte in Anbetracht der Sinnfrage.......
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Relevanz der Sinnfrage für die Gesundheit des Menschen. Dabei werden die Überlegungen der Logotherapie von Viktor Frankl mit dem Modell der Salutogenese von Aaron Antonovsky verbunden. Ziel ist es, die Bedeutung der Sinnfindung für die Bewältigung schwieriger Lebenssituationen und die Erhaltung der eigenen Gesundheit zu beleuchten.
- Die Rolle des Sinnes für die Lebensbewältigung und Gesundheit
- Die Logotherapie von Viktor Frankl und ihre Kernaussagen
- Das salutogenetische Modell von Aaron Antonovsky und dessen Bedeutung für das Kohärenzgefühl
- Zusammenführung beider Konzepte und ihre Relevanz für die Sinnfrage
- Persönliche und kritische Gedanken zur Sinnfrage
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 der Hausarbeit gibt einen Einblick in das Buch „...trotzdem Ja zum Leben sagen“ von Viktor Frankl. Es werden wichtige Kernpunkte der Logotherapie und deren Verfahren, der Existenzanalyse, hervorgehoben. Kapitel 3 erläutert das salutogenetische Modell von Antonovsky und fokussiert auf das Konzept des Sense of coherence (Kohärenzgefühl). In Kapitel 4 werden logotherapeutische Überlegungen mit den Konzepten des salutogenetischen Modells verknüpft, um die Relevanz der Sinnfrage für die Gesundheit des Menschen zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Logotherapie, Salutogenese, Sinnfrage, Gesundheit, Existenzanalyse, Kohärenzgefühl, Lebenssinn, Viktor Frankl, Aaron Antonovsky
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage der Logotherapie nach Viktor Frankl?
Die Logotherapie besagt, dass das Streben nach Sinn die primäre Motivationskraft des Menschen ist. Selbst unter grausamsten Bedingungen kann der Mensch überleben, wenn er einen Sinn in seinem Dasein sieht.
Was bedeutet "Salutogenese" laut Aaron Antonovsky?
Salutogenese ist die Lehre von der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit. Im Zentrum steht die Frage, warum Menschen trotz großer Belastungen gesund bleiben.
Was ist das "Kohärenzgefühl" (Sense of Coherence)?
Es beschreibt eine grundlegende Lebenseinstellung, die Welt als verstehbar, bewältigbar und bedeutsam (sinnhaft) wahrzunehmen.
Wie hängen Logotherapie und Salutogenese zusammen?
Beide Konzepte betonen die Sinnfrage als zentralen Faktor für die psychische und physische Widerstandsfähigkeit (Resilienz) des Menschen.
Welche Rolle spielen Frankls Erfahrungen im Konzentrationslager?
Seine Erlebnisse bildeten die Grundlage für sein Werk "...trotzdem Ja zum Leben sagen" und belegten empirisch seine Theorie über die Macht der Sinnfindung in Extremsituationen.
Was versteht man unter "Existenzanalyse"?
Die Existenzanalyse ist das anthropologische Forschungsthema der Logotherapie, das sich mit der geistigen Person und ihrer Suche nach einem sinnerfüllten Leben befasst.
- Quote paper
- Lukas Jäger (Author), 2013, Logotherapie und Salutogenese. Die Relevanz der Sinnfrage für die Gesundheit des Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442344