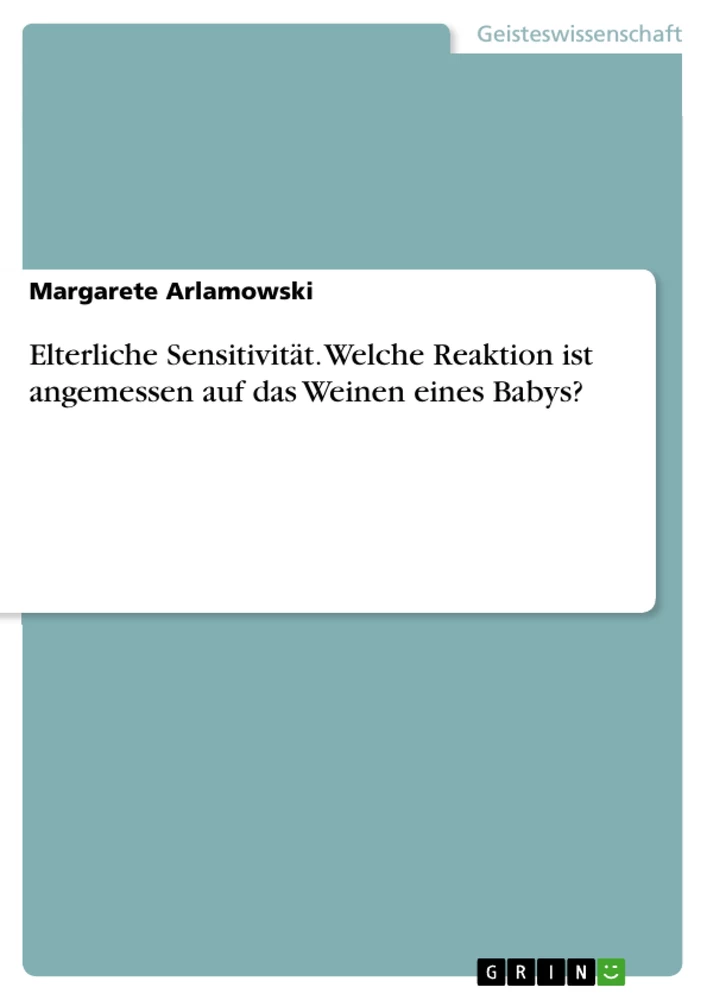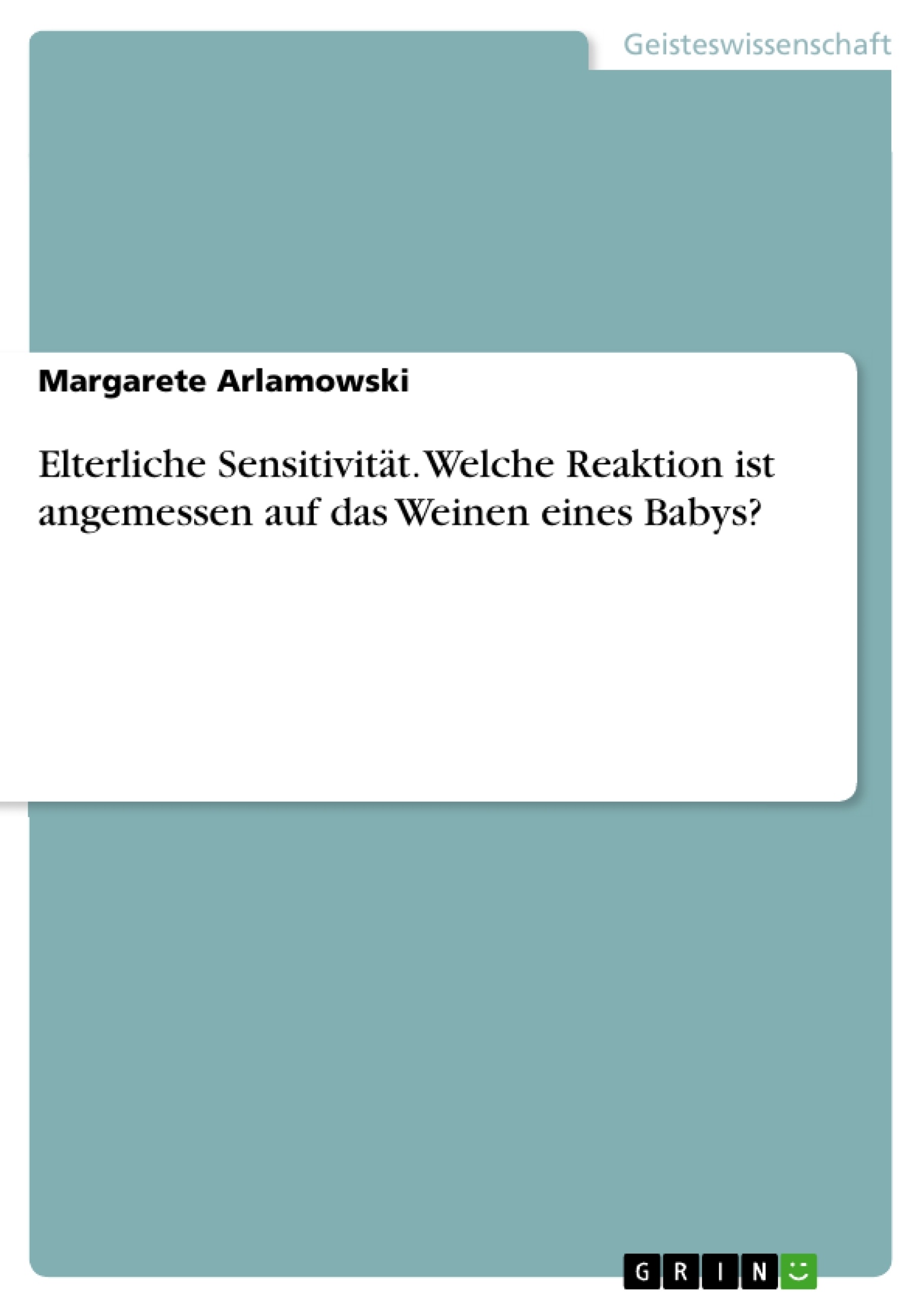Frischgebackene Eltern fragen sich nach den ersten Tagen und Wochen mit ihrem Baby: Wie sollten wir auf das Weinen unseres Kindes angemessen reagieren? Sie erhalten erbetenen und oft auch unerbetenen Rat von Verwandten, Freunden, Elternratgebern und sogar von „Was bedeutet das Weinen meines Babys“-Applikationen für das Handy. Im ersten Teil dieser Hausarbeit werden zwei verschiedene Antworten darauf vorgestellt und kritisiert. Im zweiten Teil wird und die elterliche Sensitivität mit der Theorie of Mind als Voraussetzung verknüpft sowie die Förderung der Sensitivität als Grundlage für angemessenes Verhalten auf das Weinen diskutiert. Die Erkenntnisse aus beiden Teilen fließen in ein abschließendes Fazit zu der Fragestellung ein.
„Schreien stärkt die Lungen“. Noch in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde dieser Ratschlag sowohl von Psychologen als auch von staatlich herausgegebenen Elternratgebern vertreten – und bis heute finden Eltern den Rat, dass sie auf das Weinen ihres Kindes am besten nicht reagieren sollten. Dieser Standpunkt hat seinen Ursprung in der lerntheoretischen Tradition der Behavioristen, nach welcher jedes menschliche Verhalten gelernt ist und somit auch verlernt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Die Antwort der Behavioristen
- 3. Die Antwort der Bindungstheoretiker
- 4. Kritik und erste Lösungsansätze
- 5. Förderung von elterlicher Sensitivität
- 6. Fazit
- 7. Anmerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die angemessene Reaktion auf das Weinen von Babys. Sie vergleicht gegensätzliche Ansätze aus behavioristischer und bindungstheoretischer Perspektive und analysiert deren Kritikpunkte. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung elterlicher Sensitivität und deren Förderung.
- Angemessene Reaktion auf Babyweinen
- Vergleich behavioristischer und bindungstheoretischer Ansätze
- Bedeutung elterlicher Sensitivität
- Kritik an bestehenden Forschungsansätzen
- Förderung elterlicher Sensitivität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Fragestellung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der angemessenen Reaktion auf Babyweinen und den damit verbundenen elterlichen Unsicherheiten. Sie kündigt den Vergleich behavioristischer und bindungstheoretischer Ansätze an und skizziert den Aufbau der Arbeit, wobei die Erkenntnisse beider Teile in einem abschließenden Fazit zusammengeführt werden.
2. Die Antwort der Behavioristen: Dieses Kapitel präsentiert den behavioristischen Ansatz, der in der Vergangenheit eine Nicht-Reaktion auf Babyweinen empfahl, um unerwünschtes Verhalten nicht zu verstärken. Es zitiert John Watson und das U.S. Children's Bureau als Vertreter dieser Sichtweise, die auf der Annahme basiert, dass jedes Verhalten erlernt und somit auch verlernt werden kann. Der Ansatz wird kritisch beleuchtet und als veraltet dargestellt, da er die komplexen Bedürfnisse des Säuglings und die Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung vernachlässigt.
3. Die Antwort der Bindungstheoretiker: Im Gegensatz zum behavioristischen Ansatz betont dieses Kapitel die Bedeutung von Bindung und die Interpretation von Babyweinen als Kommunikationsmittel. Es präsentiert die Studie von Bell und Ainsworth (1972), die einen Zusammenhang zwischen prompter mütterlicher Reaktion und reduziertem Weinen bei Babys im ersten Lebensjahr aufzeigte. Die Studie wird jedoch auch kritisch betrachtet, da sie im Widerspruch zu späteren Forschungen steht und die Problematik zu schneller Reaktionen thematisiert. Die Interpretation der Ergebnisse und deren Bedeutung für die Entwicklung der Eltern-Kind-Kommunikation werden ausführlich dargelegt. Die kontrastierende Perspektive von „Jedes Kind kann schlafen lernen“ wird ebenfalls diskutiert, wobei die Kritik an den behavioristischen Ansätzen deutlich wird.
4. Kritik und erste Lösungsansätze: Dieses Kapitel analysiert die methodischen Schwächen der vorherigen Studien. Es hebt hervor, dass der Einfluss der Versuchsleiter auf die Mutter-Kind-Interaktion nicht berücksichtigt wurde und dies die Ergebnisse beeinflusst haben könnte. Die Notwendigkeit einer differenzierteren Betrachtungsweise wird betont, die über die bloße Promptigkeit der Reaktion hinausgeht und die Komplexität der Mutter-Kind-Interaktion berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Elterliche Sensitivität, Babyweinen, Bindungstheorie, Behaviorismus, Kommunikation, Eltern-Kind-Interaktion, Bindungssicherheit, adäquate Reaktion, Stressregulation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Angemessene Reaktion auf Babyweinen
Was ist das zentrale Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die angemessene Reaktion auf das Weinen von Babys und vergleicht dabei gegensätzliche Ansätze aus behavioristischer und bindungstheoretischer Perspektive. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung und Förderung elterlicher Sensitivität.
Welche Ansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den behavioristischen Ansatz, der früher eine Nicht-Reaktion auf Babyweinen empfahl, mit dem bindungstheoretischen Ansatz, der die Bedeutung prompter Reaktionen und der Eltern-Kind-Bindung betont. Die Kritikpunkte beider Ansätze werden analysiert.
Was ist die behavioristische Sichtweise auf Babyweinen?
Der Behaviorismus, vertreten z.B. von John Watson und dem U.S. Children's Bureau, sah in Babyweinen ein erlerntes Verhalten, das durch Nicht-Reaktion ausgelöscht werden sollte. Dieser Ansatz wird in der Arbeit als veraltet und unzureichend kritisiert, da er die komplexen Bedürfnisse des Säuglings und die Bedeutung der Bindung vernachlässigt.
Was ist die bindungstheoretische Sichtweise auf Babyweinen?
Die Bindungstheorie betont die Bedeutung von Babyweinen als Kommunikationsmittel und die Wichtigkeit prompter mütterlicher Reaktionen für die Entwicklung einer sicheren Bindung. Studien wie die von Bell und Ainsworth (1972) werden diskutiert, jedoch auch kritisch hinterfragt hinsichtlich möglicher methodischer Schwächen und der Problematik zu schneller Reaktionen. Die Arbeit diskutiert auch die kontrastierende Perspektive von "Jedes Kind kann schlafen lernen".
Welche Kritikpunkte werden an den bestehenden Forschungsansätzen geübt?
Die Arbeit kritisiert methodische Schwächen in früheren Studien, wie z.B. die Nichtberücksichtigung des Einflusses der Versuchsleiter auf die Mutter-Kind-Interaktion. Es wird die Notwendigkeit einer differenzierteren Betrachtungsweise betont, die die Komplexität der Mutter-Kind-Interaktion umfassender berücksichtigt.
Welche Rolle spielt elterliche Sensitivität?
Elterliche Sensitivität spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit betont deren Bedeutung für die Entwicklung einer sicheren Bindung und die angemessene Reaktion auf die Bedürfnisse des Babys. Es wird auch die Förderung elterlicher Sensitivität als wichtiger Aspekt behandelt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Elterliche Sensitivität, Babyweinen, Bindungstheorie, Behaviorismus, Kommunikation, Eltern-Kind-Interaktion, Bindungssicherheit, adäquate Reaktion, Stressregulation.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und Fragestellung, geht dann auf die behavioristische und bindungstheoretische Perspektive ein, analysiert Kritikpunkte und Lösungsansätze und endet mit einem Fazit und einer Anmerkung.
- Arbeit zitieren
- Margarete Arlamowski (Autor:in), 2017, Elterliche Sensitivität. Welche Reaktion ist angemessen auf das Weinen eines Babys?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442733