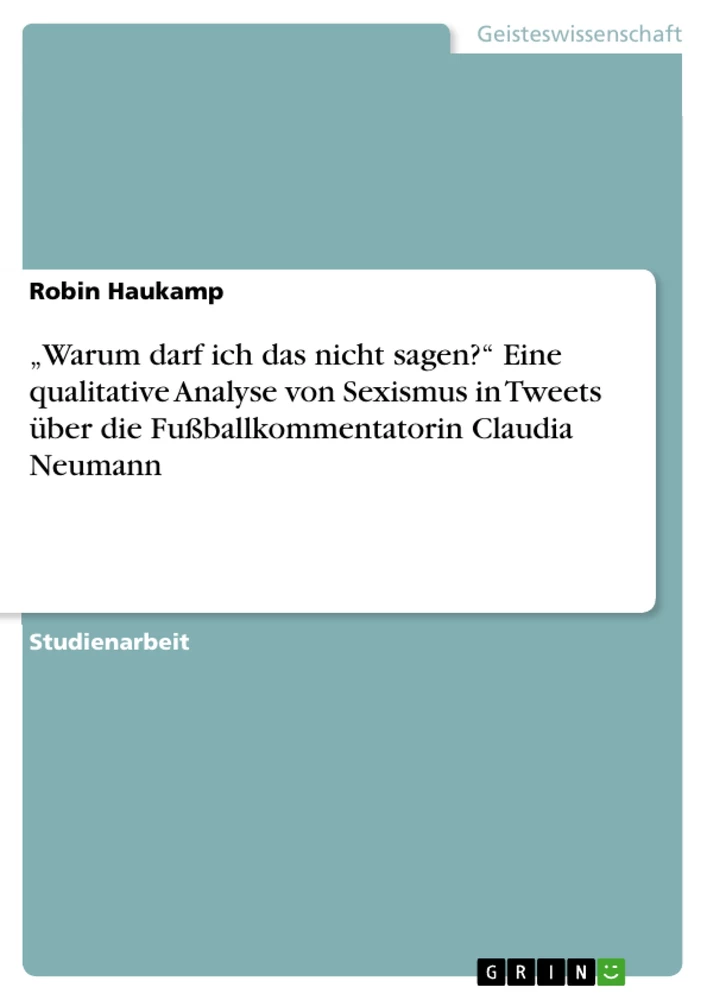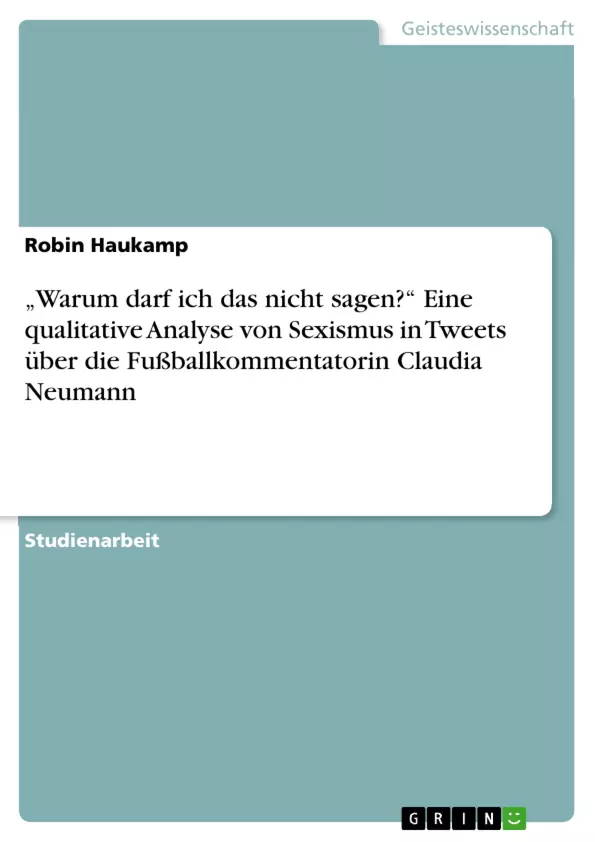Das Ziel dieser Arbeit ist durch empirische Untersuchung ausgewählter Beispiele von mehr oder weniger offenem Sexismus gegen die Fußballkommentatorin Claudia Neumann auf der Website Twitter zu analysieren. Damit steht sie in der Tradition feministischer Theoriediskurse.
Wie kann es sein, dass trotz formaler Gleichberechtigung eine solche Verteilung von Positionen herrscht? Viele SozialforscherInnen argumentieren hier mit Sexismus beziehungsweise sexistischen Strukturen in der Gesellschaft. Fußball ist nun ein Gebiet, im welchem, wie schon beschrieben, nach Geschlechtern getrennt gespielt wird und eine Männerdomäne. Er ist ein „Hort der Männlichkeit“, in welchem allerdings Frauen immer präsent sind. Auch ist der Fußball ein Gebiet, in dem Sexismus und Männlichkeitsideale stark verankert sind und häufig offen geäußert werden. Im Fußball kommen Sexismen eher nach außen, die ansonsten eher verschwiegen werden. Dies wurde deutlich, als Claudia Neumann als erste Kommentatorin im Männerfußball bei den großen Turnieren 2016 und 2018 auftrat. Viele Twitter-UserInnen beschwerten sich über ihre fachliche Unkenntnis und ihre Stimme. Diese Beschwerden gingen oft Hand in Hand mit der Anmerkung, dass es sich um sachliche Kritik handele und nicht sexistisch gemeint sei. Wiederum andere verteidigten Neumann. Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich Sexismus in Tweets über Claudia Neumann und ihre Arbeit als Fußballkommentatorin äußerte. Um dieser Frage nachzugehen, soll in einem ersten Schritt Sexismus als gesellschaftliches Phänomen definiert werden. Dafür werden verschiedene Formen des Sexismus nach Julia Becker dargestellt. Danach wird genauer auf Sexismus im Fußball eigegangen. Hier wird sich vor allem auf die Theorien von Sülzle bezogen. Im nächsten Unterkapitel werden noch einige Überlegungen zu Sexismus in sozialen Medien dargelegt, bevor in einem nächsten Schritt die Methoden dargestellt werden. Daraufhin werden fünf ausgewählte Tweets qualitativ auf Sexismen untersucht, bevor die Ergebnisse im Fazit zusammengefasst und ihre Relevanz (und Grenzen) erörtert werden. Es wäre durchaus sinnvoll gewesen, die Leistungen von Claudia Neumann mit denen ihrer männlichen Kollegen zu vergleichen. Immer wieder haben Twitter-User darauf hingewiesen, dass Neumann besonders schlechte Leistungen als Kommentatorin bringe. Dies ist bisher leider nicht untersucht worden. Jedoch scheint eher wahrscheinlich, dass alle KomentatorInnen ähnliche und ähnlich häufige Fehler machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sexismus in Tweets über Claudia Neumann
- Theoretischer Hintergrund
- Sexismus als gesellschaftliches Phänomen
- Sexismus im Fußball
- Sexismus in den sozialen Medien
- Methodische Überlegungen
- Analyse von Tweets
- „Claudia Neumann sieht nicht sehr weiblich aus“
- „Warum darf ich das nicht sagen?“
- „Bitte keine richtigen Spiele“
- „Es reicht!“
- „Jetzt fehlt wirklich nur noch die Papstwürde.“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Sexismus gegen die Fußballkommentatorin Claudia Neumann auf Twitter, indem sie ausgewählte Beispiele von mehr oder weniger offenem Sexismus analysiert. Das Ziel ist es, durch die Analyse der Tweets Hypothesen zu generieren, die die Art und Weise des Sexismus auf Twitter entschlüsseln können. Diese Hypothesen könnten als Grundlage für weitere Forschung dienen, die darauf abzielt, Interventionen in alltägliche Routinen zu ermöglichen und die Gleichstellung von Frauen im Sport zu fördern.
- Sexismus als gesellschaftliches Phänomen und seine Manifestation im Fußball
- Die Rolle der sozialen Medien im Kontext von Sexismus und öffentlichem Diskurs
- Qualitative Analyse von Tweets über Claudia Neumann und ihre Arbeit als Fußballkommentatorin
- Untersuchung der rhetorischen Strategien, die in sexistischen Tweets verwendet werden
- Bedeutung der Geschlechterverhältnisse im Fußball und die Rolle von Frauen im Sport
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel beleuchtet die Unterrepräsentation von Frauen in Positionen mit Macht und Status und die überproportionale Übernahme von Care-Arbeit durch Frauen. Es wird argumentiert, dass trotz formaler Gleichberechtigung sexistische Strukturen in der Gesellschaft bestehen, die sich auch im Fußball widerspiegeln. Claudia Neumann als erste Kommentatorin im Männerfußball bei großen Turnieren wird als Beispiel für diese Strukturen angeführt.
- Sexismus in Tweets über Claudia Neumann: Dieses Kapitel stellt den theoretischen Hintergrund der Untersuchung dar, indem es Sexismus als gesellschaftliches Phänomen, Sexismus im Fußball und Sexismus in den sozialen Medien definiert. Es werden verschiedene Formen des Sexismus nach Julia Becker sowie die Theorien von Sülzle zum Sexismus im Fußball vorgestellt.
Schlüsselwörter
Sexismus, Fußball, soziale Medien, Twitter, Claudia Neumann, Frauen im Sport, Geschlechterverhältnisse, Gleichberechtigung, öffentliche Meinung, qualitative Analyse, Rhetorik.
- Quote paper
- Robin Haukamp (Author), 2018, „Warum darf ich das nicht sagen?“ Eine qualitative Analyse von Sexismus in Tweets über die Fußballkommentatorin Claudia Neumann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443188