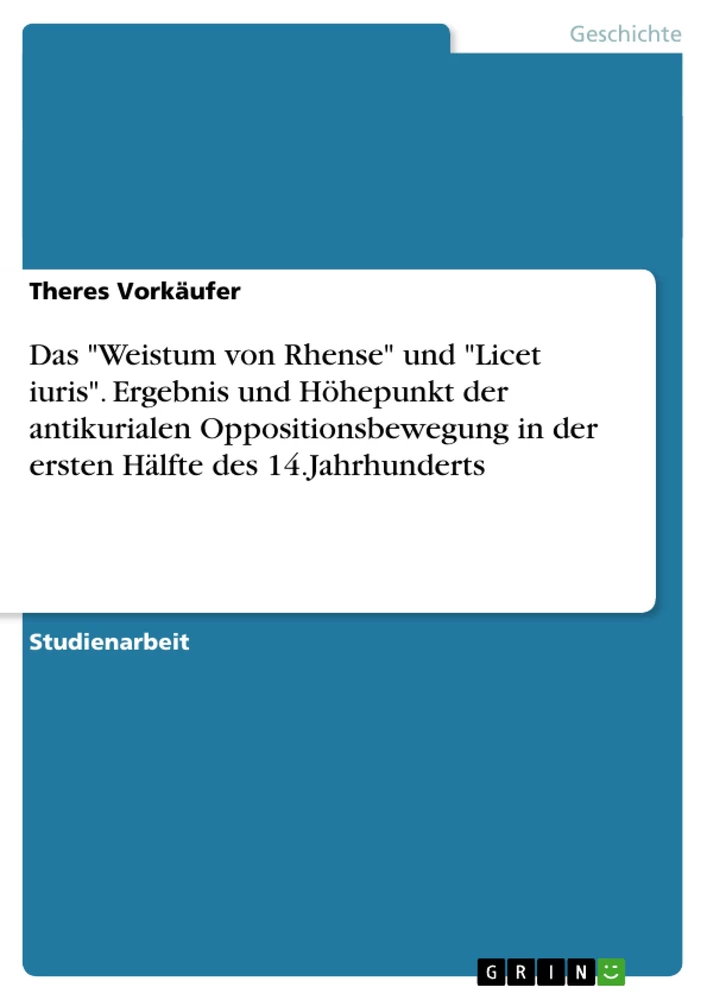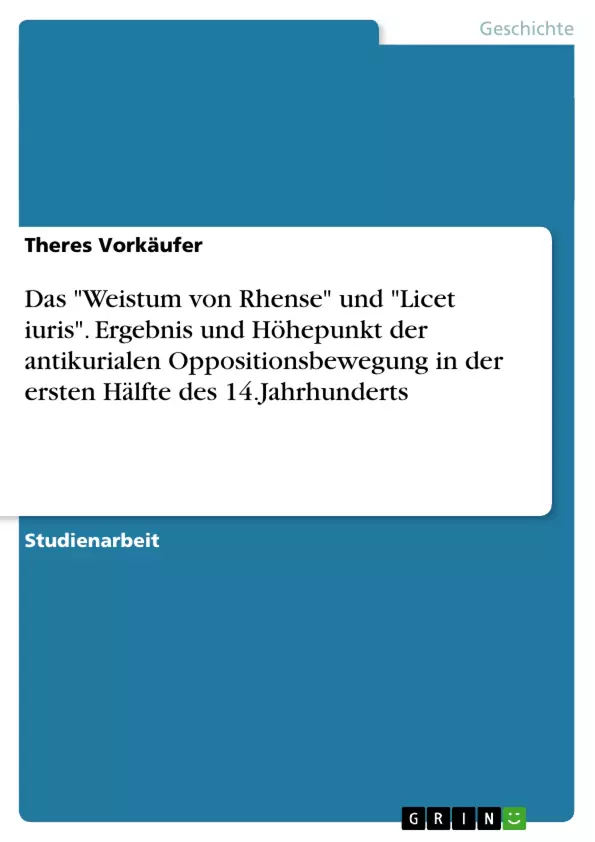„Das 14. Jahrhundert brachte fühlbare Wandlungen und bedeutsame gesellschaftliche Veränderungen und Umschichtungen mit sich.“ Sie waren das Resultat einer jahrhundertlangen Entwicklung, an deren Ende „der Streit zwischen diesen höchsten europäischen Feudalinstitutionen“ stand, resultierend „aus dem Zusammenprall der Kräfte, die unter der Führung des Königtums den zentralisierten Nationalstaat zu schaffen beabsichtigten, mit denen, die unter der Führung des Papstes an der Errichtung der Universalmacht der katholischen Kirche interessiert waren“.
Eben mit dieser Thematik sollen sich die folgenden Ausführungen befassen; speziell mit den Inhalten und der Bedeutung des kurfürstlichen „Weistums von RhenseA“ und dem kaiserlichen Gesetz „Licet iuris“ von Ludwig dem Bayern (beide aus dem Jahr 1338) im Zusammenhang mit der angesprochenen gesellschaftlichen und politischen Umgestaltung. Nach einer genauen Analyse der beiden Quellen, sowie deren Vergleich miteinander, soll eine Einbettung in den historischen Kontext erfolgen. Dabei sollen auch die Regeln der deutschen Königswahl beim Tode Kaiser Heinrich VII. und die Stellung des Papstes zu Beginn des 14.Jahrhunderts untersucht werden. Anschließend möchte ich noch die Positionen der Kurfürsten und des Kaisers hinsichtlich der Geschehnisse, als auch im Verlauf des Jahres 1338 darlegen. Alles in allem soll herausgestellt werden, weshalb man gerade diese beiden Schriftstücke als so bedeutend in der Forschung ansieht und inwiefern sie den Beginn einer anderen Ära eingeleitet haben bzw. die Grundsteine für neue politische, verfassungsrechtliche und gesellschaftliche Veränderungen in Deutschland darstellen. Es darf zu Recht von einer eigenen Epoche gesprochen werden: die Entwicklung der exklusiven Königswähler und die der damit verbundenen Entfaltung des Partikularismus macht einen entscheidenden Schritt zur Festigung ihrer Machtposition. In Deutschland entsteht eine Art von stabiler Verfassungspolitik, wie sie es vorher noch nicht gab. Jedoch konnte es diesen Neubeginn nur aufgrund eines jahrhundertlangen vorbereitenden Prozesses geben, denn „niemals liegt politische Ordnung ausschließlich im Ermessen der Zeitgenossen, schon gar nicht in einer Zeit, in der die Tradition legitimierende, rechtsetzende Kraft hatte. Kaisertum und Wahlmonarchie waren dem spätmittelalterlichen Reich vorgegeben“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Quellen
- Analyse des „Rhenser Kurfürstenweistums“
- Analyse von „,Licet iuris“
- Vergleich der beiden Quellen miteinander
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Historischer Kontext
- Die Regel für die deutsche Königswahl beim Tode Kaiser Heinrich VII.
- Die Ansprüche des Wahlrechts an eine Königswahl
- Das Verhältnis zwischen Reich und Kirche als Ausgangspunkt aller Reichspolitik
- Die Entwicklung der Kurfürsten als Königswähler
- Die Jahre 1314 – 1337 im Überblick
- Die Ereignisse des Jahres 1338
- Die Regel für die deutsche Königswahl beim Tode Kaiser Heinrich VII.
- Die Positionen der Beteiligten im Verlauf des Jahres 1338
- Die Standpunkte der Kurfürsten
- Die kaiserliche Haltung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Inhalten und der Bedeutung des kurfürstlichen „Weistums von Rhense“ und des kaiserlichen Gesetzes „Licet iuris“ von Ludwig dem Bayern (beide aus dem Jahr 1338) im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen und politischen Umgestaltung im 14. Jahrhundert.
- Analyse der beiden Quellen und deren Vergleich.
- Einbettung der Quellen in den historischen Kontext.
- Untersuchung der Regeln der deutschen Königswahl beim Tode Kaiser Heinrich VII. und der Stellung des Papstes zu Beginn des 14. Jahrhunderts.
- Darstellung der Positionen der Kurfürsten und des Kaisers im Verlauf des Jahres 1338.
- Bewertung und Interpretation der Quellen unter Berücksichtigung der zeithistorischen Umstände und Gegebenheiten.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die wichtigsten Fragestellungen und Zielsetzungen vor. Außerdem wird der historische Kontext kurz beleuchtet und die Bedeutung der beiden Quellen „Weistum von Rhense“ und „Licet iuris“ im Hinblick auf die Entwicklung der deutschen Verfassungsgeschichte hervorgehoben.
- Die Quellen: In diesem Kapitel werden die beiden Quellen, das „Weistum von Rhense“ und „Licet iuris“, detailliert analysiert und miteinander verglichen. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Inhalten und Formulierungen herausgearbeitet.
- Historischer Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Hintergrund der Quellen und setzt sie in den Kontext der deutschen Königswahl und des Verhältnisses zwischen Reich und Kirche im 14. Jahrhundert. Es werden die Regeln der Königswahl beim Tode Kaiser Heinrich VII., die Entwicklung der Kurfürsten als Königswähler und die Ereignisse der Jahre 1314 bis 1338 dargelegt.
- Die Positionen der Beteiligten im Verlauf des Jahres 1338: Dieses Kapitel untersucht die Positionen der Kurfürsten und des Kaisers im Verlauf des Jahres 1338. Es werden die jeweiligen Standpunkte der Akteure im Hinblick auf die Konflikte zwischen Kaiser und Papst sowie die Frage der Königswahl dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen des späten Mittelalters, wie der deutschen Königswahl, dem Verhältnis zwischen Reich und Kirche, der Rolle des Papsttums, dem Aufstieg der Kurfürsten und der Entwicklung des deutschen Verfassungsstaates. Dabei stehen die Quellen „Weistum von Rhense“ und „Licet iuris“ im Zentrum der Analyse, die im Kontext der antikurialen Oppositionsbewegung im 14. Jahrhundert betrachtet werden. Wichtige Konzepte sind außerdem die Entwicklung des Partikularismus, die Bedeutung der Tradition und das Streben nach einer stabilen Verfassungspolitik in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was sind das „Weistum von Rhense“ und „Licet iuris“?
Es handelt sich um zwei bedeutende Rechtsdokumente aus dem Jahr 1338, die die Unabhängigkeit der deutschen Königswahl vom päpstlichen Bestätigungsrecht festlegten.
Welchen historischen Konflikt behandeln diese Dokumente?
Sie stehen im Zentrum des Streits zwischen Kaiser Ludwig dem Bayern und dem Papsttum über die Universalmacht der Kirche gegenüber dem Nationalstaat.
Warum gelten diese Quellen als Beginn einer neuen Ära?
Sie markieren die Festigung der Machtposition der Kurfürsten als exklusive Königswähler und den Schritt hin zu einer stabilen Verfassungspolitik in Deutschland.
Wer war Kaiser Ludwig der Bayer?
Ludwig der Bayer war der römisch-deutsche Kaiser, der durch das Gesetz „Licet iuris“ den kaiserlichen Anspruch auf Herrschaft ohne päpstliche Approbation rechtlich verankerte.
Wie veränderte sich die Rolle der Kurfürsten im 14. Jahrhundert?
Die Kurfürsten entwickelten sich zu einer festen Institution, deren Mehrheitswahl allein ausreichte, um dem gewählten König die Herrschaftsgewalt zu übertragen.
Was ist der Unterschied zwischen dem Weistum und Licet iuris?
Das Weistum von Rhense war eine Erklärung der Kurfürsten, während Licet iuris ein kaiserliches Reichsgesetz war; beide verfolgten jedoch das Ziel der antikurialen Opposition.
- Arbeit zitieren
- Theres Vorkäufer (Autor:in), 2004, Das "Weistum von Rhense" und "Licet iuris". Ergebnis und Höhepunkt der antikurialen Oppositionsbewegung in der ersten Hälfte des 14.Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44377