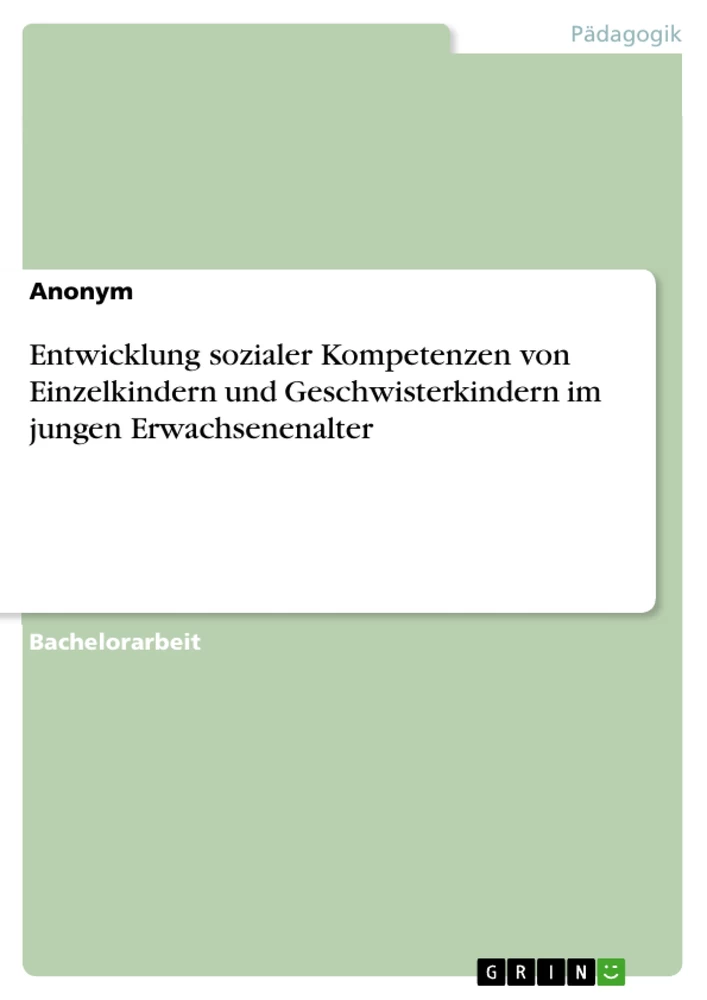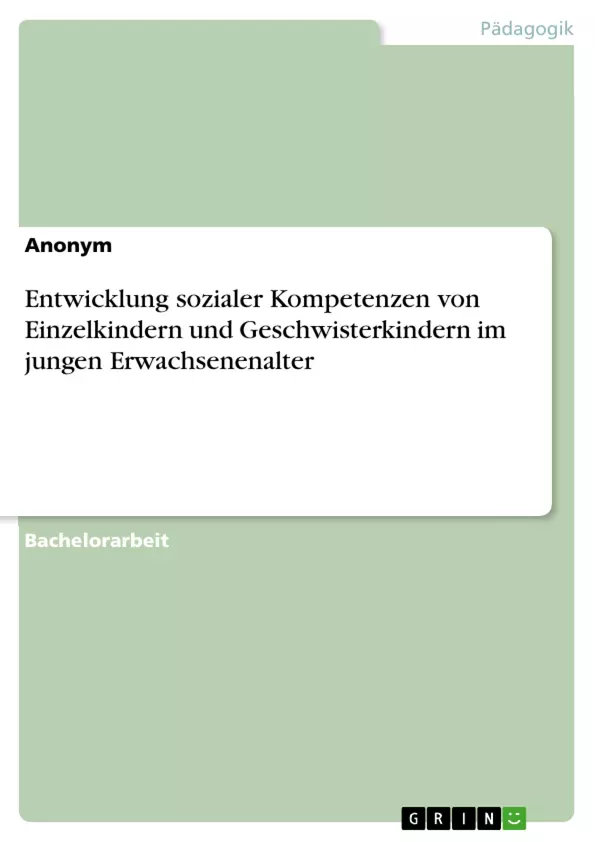In der folgenden Arbeit werden soziale Kompetenzen von Geschwisterkindern und Einzelkindern im jungen Erwachsenenalter von 18 bis 30 Jahren untersucht. Insbesondere wurde der Frage nachgegangen, ob es einen Unterschied in der Ausprägung von sozialen Kompetenzen zwischen Einzel- und Geschwisterkindern gibt. Außerdem wurden auch andere Aspekte wie die Anzahl der Geschwister, das Geschlecht, das Verhältnis der Geschwister untereinander und das Alter der Befragten in die Untersuchung miteinbezogen. Zu diesem Zweck wurden 140 Probanden und Probandinnen mittels Fragebogen befragt. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Ausprägung sozialer Kompetenzen zwischen Einzelkindern und Kindern mit Geschwistern festgestellt werden. Es konnten lediglich signifikante Unterschiede zwischen dem Alter, beziehungsweise dem Geschlecht und den Ausprägungen der sozialen Kompetenzen geklärt werden. In der heutigen Gesellschaft sind immer öfter soziale Kompetenzen erforderlich, um ein erfolgreiches Leben führen zu können. Soziale Kompetenzen sind bereits in der Schule, bei Gruppenarbeiten und auch in späteren Lebensabschnitten, wie beispielsweise bei der Arbeitssuche wichtig. Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen, sowie Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit werden stets von uns allen verlangt. Aber wie entwickeln sich diese sozialen Kompetenzen? Ist jeder Mensch gleich „sozial kompetent“, oder gibt es Unterschiede? Da die Familie als Ort der primären Sozialisation gesehen werden kann, stellt sich die Frage, ob das Aufwachsen mit oder ohne Geschwister eine Bedeutung für das spätere Leben, sowie für die Ausprägung der sozialen Kompetenzen aufweist. Der Trend zu immer kleiner werdenden Familien wird deutlich, wenn man sich die Statistiken der letzten Jahre genauer ansieht. Geschwister verbringen die meiste Zeit ihres Alltags miteinander. Sie dienen sich gegenseitig nicht nur als Spielkameraden und -kameradinnen, oder als Zeitvertreib, sondern sie können auch sehr viel voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen und einander beeinflussen. Sie halten zusammen und können sich stets aufeinander verlassen. Vielleicht ist es genau dieser Effekt, der die sozialen Kompetenzen von klein auf fördert. Aber bleibt dieser Effekt Kindern, die ohne Geschwister aufwachsen vorenthalten? Können etwaige Defizite später noch aufgearbeitet werden? Gibt es auch negative Aspekte, wenn man mit Geschwistern aufwächst?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition „Geschwisterkinder“
- Soziale Kompetenzen
- Allgemeine soziale Kompetenzen
- Die Ausprägung sozialer Kompetenzen
- Einzelkinder und Geschwisterkinder
- Definition „Einzelkinder“
- Charakteristika von Geschwisterbeziehungen
- Funktionen von Geschwisterbeziehungen
- Charakteristika von Einzelkindern
- Einzelkinder im Erwachsenenalter
- Zielsetzung und Fragestellungen
- Versuchsplan
- Auswahl der Stichprobe
- Erhebungsinstrument und Durchführung
- Soziodemographische Daten
- Daten zu Geschwistern
- Ergebnisse der Hauptfragestellungen
- Skalierung
- Hypothese 1
- Hypothese 2
- Hypothese 3
- Hypothese 4
- Hypothese 5
- Diskussion
- Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die sozialen Kompetenzen von jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 30 Jahren zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf den Einfluss von Geschwistern. Die Studie befasst sich mit der Frage, ob es Unterschiede in der Ausprägung sozialer Kompetenzen zwischen Einzelkindern und Geschwisterkindern gibt. Darüber hinaus werden weitere Aspekte wie die Anzahl der Geschwister, das Geschlecht, das Verhältnis der Geschwister untereinander und das Alter der Befragten berücksichtigt.
- Soziale Kompetenzen im jungen Erwachsenenalter
- Der Einfluss von Geschwistern auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen
- Vergleich zwischen Einzelkindern und Geschwisterkindern
- Weitere Einflussfaktoren auf soziale Kompetenzen wie Geschlecht, Alter und Geschwisterbeziehung
- Quantitative Analyse der Daten durch einen Fragebogen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz sozialer Kompetenzen in der heutigen Gesellschaft heraus und führt den Leser in die Forschungsfrage ein. Sie diskutiert die Rolle der Familie als primäre Sozialisationsinstanz und stellt den Trend zu immer kleineren Familien dar. Die Einleitung befasst sich mit dem Einfluss des Aufwachsens mit oder ohne Geschwister auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen und untersucht bestehende Vorurteile gegenüber Einzelkindern.
- Definition „Geschwisterkinder“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Geschwisterkinder“ und legt die Grundlage für die weitere Analyse.
- Soziale Kompetenzen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der sozialen Kompetenzen und definiert wichtige Unterbereiche wie allgemeine soziale Kompetenzen und die Ausprägung sozialer Kompetenzen.
- Einzelkinder und Geschwisterkinder: Dieses Kapitel untersucht die Charakteristika von Geschwisterbeziehungen und Einzelkindern, inklusive der Funktionen von Geschwisterbeziehungen und der besonderen Herausforderungen, denen Einzelkinder im Erwachsenenalter begegnen können.
- Zielsetzung und Fragestellungen: Hier werden die Hauptforschungsfrage und die zusätzlichen Forschungsfragen präzisiert, die in der vorliegenden Arbeit untersucht werden.
- Versuchsplan: Dieses Kapitel beschreibt den Versuchsplan der Studie, die Auswahl der Stichprobe und das verwendete Erhebungsinstrument.
- Soziodemographische Daten: Dieser Abschnitt präsentiert die soziodemographischen Daten der Stichprobe.
- Daten zu Geschwistern: Dieser Abschnitt stellt Daten über die Geschwisterkonstellation der Befragten dar.
- Ergebnisse der Hauptfragestellungen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der statistischen Analysen, inklusive der Ergebnisse zu den einzelnen Hypothesen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der sozialen Kompetenzen, Einzelkinder, Geschwisterkinder, Familienstruktur, primäre Sozialisation, quantitative Forschung, Fragebogenforschung und statistische Analyse. Die Studie untersucht den Einfluss von Geschwistern auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen im jungen Erwachsenenalter und berücksichtigt dabei weitere Einflussfaktoren wie Geschlecht, Alter und Geschwisterbeziehung. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse über die Bedeutung von Geschwisterbeziehungen für die Entwicklung sozialer Kompetenzen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Entwicklung sozialer Kompetenzen von Einzelkindern und Geschwisterkindern im jungen Erwachsenenalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443938