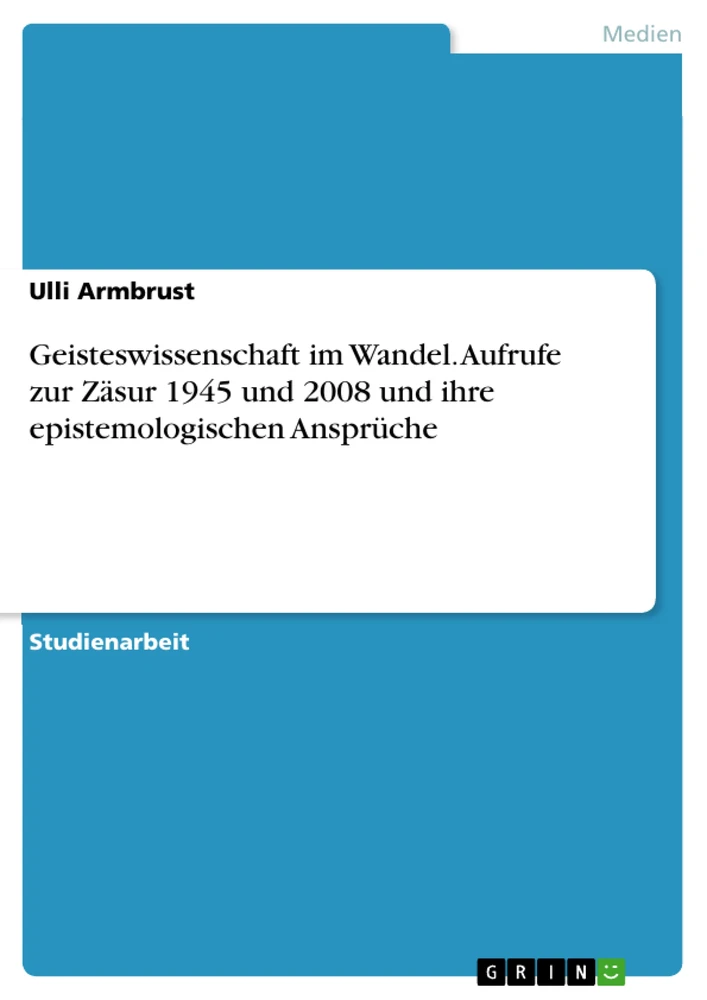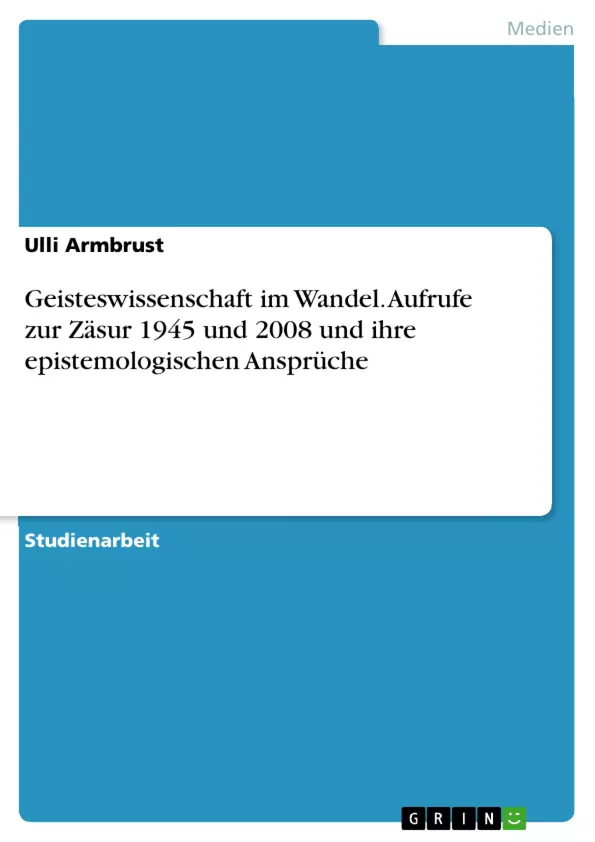Als Chris Anderson 2008 bezugnehmend auf das Big-Data-Phänomen das Ende der wissenschaftlichen Theorie ausrief, gab es aus diversen wissenschaftlichen Disziplinen ebenso Zuspruch wie Kritik. Dabei steht Anderson als Befürworter der Einführung neuer wissenschaftlicher Methoden aufgrund neuer Technologien und Unmengen an Daten längst nicht alleine da: Schon im analogen Zeitalter wurden aufgrund einer „Informationsflut“ Änderungen in der wissenschaftlichen Arbeitsweise gefordert. In dieser Seminararbeit soll die von Vannevar Bush konzipierte Memex, weniger ihre technische Funktionsweise, mehr jedoch ihre potentielle Beihilfe zur wissenschaftlichen Erkenntnis, erläutert werden, denn ähnlich wie Anderson sah Bush die Notwendigkeit einer Zäsur zum Zwecke besserer wissenschaftlicher Forschungsergebnisse. Ferner soll herausgearbeitet werden, wie die jeweiligen Daten, sei es in analoger oder digitaler Form, charakterisiert werden und für die Erkenntnisgewinnung genutzt werden sollten. Bushs Essay As we may think aus dem Jahre 1945 ist weitaus mehr als eine Vorstellung der Memex; der Fokus der Arbeit soll aber auf dem deutlich aktuelleren Diskurs um das Ende der Theorie und dem datenbasierten Arbeiten, und dieses insbesondere in den Geisteswissenschaften, liegen. Inwiefern Big Data für geistwissenschaftliche Zwecke genutzt werden kann und welche Rolle die Digital Humanities spielen, gilt es zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Probleme in der jeweiligen Wissenschaftssituation
- Die Problematik der Informationsverarbeitung (1945)
- Wissenschaftliche Theorien können die Wirklichkeit nicht erklären (2008)
- Was macht „Big Data“ aus?
- Was ist „Big Data\" für Anderson?
- Die Unmittelbarkeit der Memex
- Woraus bestehen Bushs Datenbanken und kann man im Bezug auf die Memex von „Big\nData\" sprechen?
- Ändert sich die wissenschaftliche Arbeitsweise durch die Memex?
- Big Data, Algorithmen und Korrelation reichen aus: Andersons Utopie
- Der Computational Turn
- Ist die Memex lediglich eine Erweiterung?
- ,,Ästhetik der Theorielosigkeit“ oder „Mythos Big Data\"?
- Was,,Big Data“ nicht kann
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob die zunehmende Verfügbarkeit von Daten, insbesondere im digitalen Zeitalter, das Ende der wissenschaftlichen Theorie bedeutet. Sie analysiert die Argumentation von Vannevar Bush aus dem Jahr 1945, der in seinem Essay "As we may think" die Notwendigkeit einer Zäsur für bessere wissenschaftliche Forschungsergebnisse aufgrund der "Informationsflut" forderte. Die Arbeit vergleicht Bushs Konzept der Memex mit der heutigen Big-Data-Debatte und dem "Ende der Theorie", das Chris Anderson 2008 ausrief. Sie untersucht, wie Daten, sowohl in analoger als auch in digitaler Form, charakterisiert und für die Erkenntnisgewinnung genutzt werden können, und welche Rolle die Digital Humanities in diesem Kontext spielen.
- Die Auswirkungen der Informationsüberlastung auf die wissenschaftliche Forschung
- Die Memex als Konzept zur Verbesserung der Informationsverarbeitung
- Die Debatte um das "Ende der Theorie" im Kontext von Big Data
- Die Bedeutung von Algorithmen und Korrelationen in der datenbasierten Forschung
- Die Rolle der Digital Humanities für die Geisteswissenschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik des "Endes der Theorie" und die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Zäsur vor dem Hintergrund der zunehmenden Datenmengen dar. Sie führt in die Arbeit ein und skizziert die zentralen Themenbereiche: die Memex von Vannevar Bush und die Big-Data-Debatte.
Probleme in der jeweiligen Wissenschaftssituation
Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Informationsüberlastung ergeben. Es analysiert die Problematik der Informationsverarbeitung im Jahr 1945 aus Bushs Sicht und die Kritik von Anderson am traditionellen wissenschaftlichen Vorgehen im Kontext von Big Data.
Was macht „Big Data“ aus?
Der Begriff "Big Data" wird im Kontext verschiedener Definitionen und Standpunkte beleuchtet, die sich auf seine technische, analytische und mythologische Dimension beziehen. Das Kapitel analysiert die Bedeutung von Big Data für Anderson und seine Sichtweise auf die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung.
Die Unmittelbarkeit der Memex
Dieses Kapitel befasst sich mit der Memex von Vannevar Bush und untersucht, ob Bushs Datenbanken im heutigen Kontext als "Big Data" bezeichnet werden können. Es analysiert auch die möglichen Auswirkungen der Memex auf die wissenschaftliche Arbeitsweise.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Information, Wissensverarbeitung, Digitalisierung, Theorie, Big Data, Memex, Digital Humanities, Geisteswissenschaften, Erkenntnisgewinnung, Datenanalyse, Algorithmen, Korrelation, Kausalität. Sie untersucht den Einfluss von Daten und Technologie auf die wissenschaftliche Arbeitsweise und beleuchtet die Debatte um das "Ende der Theorie" im Kontext des datenbasierten Denkens.
- Citation du texte
- Ulli Armbrust (Auteur), 2018, Geisteswissenschaft im Wandel. Aufrufe zur Zäsur 1945 und 2008 und ihre epistemologischen Ansprüche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444051