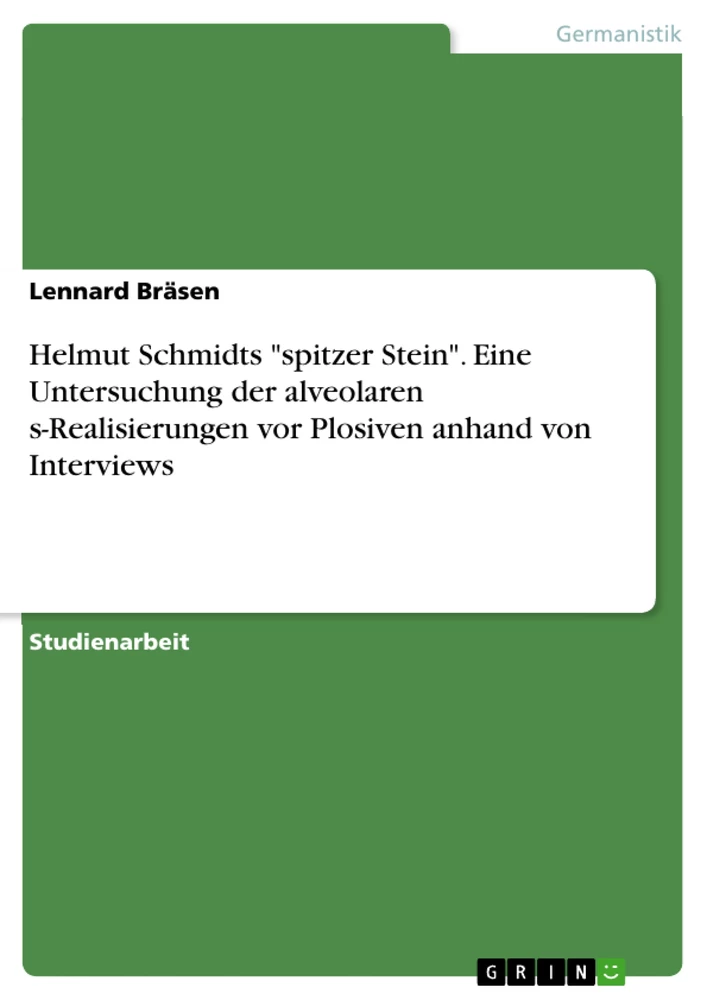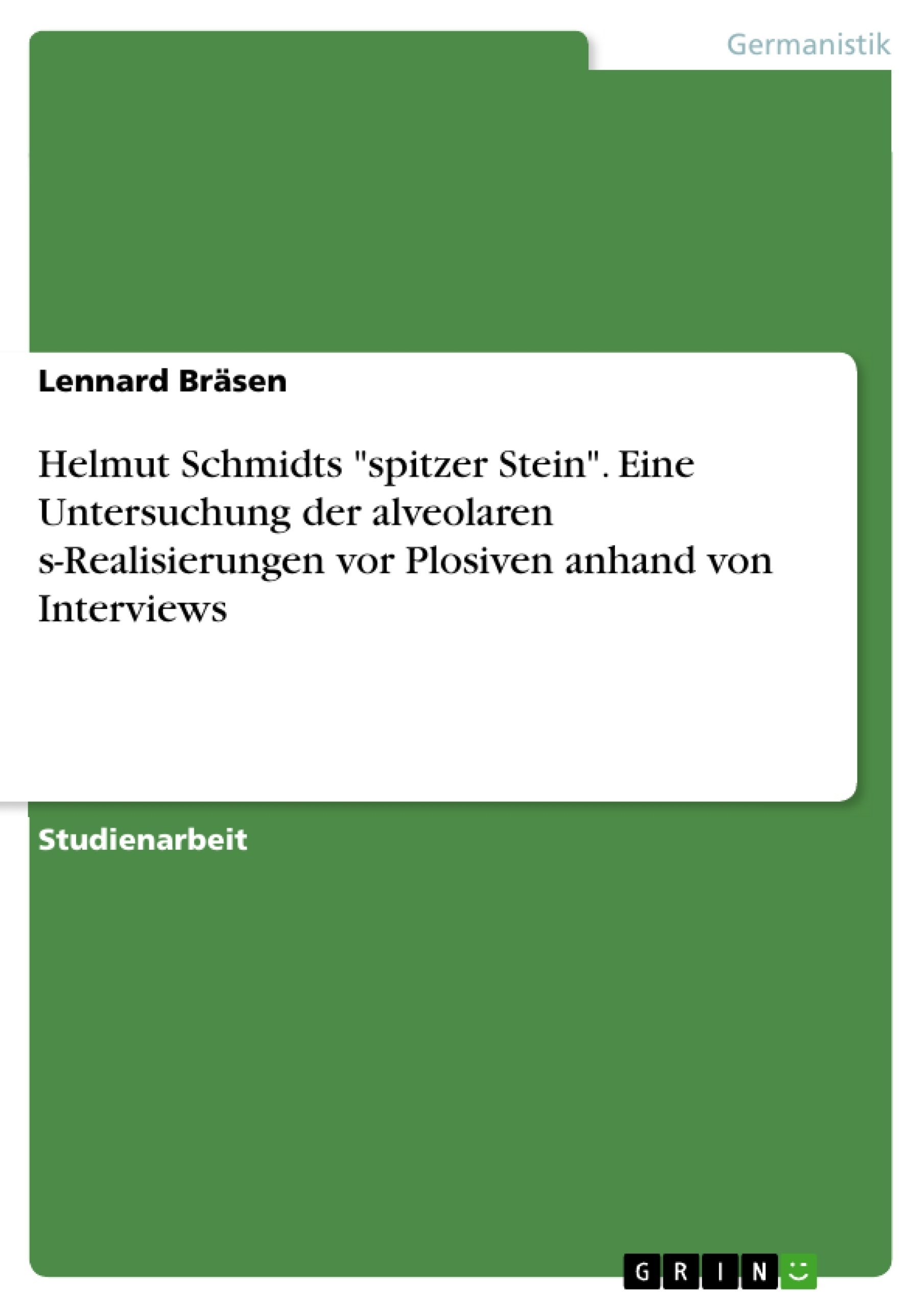Helmut Schmidt war, abseits seiner politischen Karriere, nicht nur wegen seines scharfen Verstands und seiner markigen Sprüche bekannt. Der Kettenraucher stolperte auch gerne über den spitzen Stein. Sogar Olaf Scholz, ehemaliger Erster Bürgermeister von Hamburg, hob in einer Rede anlässlich des Todes des Altkanzlers hervor, dass man seine Jugend in Hamburg-Barmbek stets heraushören konnte. Obwohl Schmidt dafür bekannt ist, statt der palatalen Sprechweise ("schp/scht"), die alveolare ("s-pitzer S-tein") zu verwenden, zeigen die Untersuchungen dieser Arbeit, dass sich dieses Dialektmerkmal lediglich unregelmäßig und inkonsequent bei ihm nachweisen lässt. Angesichts der Feststellung Peter Auers, dass Personen, welche dieses Merkmal aufweisen, entweder zu annähernd 100 Prozent über den "spitzen Stein stolpern" oder es überhaupt nicht tun, scheint Helmut Schmidt eine Ausnahme darzustellen. Die für diese Arbeit erhobenen Daten wurden aus aufgezeichneten Interviews zwischen den Jahren 1965 und 2015 abgeleitet (ausführliche Informationen dazu sind dem Anhang dieser Arbeit zu entnehmen). Die Auswertung der Daten legt nahe, dass Schmidt die alveolare Variante unregelmäßig realisiert. Zudem wird der Frage nachgegangen, ob sich ein Wandel hinsichtlich dieses Merkmals bei ihm feststellen lässt. Abschließend werden möglich Gründe angeführt, die erklären könnten, weshalb Schmidt lediglich 5 bis 20 Prozent der s-Laute vor Plosiven alveolar realisiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methodik
- 3. Interview aus dem Jahr 1965
- 3.1. Interview aus dem Jahr 1966
- 3.2. Interview aus dem Jahr 1989
- 3.3. Interview aus dem Jahr 1997
- 3.4. Interview aus dem Jahr 2015
- 4. Fazit: Feststellung Auers und das Beispiel „Helmut Schmidt“.
- 4.1. Fazit: Ausspracheveränderung im Laufe der Zeit..
- 4.2 Fazit: Gründe für die unregelmäßige Verwendung des Merkmals.
- 5. Quellenverzeichnis.
- 6. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der alveolaren Realisierung von /s/ vor Plosivlauten in anlautenden Konsonantenverbindungen im Hamburger Sprachraum. Insbesondere wird das Beispiel von Helmut Schmidt untersucht, der trotz Zugehörigkeit zu einem Milieu, das diese Ausspracheform nicht kennzeichnen sollte, gelegentlich den „spitzen Stein“ realisiert.
- Analyse der alveolaren /s/-Realisierung in anlautenden Konsonantenverbindungen vor Plosivlauten
- Untersuchung der sprachlichen Veränderungen im Laufe der Zeit
- Zusammenhang zwischen sozialem Milieu und sprachlicher Variation
- Erläuterung der Feststellung Auers bezüglich der unregelmäßigen Verwendung des Merkmals
- Analyse des Beispiels „Helmut Schmidt“ im Kontext der Milieu- und Altersabhängigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der alveolaren /s/-Realisierung in anlautenden Konsonantenverbindungen vor Plosivlauten ein und stellt den Forschungsgegenstand, Helmut Schmidt, vor. Kapitel 2 erläutert das methodische Vorgehen der Datenerhebung, die sich auf fünf Interviews mit Helmut Schmidt aus verschiedenen Jahren stützt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselwörter alveolare /s/-Realisierung, anlautende Konsonantenverbindungen, Plosivlaute, Hamburger Sprachraum, Soziales Milieu, Altersabhängigkeit, Helmut Schmidt, Ausspracheveränderung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Redewendung "über den spitzen Stein stolpern"?
Es bezieht sich auf eine spezifische Hamburger Ausspracheform, bei der das "s" vor Plosiven (wie p oder t) alveolar als "s-p" oder "s-t" statt palatal ("schp"/"scht") ausgesprochen wird.
Warum ist Helmut Schmidt ein besonderes Untersuchungsobjekt für diese Studie?
Obwohl Schmidt aus einem Milieu stammte, das diese Dialektform normalerweise nicht nutzt, verwendete er sie unregelmäßig (in etwa 5 bis 20 Prozent der Fälle).
Welchen Zeitraum decken die untersuchten Interviews ab?
Die Daten wurden aus aufgezeichneten Interviews zwischen den Jahren 1965 und 2015 abgeleitet.
Was besagt die Feststellung von Peter Auer in diesem Kontext?
Auer stellte fest, dass Sprecher dieses Merkmal entweder fast zu 100 Prozent oder gar nicht verwenden; Schmidt stellt hierbei eine Ausnahme dar.
Hat sich Schmidts Aussprache im Laufe der Zeit verändert?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage eines möglichen Wandels hinsichtlich des Merkmals über ein halbes Jahrhundert hinweg.
- Arbeit zitieren
- Lennard Bräsen (Autor:in), 2016, Helmut Schmidts "spitzer Stein". Eine Untersuchung der alveolaren s-Realisierungen vor Plosiven anhand von Interviews, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444196