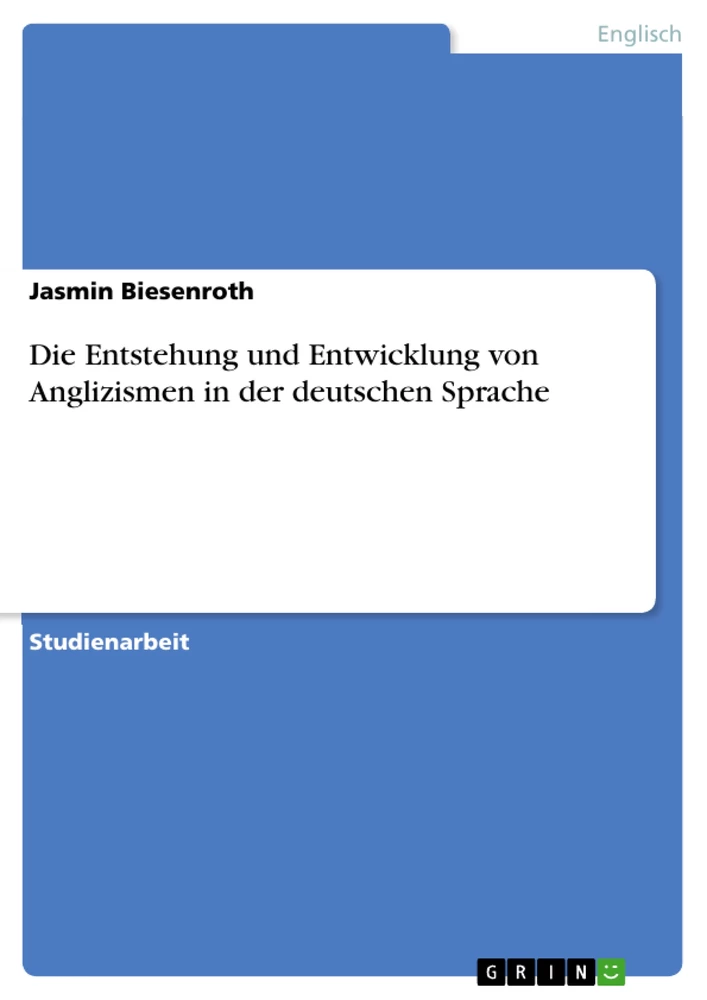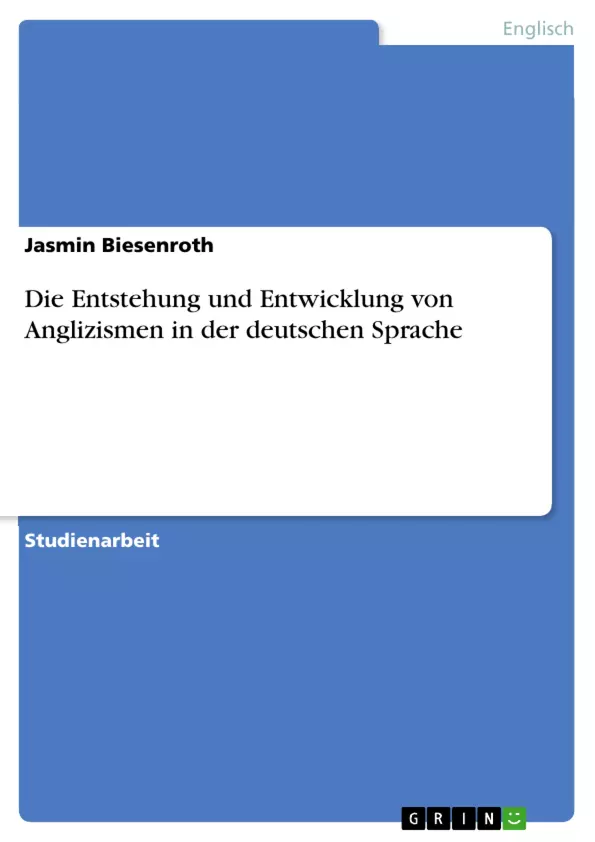Inwiefern Anglizismen in die deutsche Sprache integriert und wie die englischen Entlehnungen aufgenommen werden, sind Fragestellungen, mit denen ich mich in dieser Arbeit auseinandersetzen werde. Dabei werde ich vor allem auf die Entwicklung der britischen und amerikanischen Anglizismen eingehen und ergründen, warum die Einteilung in Lehnwörter vorteilhafter ist für die Dokumentation englischer Entlehnungen. Darüber hinaus wird die historische Entwicklung von Fremdwörtern eine wichtige Rolle spielen im Versuch, die englische Sprache als Weltsprache zu konzipieren, und ich werde ebenfalls die Gründe der Akzeptanz des englischen Einflusses betrachten. Letztlich werde ich genauer betrachten, warum und wie die Einwirkung von Anglizismen die englische Sprache zu einer Weltsprache macht.
Die Entwicklung von Anglizismen in der deutschen Sprache ist ein faszinierender und umstrittener Vorgang von Sprachwandelprozessen über die letzten Jahrhunderte. Die Frage nach dem Ursprung und der weiteren Entwicklung der englischen Entlehnungen ist eine zum Teil vielfach belegte Thematik, die über die Jahre hinweg zu vielen unterschiedlichen Diskussionen über die Vor- und Nachteile des englischen Einflusses auf die deutsche Sprache geführt hat. Dabei spielt vor allem die Integration der englischen Entlehnungen in die deutsche Sprache eine wichtige Rolle, aber auch der Kampf gegen die Eingliederung der Fremdwörter hat einen ausschlaggebenden Effekt darauf. Die fehlende Dokumentation in den letzten Jahrhunderten erschwert es der Forschung zudem genau festzulegen, wie Anglizismen tatsächlich entlehnt werden. Aufgrund dessen wird eine Klassifikation der Entlehnungen versucht, die sich auf die unterschiedlichen Bereiche der Sprachwissenschaft wie Morphologie, Phonologie, Phonetik und Pragmatik bezieht. Jedoch ist die Art der Einteilung ziemlich unübersichtlich auf Grund der fehlenden Dokumentation über die Entlehnungen, weshalb eine Gliederung in Lehnwörter entwickelt worden ist. Die Gliederung nach den unterschiedlichen Arten von Lehnwörtern beurteilt die entlehnten Begriffe nach Grad der Übersetzung und Integration und bietet so einen anschaulicheren Überblick über die Eingliederung der Entlehnungen in die deutsche Sprache.
Inhaltsverzeichnis
- Der Ursprung von Anglizismen in der deutschen Sprache
- Anglizismen: Definitionen
- Vor 1945: Britische Anglizismen
- Nach 1945: Amerikanische Anglizismen
- Klassifikationen
- Lexikalisch
- Morphologisch
- Phonetisch
- Pragmatisch
- Lehnwörter
- Lehnschöpfung, Lehnwendung
- Scheinentlehnung, Lehnübersetzung, Lehnübertragung
- Lehnbedeutung, Doppelentlehnung
- Anglizismus in der deutschen Sprache
- Anglizismen - Bereiche des Einflusses
- Die unterschiedlichen Anwendungsgebiete von Anglizismen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Integration von Anglizismen in der deutschen Sprache. Ziel ist es, den Ursprung und die Auswirkungen des englischen Einflusses auf die deutsche Sprache zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf die Integration von englischen Entlehnungen und die historische Entwicklung von Fremdwörtern.
- Die Geschichte der englischen Entlehnungen in der deutschen Sprache
- Die Klassifikation von Anglizismen
- Der Einfluss von Anglizismen auf verschiedene Bereiche der deutschen Sprache
- Die Rolle der englischen Sprache als Weltsprache
- Die Akzeptanz und Integration von Anglizismen in den deutschen Sprachgebrauch
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Ursprung von Anglizismen in der deutschen Sprache und beleuchtet die historischen Einflüsse und die Herausforderungen bei der Dokumentation der Entlehnungen. Kapitel zwei definiert Anglizismen und Fremdwörter und analysiert deren Bedeutung und Integration in den deutschen Sprachgebrauch. Es werden verschiedene Arten von Anglizismen und die Herausforderungen der Sprachentwicklung im Kontext des Sprachwandels und der Internationalisierung beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Anglizismen, Fremdwörter, Sprachwandel, Internationalisierung, Sprachgeschichte, Lehnwörter, englische Sprache, Weltsprache, Integration, Akzeptanz, deutsche Sprache, britische und amerikanische Anglizismen.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Anglizismen in der deutschen Sprache klassifiziert?
Die Klassifikation erfolgt nach lexikalischen, morphologischen, phonetischen und pragmatischen Kriterien.
Was ist der Unterschied zwischen Lehnübersetzung und Scheinentlehnung?
Eine Lehnübersetzung überträgt den Inhalt exakt (z.B. Wolkenkratzer), während eine Scheinentlehnung englisch klingt, aber im Englischen so nicht existiert (z.B. Handy).
Wann traten vermehrt amerikanische Anglizismen auf?
Ein massiver Einfluss amerikanischer Anglizismen ist vor allem in der Zeit nach 1945 zu verzeichnen.
Warum ist die Dokumentation von Anglizismen schwierig?
Aufgrund fehlender historischer Dokumentation in früheren Jahrhunderten lässt sich der genaue Zeitpunkt vieler Entlehnungen oft nur schwer festlegen.
Welche Rolle spielen Lehnwörter bei der Integration?
Lehnwörter werden nach dem Grad ihrer Übersetzung und Integration beurteilt, was einen Überblick über die Eingliederung in den deutschen Sprachschatz bietet.
- Citar trabajo
- Jasmin Biesenroth (Autor), 2018, Die Entstehung und Entwicklung von Anglizismen in der deutschen Sprache, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444212