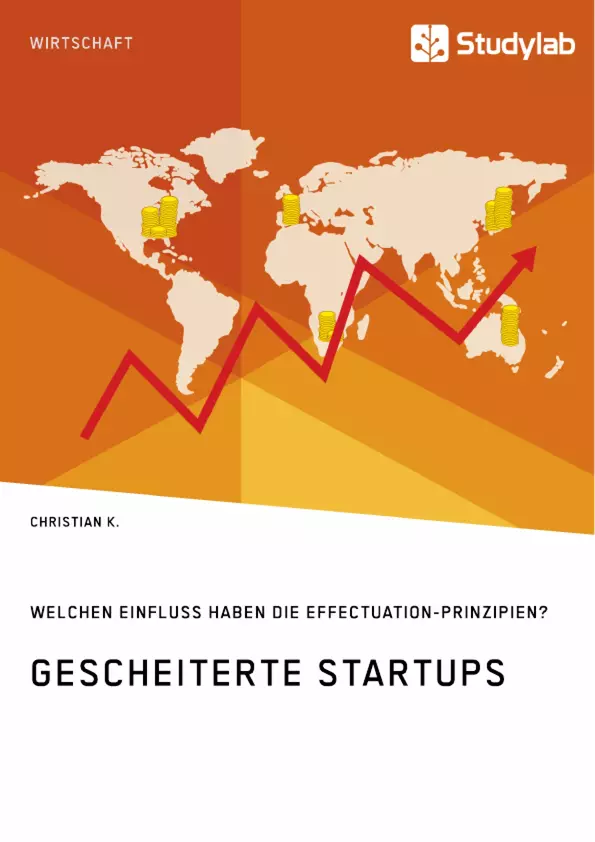Jedem Erfolg gehen zahlreiche Experimente und Fehlversuche voraus. Gerade in unserer modernen Umwelt sind Vorhersagen oftmals unzuverlässig. Die Effectuation-Logik liefert deshalb ein alternatives Modell der Entscheidungsfindung.
Vor allem Startups verwenden dieses Modell häufig. Allerdings haben Experten das Scheitern in diesem Kontext bisher ausgeblendet. Diese Publikation zum Scheitern von Startups schließt diese Lücke nun endlich.
Wie hängen das Scheitern von Startups und die effectuale Entscheidungslogik zusammen? Welchen Einfluss haben die Effectuation-Prinzipien? Und begünstigt eine nicht-effectuale Vorgehensweise das Scheitern? Der Autor analysiert die Beispiele, die man meist übersieht, aus denen Gründer aber am meisten lernen können.
Aus dem Inhalt:
- Innovation;
- Entrepreneurship;
- Unternehmer;
- Causation;
- Unternehmensleistung
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Eingrenzungen
- Innovation
- Entrepreneurship
- Unternehmer
- Startup
- Abgrenzung von Startups zu kleinen und mittleren Unternehmen
- Scheitern von Unternehmen
- Erklärungsansätze unternehmerischen Handelns
- Effectuation und Causation als alternative Entscheidungslogiken
- Die Prinzipien von Effectuation
- Der Effectuation-Prozess
- Stand der Forschung
- Forschungserkenntnisse zu den Ursachen des Scheiterns von Startups
- Einfluss von Effectuation und Causation auf die Unternehmensleistung
- Forschungslücke und empirischer Untersuchungsansatz
- Forschungslücke und forschungsleitende Fragestellungen
- Empirischer Untersuchungsansatz
- Vorstellung des empirischen Untersuchungsansatzes
- Vorstellung der empirischen Untersuchung
- Auswertung der Ergebnisse
- Diskussion der Ergebnisse
- Limitation der Arbeit und Implikationen für die weitere Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Effectuation-Prinzipien auf das Scheitern von Startups. Ziel ist es, Forschungslücken zu identifizieren und durch eine empirische Untersuchung den Zusammenhang zwischen Effectuation, Causation und der Unternehmensleistung zu beleuchten.
- Begriffliche Abgrenzung von Startups und deren Scheitern
- Effectuation und Causation als alternative Entscheidungslogiken
- Analyse des Stands der Forschung zum Scheitern von Startups
- Empirische Untersuchung des Einflusses von Effectuation auf die Unternehmensleistung
- Identifizierung von Forschungslücken und Implikationen für zukünftige Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der gescheiterten Startups und den Einfluss von Effectuation-Prinzipien ein. Sie skizziert die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit. Sie bietet eine kurze Übersicht über die folgenden Kapitel und ihre Inhalte.
Begriffliche Eingrenzungen: Dieses Kapitel liefert klare Definitionen zentraler Begriffe wie Innovation, Entrepreneurship, Unternehmer, Startup und deren Abgrenzung zu KMU. Es analysiert die verschiedenen Facetten des Unternehmensversagens und legt die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel. Die Definitionen schaffen ein gemeinsames Verständnis des Themengebietes und bilden die Basis für die anschließende Analyse.
Erklärungsansätze unternehmerischen Handelns: Dieses Kapitel präsentiert Effectuation und Causation als zwei gegensätzliche Entscheidungslogiken im unternehmerischen Handeln. Es beschreibt detailliert die Prinzipien von Effectuation und den zugehörigen Prozess. Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung beider Ansätze und ihrer jeweiligen Implikationen für unternehmerische Entscheidungen, insbesondere im Kontext von Startups.
Stand der Forschung: Das Kapitel fasst den aktuellen Forschungsstand zu den Ursachen des Scheiterns von Startups zusammen und analysiert den Einfluss von Effectuation und Causation auf die Unternehmensleistung. Es dient als Grundlage für die Identifizierung von Forschungslücken und der Formulierung der Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit. Es bewertet kritisch vorhandene Studien und hebt Diskrepanzen oder Unsicherheiten hervor.
Forschungslücke und empirischer Untersuchungsansatz: Dieses Kapitel identifiziert die Forschungslücke, formuliert die Forschungsfragen, und beschreibt den gewählten empirischen Untersuchungsansatz. Es begründet die Wahl der Methodik und erläutert die Vorgehensweise der empirischen Studie. Der Abschnitt legt die methodologische Grundlage dar und rechtfertigt die getroffenen Entscheidungen im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfragen.
Vorstellung der empirischen Untersuchung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung und diskutiert diese im Kontext des Forschungsstands. Es enthält eine detaillierte Auswertung der Daten, um die Forschungsfragen zu beantworten. Das Kapitel analysiert die Ergebnisse und stellt Bezüge zu den theoretischen Überlegungen der vorherigen Kapitel her.
Schlüsselwörter
Startups, Effectuation, Causation, Unternehmensgründung, Unternehmensscheitern, Entscheidungslogiken, empirische Forschung, KMU, Innovation, Entrepreneurship.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Einfluss von Effectuation-Prinzipien auf das Scheitern von Startups"
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Effectuation-Prinzipien auf das Scheitern von Startups. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen Effectuation, Causation und der Unternehmensleistung und identifiziert Forschungslücken in diesem Bereich.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Begriffsbestimmung (Innovation, Entrepreneurship, Startup, KMU, etc.), eine Darstellung von Effectuation und Causation als Entscheidungslogiken, eine Literaturanalyse zum Scheitern von Startups, die Beschreibung einer empirischen Untersuchung zum Einfluss von Effectuation auf die Unternehmensleistung, sowie eine Diskussion der Ergebnisse und der Implikationen für die zukünftige Forschung.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die konkreten Forschungsfragen werden im Kapitel "Forschungslücke und empirischer Untersuchungsansatz" detailliert formuliert. Die Arbeit zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen der Anwendung von Effectuation-Prinzipien und dem Erfolg bzw. Misserfolg von Startups zu ergründen und bestehende Forschungslücken zu schließen.
Welche Methode wird in der empirischen Untersuchung verwendet?
Die genaue Methodik der empirischen Untersuchung wird im Kapitel "Forschungslücke und empirischer Untersuchungsansatz" und "Vorstellung der empirischen Untersuchung" beschrieben. Die Arbeit erläutert die gewählte Vorgehensweise und begründet die methodischen Entscheidungen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden im Kapitel "Vorstellung der empirischen Untersuchung" präsentiert und diskutiert. Die Auswertung der Daten und die Interpretation der Ergebnisse im Kontext des Forschungsstandes werden detailliert beschrieben.
Welche Limitationen der Arbeit werden angesprochen?
Das Kapitel "Vorstellung der empirischen Untersuchung" behandelt auch die Limitationen der Arbeit und deren Implikationen für die weitere Forschung. Dies umfasst mögliche Einschränkungen der Methodik und der Übertragbarkeit der Ergebnisse.
Wie sind Startups und KMUs abgegrenzt?
Die klare Abgrenzung von Startups zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) erfolgt im Kapitel "Begriffliche Eingrenzungen". Dieser Abschnitt liefert präzise Definitionen und Unterscheidungsmerkmale.
Was sind Effectuation und Causation?
Effectuation und Causation werden im Kapitel "Erklärungsansätze unternehmerischen Handelns" als gegensätzliche Entscheidungslogiken im unternehmerischen Handeln erklärt. Die Prinzipien von Effectuation und der Effectuation-Prozess werden detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Startups, Effectuation, Causation, Unternehmensgründung, Unternehmensscheitern, Entscheidungslogiken, empirische Forschung, KMU, Innovation, Entrepreneurship.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel findet sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel". Dieser Abschnitt bietet eine kurze Übersicht über den Inhalt jedes Kapitels.
- Quote paper
- Christian K. (Author), 2019, Gescheiterte Startups. Welchen Einfluss haben die Effectuation-Prinzipien?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444221