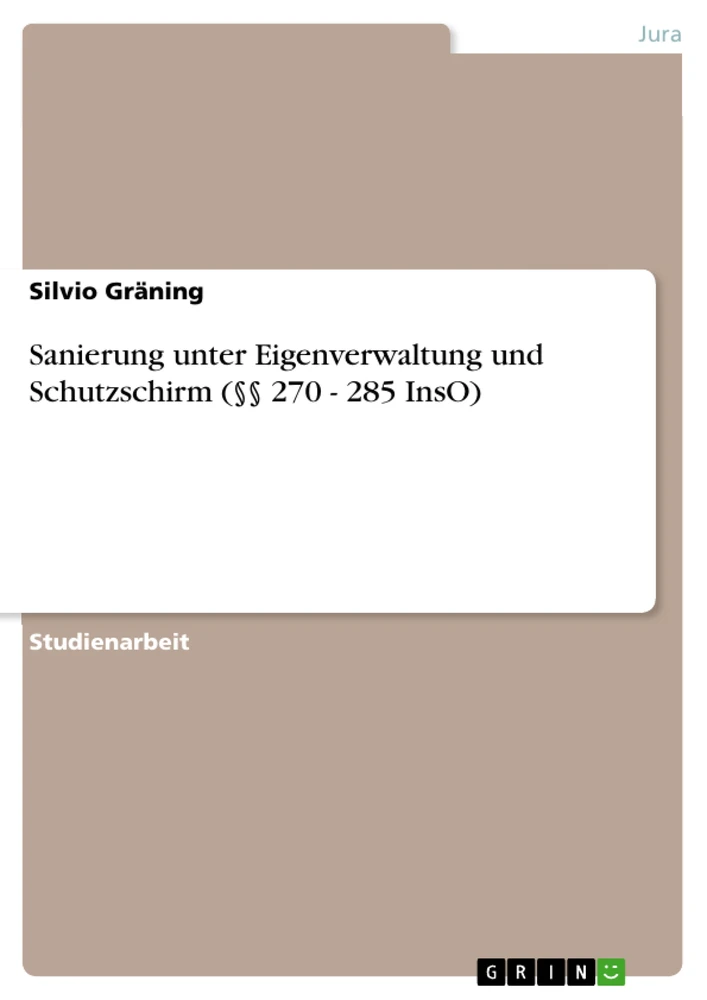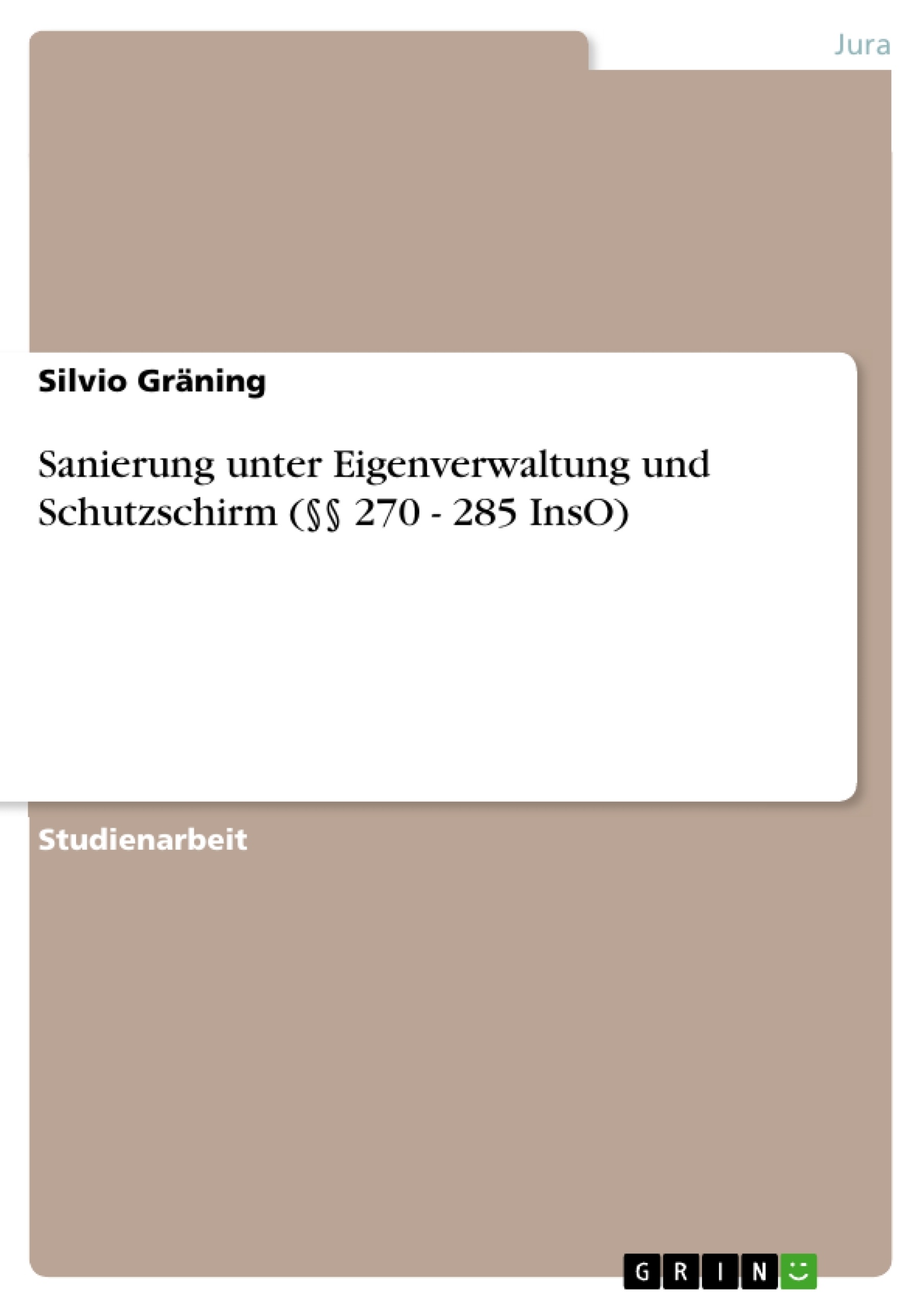Insolvenzen stellen, nicht nur wegen der betriebswirtschaftlichen Situation und der Stigmatisierung, für die betroffenen Schuldner eine schwierige Situation dar, auch für die Gläubiger und die gesamte Volkswirtschaft ist der aus Unternehmensinsolvenzen resultierende Schaden immens.
Mit dieser Arbeit soll der Versuch unternommen werden aufzuzeigen, welche rechtlichen Voraussetzungen gegeben sein müssen, um rechtzeitig eine Sanierung des Unternehmens unter Eigenverwaltung und Schutzschirm gem. der §§ 270 – 285 InsO in die Wege leiten zu können. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass zu einer erfolgreichen Unternehmenssanierung viele weitere Schritte nötig sind und die formalen Voraussetzungen lediglich als Wegbereiter dienen können.
Es werden die Insolvenzgründe und der Gang des Insolvenzverfahrens unter Eigenverwaltung oder im Schutzschirmverfahren beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Insolvenz, Insolvenzgründe und Ziele des Insolvenzverfahrens
- Zahlungsunfähigkeit gemäß § 17 InsO
- Drohende Zahlungsunfähigkeit gemäß § 18 InsO
- Überschuldung gemäß § 19 InsO
- Sanierung unter Eigenverwaltung und Schutzschirm
- Eigenverwaltung
- Vorläufige Eigenverwaltung
- Schutzschirmverfahren
- Bescheinigung
- Sanierungsplan
- (vorläufiger) Sachwalter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den rechtlichen Voraussetzungen für eine Sanierung von Unternehmen unter Eigenverwaltung und Schutzschirm gemäß §§ 270 – 285 InsO. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Insolvenzgründe und die Ziele des Insolvenzverfahrens, um den Kontext der Sanierungsmöglichkeiten im Rahmen von Eigenverwaltung und Schutzschirm zu beleuchten. Die Schwerpunkte liegen auf der Beschreibung der jeweiligen Verfahren und den damit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen.
- Insolvenzgründe (Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung)
- Ziele des Insolvenzverfahrens
- Sanierungsmöglichkeiten unter Eigenverwaltung und Schutzschirm
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Eigenverwaltung und des Schutzschirms
- Relevanz und Bedeutung des Sachwalters
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik von Unternehmensinsolvenzen dar und beleuchtet die steigende Anzahl von Insolvenzen in Deutschland. Sie führt den Leser in die Thematik der Sanierung unter Eigenverwaltung und Schutzschirm ein und zeigt die Bedeutung dieser Verfahren für die Rettung von Unternehmen auf.
- Insolvenz, Insolvenzgründe und Ziele des Insolvenzverfahrens: Dieses Kapitel erläutert die verschiedenen Insolvenzgründe wie Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Es werden die rechtlichen Grundlagen und die Ziele des Insolvenzverfahrens im Allgemeinen beschrieben.
- Sanierung unter Eigenverwaltung und Schutzschirm: Dieses Kapitel befasst sich mit der Sanierung unter Eigenverwaltung und Schutzschirm. Es beschreibt die verschiedenen Verfahren, die rechtlichen Voraussetzungen und die Rolle des Sachwalters.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Seminararbeit sind Unternehmensinsolvenz, Sanierung, Eigenverwaltung, Schutzschirm, Insolvenzordnung (InsO), Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Sachwalter, Sanierungsplan, Bescheinigung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren?
Die Eigenverwaltung erlaubt der Geschäftsführung, das Unternehmen selbst zu sanieren. Das Schutzschirmverfahren ist eine spezielle Form der Eigenverwaltung bei drohender Zahlungsunfähigkeit, um einen Sanierungsplan zu erstellen.
Was sind die gesetzlichen Insolvenzgründe?
Man unterscheidet zwischen Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO), drohender Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) und Überschuldung (§ 19 InsO).
Welche Rolle spielt der Sachwalter?
In der Eigenverwaltung gibt es keinen Insolvenzverwalter, sondern einen Sachwalter, der die Geschäftsführung überwacht und die Interessen der Gläubiger wahrt.
Was ist ein Sanierungsplan?
Ein Sanierungsplan legt fest, wie das Unternehmen restrukturiert werden soll, um die Insolvenz zu beenden und den Fortbestand des Betriebs zu sichern.
Welche Vorteile bietet die Eigenverwaltung für den Schuldner?
Die Geschäftsführung behält die Kontrolle, das Know-how bleibt im Unternehmen und die Stigmatisierung der klassischen Insolvenz kann verringert werden.
- Citar trabajo
- Silvio Gräning (Autor), 2018, Sanierung unter Eigenverwaltung und Schutzschirm (§§ 270 - 285 InsO), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444225