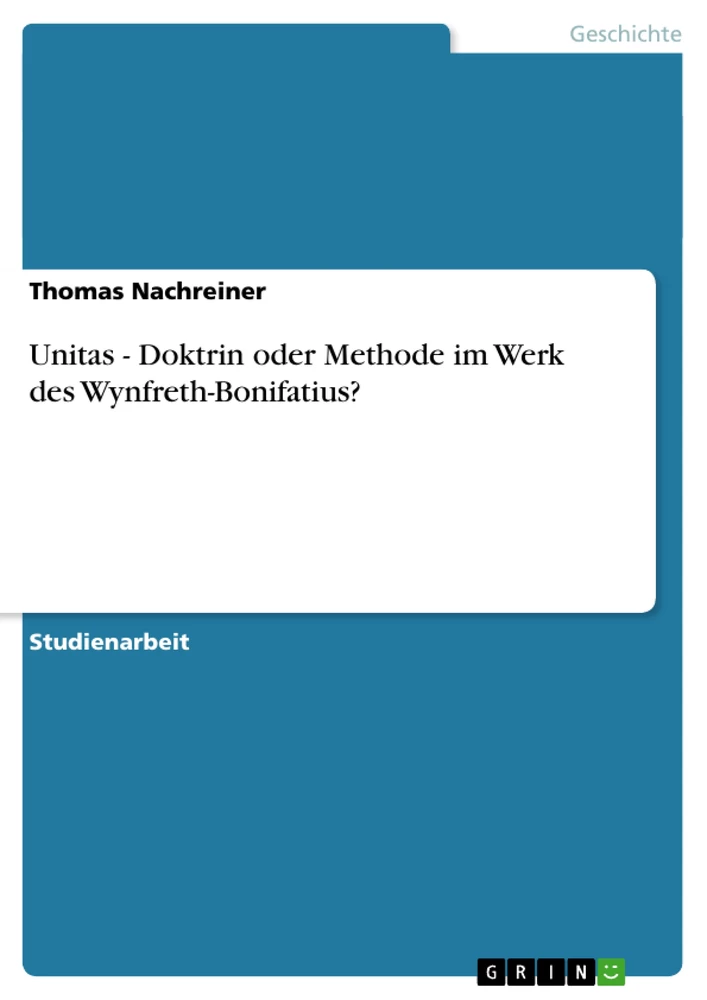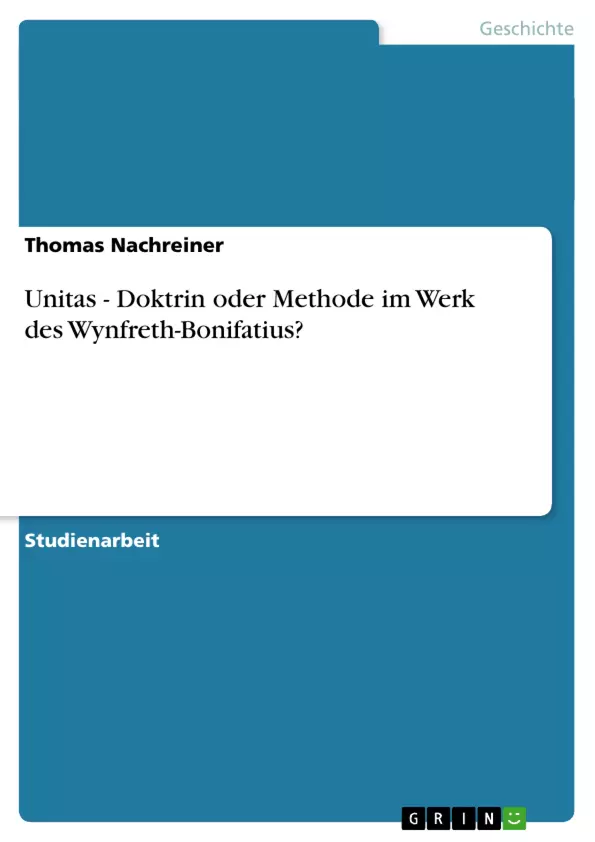Mit der Salbung des Frankenkönigs Pippin durch Papst Stephan II. in St. Denis am 28. Juli 754 fand eine Entwicklung von historischer Tragweite ihre formale Vollendung. Während das Frankenreich von nun an Verantwortung für die römische Kirche übernahm, hatte das Papsttum die Loslösung von Byzanz vollzogen und sich nach Westen gewandt. Diese für das europäische Christentum prägende Entwicklung war allerdings kein zwangsläufiger Prozess, sondern zu einem großen Teil das Werk einzelner herausragender Persönlichkeiten, die in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts den Kampf gegen die erstarrten Verhältnisse in der fränkischen Kirche aufnahmen. Besondere Bedeutung erlangte hierbei die von Angelsachsen ausgehende Missionsbewegung als Bindeglied zwischen fränkischen Herrschern und Papsttum. Ihr wohl berühmtester und einflussreichster Vertreter war der angelsächsische Priester Wynfreth, der unter dem Heiligennamen Bonifatius zum Missionar Germaniens werden und als Reformer der fränkischen Kirche in die Geschichte eingehen sollte. Zuerst als Missionar, dann als Bischof und Erzbischof war er der unbeirrbare Verfechter der kirchlichen Einheit unter der Führung Roms. In einer Zeit, als der römische Primat für die fränkische Kirche keinerlei Verbindlichkeit besaß, war Bonifatius der Mann, der dem Führungsanspruch des Papsttums nachdrücklich zu neuer Geltung verhalf.
Im Folgenden soll nun die Romorientierung des Bonifatius untersucht werden. Hierfür scheint es dienlich, zunächst die Ursachen als auch die Entstehung dieser Bindung zu skizzieren, um anschließend ihre Entwicklung und eventuellen Veränderungen zu analysieren. Dies kann nicht ohne die Berücksichtigung von politischen, missionspraktischen und auch persönlichen Faktoren geschehen, doch der zentrale Aspekt der Fragestellung ist die Rolle der Beziehungen zu Rom im Werk des Bonifatius, nachvollzogen anhand seiner klerikalen Karriere und seinen Schaffensphasen. Die Darstellung soll dabei die Innenwelt des Missionars mit dem Praxisbezug und der Auswirkung seiner Korrespondenz mit Rom verknüpfen In der Konsequenz führt dies zu der Frage: War die Idee der Unitas für Bonifatius die unabänderliche Doktrin, auf der er sein Schaffen aufbaute, oder mehr als das, seine Methode in der Missions- und Reformpraxis?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Unitas - Doktrin oder Methode im Werk des Wynfreth-Bonifatius?
- Wynfreth – Ein Kind der angelsächsischen Kirche
- Lehrjahre – Beginn der Peregrinatio und erster Kontakt mit Rom
- Friesland
- Ernennung in Rom
- Gehversuche
- Mission - Das Werk des Bischofs in Hessen und Thüringen
- Bischofsweihe in Rom
- Mission in Hessen und Thüringen
- Stillstand und Sammlung
- Verleihung des Palliums
- Romreise 737
- Reform - Höhepunkt und Niedergang
- Reform in Bayern, Hessen und Thüringen
- Reformsynoden
- Die Grenzen der päpstlichen Autorität
- Rückzug aus der Kirchenpolitik
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Romorientierung des Bonifatius und untersucht die Entstehung und Entwicklung seiner Bindung zu Rom. Dabei werden politische, missionspraktische und persönliche Faktoren berücksichtigt. Der zentrale Aspekt ist die Rolle der Beziehungen zu Rom im Werk des Bonifatius, analysiert anhand seiner klerikalen Karriere und seinen Schaffensphasen.
- Die Prägung des Bonifatius durch die angelsächsische Kirche
- Die Bedeutung der Peregrinatio für die Missionsarbeit des Bonifatius
- Die Rolle des Papsttums in der fränkischen Kirche im 8. Jahrhundert
- Die Auswirkungen der Beziehungen zu Rom auf das Werk des Bonifatius
- Die Frage, ob die Unitas für Bonifatius eine Doktrin oder eine Methode war
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2.1: Dieses Kapitel beleuchtet die Prägung des Wynfreth-Bonifatius durch die angelsächsische Kirche. Es wird dargestellt, wie die Kirche seiner Heimat, durch die Synoden von Whitby und Hertford, eine starke Romorientierung entwickelte. Dies beeinflusste das Bewusstsein des Bonifatius und prägte seine Vorstellung von einer einheitlichen Kirchenstruktur.
- Kapitel 2.2: Der zweite Abschnitt behandelt die Lehrjahre und den ersten Kontakt des Bonifatius mit Rom. Zuerst widmet er sich seiner Missionsarbeit in Friesland, die jedoch schwierig verläuft. Anschließend beschreibt das Kapitel seine Ernennung in Rom und die damit verbundenen Gehversuche.
- Kapitel 2.3: In diesem Kapitel wird die Missionsarbeit des Bonifatius in Hessen und Thüringen beleuchtet. Die Bischofsweihe in Rom wird als ein bedeutender Schritt auf seinem Weg beschrieben. Die Ausführungen zeigen die Herausforderungen und Erfolge seiner Mission in diesen Regionen.
- Kapitel 2.4: Das Kapitel schildert eine Phase des Stillstands und der Sammlung in der Arbeit des Bonifatius. Es wird die Verleihung des Palliums und die Romreise des Bonifatius im Jahr 737 behandelt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Wynfreth-Bonifatius, Unitas, Romorientierung, Angelsächsische Kirche, Missionsarbeit, Päpstliche Autorität, Reform, Fränkische Kirche, Peregrinatio, Heilsbedeutung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Wynfreth-Bonifatius?
Wynfreth, bekannt als Bonifatius, war ein angelsächsischer Priester, der als Missionar Germaniens und Reformer der fränkischen Kirche im 8. Jahrhundert berühmt wurde.
Was bedeutet der Begriff „Unitas“ im Kontext von Bonifatius?
„Unitas“ steht für die kirchliche Einheit unter der Führung Roms, für die sich Bonifatius zeit seines Lebens als Missionar und Erzbischof einsetzte.
Warum war die Romorientierung des Bonifatius so bedeutend?
In einer Zeit, in der der römische Primat für die fränkische Kirche kaum Verbindlichkeit hatte, verhalf Bonifatius dem Führungsanspruch des Papstes zu neuer Geltung.
Welche Rolle spielte die angelsächsische Kirche für seinen Werdegang?
Seine Heimatkirche war bereits stark römisch orientiert, was sein Bewusstsein für eine einheitliche Kirchenstruktur und seine spätere Missionsarbeit maßgeblich prägte.
War die Idee der Unitas für Bonifatius eine Doktrin oder eine Methode?
Diese zentrale Frage der Arbeit untersucht, ob die Einheit mit Rom für ihn ein unumstößlicher Glaubenssatz (Doktrin) oder ein strategisches Mittel (Methode) für seine Reformen war.
Wo lagen die Schwerpunkte seiner Missionsarbeit?
Seine wichtigsten Wirkungsstätten waren Friesland, Hessen, Thüringen und Bayern.
- Citation du texte
- Thomas Nachreiner (Auteur), 2005, Unitas - Doktrin oder Methode im Werk des Wynfreth-Bonifatius?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44427