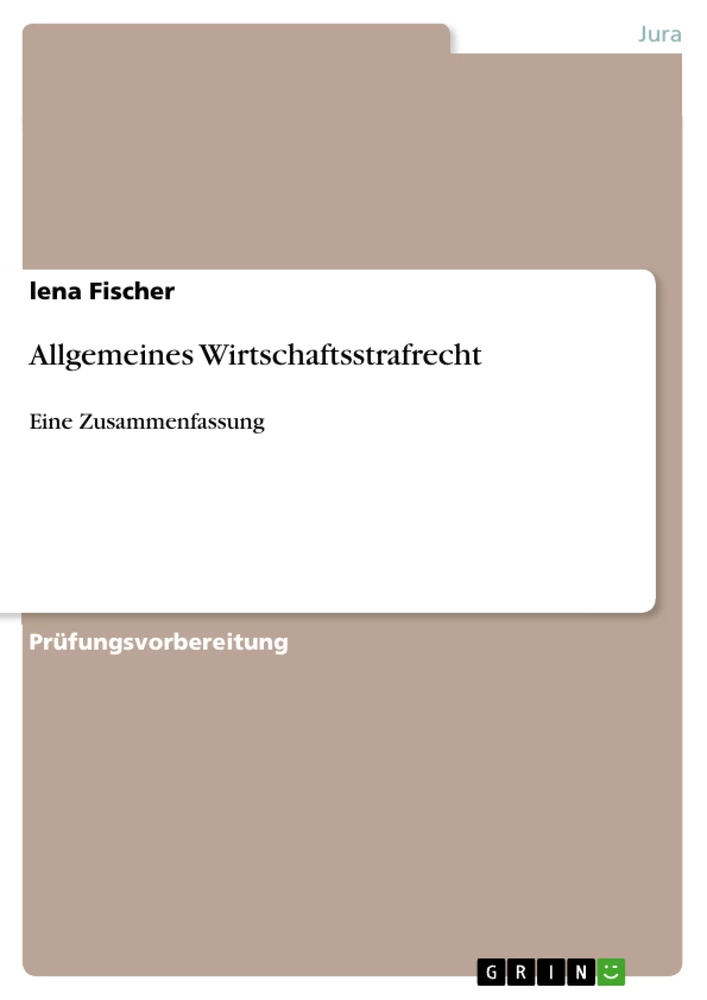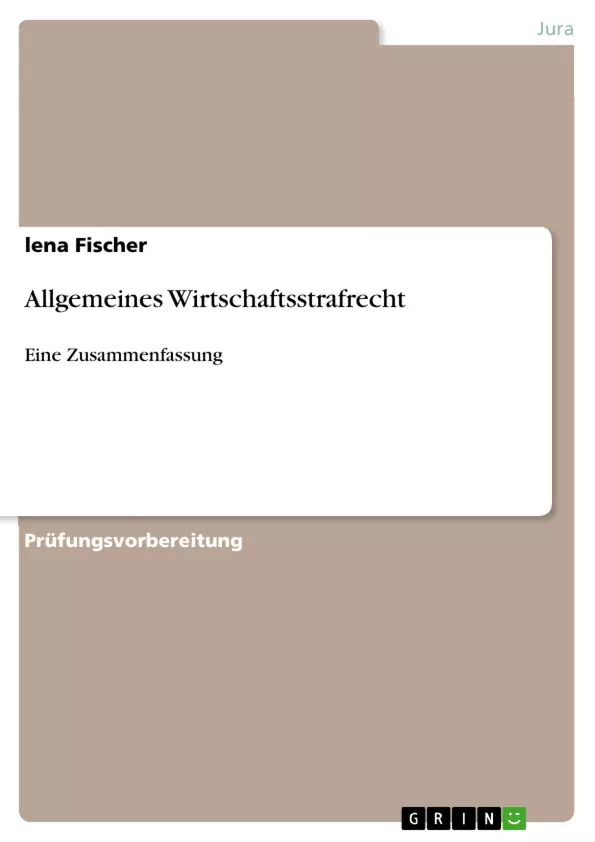Diese Arbeit stellt eine Zusammenfassung über das Allgemeine Wirtschaftsstrafrecht dar und ist hilfreich für eine Klausurvorbereitung.
Aus dem Inhalt:
- Vollendeter vorsätzlicher Delikt;
- Fahrlässigkeitsdelikt;
- Anstiftung;
- Beihilfe;
- Versuch;
Inhaltsverzeichnis
- I. Vollendeter vorsätzlicher Delikt
- Tatbestand
- Subjektiver TB
- Objektive Bedingungen der Strafbarkeit
- II. Fahrlässigkeitsdelikt
- Tatbestand
- Rechtswidrigkeit
- Schuld
- III. Anstiftung §26
- Tatbestand
- Subjektiver TB
- IV. Beihilfe §27
- Tatbestand
- Subjektiver TB
- V. Versuch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Dokument bietet einen Überblick über die strafrechtlichen Aspekte vollendeter vorsätzlicher Delikte, fahrlässiger Delikte, Anstiftung, Beihilfe und Versuch. Es beschreibt die jeweiligen Tatbestände, die subjektiven und objektiven Bedingungen der Strafbarkeit sowie die Abgrenzung zwischen verschiedenen Formen des Vorsatzes und der Fahrlässigkeit.
- Vorsatz und Fahrlässigkeit
- Tatbestandselemente und ihre Bedeutung
- Objektive und subjektive Zurechenbarkeit
- Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme
- Versuchsstrafrecht
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vollendeter vorsätzlicher Delikt: Dieses Kapitel behandelt den vollständigen Tatbestand eines vorsätzlichen Delikts. Es analysiert detailliert den objektiven Tatbestand, einschließlich des Tatobjekts, der Tathandlung (mit Kausalität und objektiver Zurechnung), des Tatsubjekts und des Taterfolgs. Besonderes Augenmerk liegt auf der Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme anhand der Tatherrschaftslehre und der subjektiven Theorie. Der subjektive Tatbestand wird anhand der verschiedenen Vorsatzformen (dolus directus I und II, dolus eventualis) erläutert und von der bewussten Fahrlässigkeit abgegrenzt. Schließlich werden die objektiven Bedingungen der Strafbarkeit – Rechtswidrigkeit und Schuld – diskutiert, einschließlich des Unrechtsbewusstseins und des Verbotsirrtums. Der Einfluss von Einverständnis auf die Tatbestandsmäßigkeit wird ebenfalls beleuchtet.
II. Fahrlässigkeitsdelikt: Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel konzentriert sich dieser Abschnitt auf fahrlässige Delikte. Er beschreibt die Unterscheidung zwischen unbewusster und bewusster Fahrlässigkeit und betont das leichtfertige Handeln als besonders schwere Form der Fahrlässigkeit. Der objektive Tatbestand wird hier im Kontext der objektiven Sorgfaltspflichtverletzung und der objektiven Zurechenbarkeit detailliert behandelt, wobei die Frage der objektiven Vorhersehbarkeit des Erfolgs im Mittelpunkt steht. Die Rechtswidrigkeit und Schuld werden analog zum vorsätzlichen Delikt erörtert, wobei die Verletzung der subjektiven Sorgfaltspflicht und die Vorhersehbarkeit des Kausalverlaufs besondere Beachtung finden.
III. Anstiftung §26: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Delikt der Anstiftung gemäß §26. Der Fokus liegt auf dem objektiven Tatbestand, der eine vorsätzlich rechtswidrige Haupttat und die Bestimmung des Täters durch den Anstifter erfordert. Der subjektive Tatbestand wird sowohl für den Täter als auch für den Anstifter erläutert, wobei der erforderliche Vorsatz im Detail beschrieben wird. Der Unterschied zwischen Anstiftung und Beihilfe wird implizit durch den Vergleich der jeweiligen Tatbestände deutlich.
IV. Beihilfe §27: Ähnlich wie bei der Anstiftung wird hier das Delikt der Beihilfe gemäß §27 behandelt. Der objektive Tatbestand umfasst eine vorsätzlich rechtswidrige Haupttat und die Hilfeleistung bei deren Ausführung. Die Hilfeleistung kann sowohl physischer als auch psychischer Natur sein. Der subjektive Tatbestand betont den „Hilfeleisten“-Vorsatz, der mindestens bedingten Vorsatz erfordert. Im Vergleich zum vorherigen Kapitel wird die unterschiedliche Beteiligung an der Straftat deutlich.
V. Versuch: Das Kapitel widmet sich dem Versuchsstrafrecht. Es erläutert die Vorprüfung, die prüft, ob eine Vollendung der Tat vorliegt, und den Versuch als eigenständige Strafbarkeit. Die zentralen Elemente des Versuchs, nämlich der Tatentschluss und das unmittelbare Ansetzen, werden umfassend analysiert. Der Tatentschluss, der i.d.R. bedingten Vorsatz benötigt, wird dabei im Zusammenhang mit §16 (1) diskutiert. Die Definition des unmittelbaren Ansetzens wird präzise erklärt, wobei die subjektive und objektive Komponente des „Jetzt geht es los“-Moments im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Vorsätzliches Delikt, Fahrlässigkeitsdelikt, Anstiftung, Beihilfe, Versuch, Tatbestand, subjektiver Tatbestand, objektiver Tatbestand, Kausalität, objektive Zurechnung, Vorsatz, Fahrlässigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld, dolus directus, dolus eventualis, Tatherrschaftslehre, Unrechtsbewusstsein, Verbotsirrtum, Sorgfaltspflichtverletzung.
Häufig gestellte Fragen zum Strafrechtlichen Überblick
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene strafrechtliche Aspekte. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel zu vollendeten vorsätzlichen Delikten, fahrlässigen Delikten, Anstiftung (§26), Beihilfe (§27) und Versuch, sowie eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Delikte werden behandelt?
Das Dokument behandelt vollendete vorsätzliche Delikte, fahrlässige Delikte, Anstiftung (§26), Beihilfe (§27) und den Versuch. Es analysiert jeweils den objektiven und subjektiven Tatbestand, die Rechtswidrigkeit und Schuld.
Was sind die Themenschwerpunkte?
Die Schwerpunkte liegen auf der Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit, der Analyse der Tatbestandselemente, der objektiven und subjektiven Zurechnung, der Unterscheidung von Täterschaft und Teilnahme sowie dem Versuchsstrafrecht.
Wie wird der vorsätzliche Delikt behandelt?
Der vollendete vorsätzliche Delikt wird detailliert analysiert, einschließlich des objektiven Tatbestands (Tatobjekt, Tathandlung mit Kausalität und objektiver Zurechnung, Tatsubjekt, Taterfolg), des subjektiven Tatbestands (verschiedene Vorsatzformen: dolus directus I und II, dolus eventualis) und der objektiven Bedingungen der Strafbarkeit (Rechtswidrigkeit und Schuld). Die Abgrenzung zur Täterschaft und Teilnahme wird anhand der Tatherrschaftslehre und der subjektiven Theorie erläutert.
Wie wird der fahrlässige Delikt behandelt?
Der fahrlässige Delikt wird im Vergleich zum vorsätzlichen Delikt behandelt. Die Unterscheidung zwischen unbewusster und bewusster Fahrlässigkeit wird erläutert, ebenso wie der objektive Tatbestand im Kontext der objektiven Sorgfaltspflichtverletzung und der objektiven Zurechenbarkeit. Die Rechtswidrigkeit und Schuld werden analog zum vorsätzlichen Delikt erörtert.
Wie werden Anstiftung und Beihilfe behandelt?
Die Kapitel zu Anstiftung (§26) und Beihilfe (§27) analysieren die jeweiligen Tatbestände, sowohl den objektiven als auch den subjektiven. Der Fokus liegt auf den Anforderungen an den Vorsatz des Täters und des Beteiligten (Anstifter bzw. Gehilfe) und die Abgrenzung der beiden Delikte zueinander.
Wie wird der Versuch behandelt?
Das Kapitel zum Versuch behandelt die Vorprüfung auf Vollendung, den Tatentschluss und das unmittelbare Ansetzen als zentrale Elemente des Versuchs. Der Tatentschluss wird im Zusammenhang mit §16 (1) diskutiert und die Definition des unmittelbaren Ansetzens wird präzise erklärt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter umfassen: Vorsätzliches Delikt, Fahrlässigkeitsdelikt, Anstiftung, Beihilfe, Versuch, Tatbestand, subjektiver Tatbestand, objektiver Tatbestand, Kausalität, objektive Zurechnung, Vorsatz, Fahrlässigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld, dolus directus, dolus eventualis, Tatherrschaftslehre, Unrechtsbewusstsein, Verbotsirrtum und Sorgfaltspflichtverletzung.
- Arbeit zitieren
- lena Fischer (Autor:in), 2018, Allgemeines Wirtschaftsstrafrecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444279