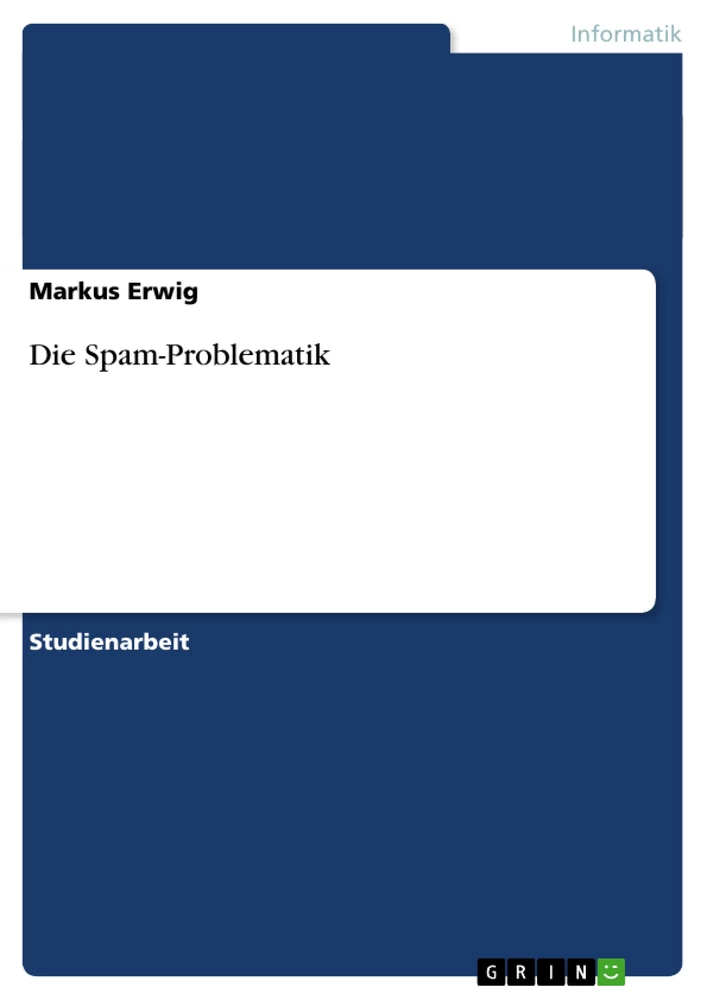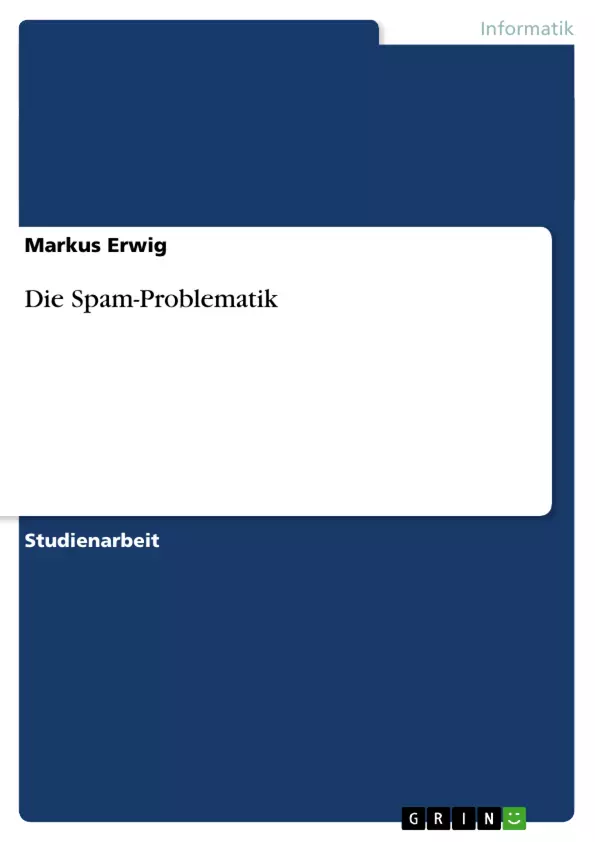Die erste E-Mail wurde vor etwa 20 Jahren über ein globales Netzwerk versendet. Heutzutage nutzen in Deutschland nach einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes über 30 Millionen Menschen mit steigender Tendenz dieses Kommunikationsmittel. Der hohe Nutzungsgrad und die damit verbundene Akzeptanz ist durch den schnellen, einfachen und kostengünstigen Übertragungsweg begründet. Durch die stetige Weiterentwicklung des E -Trends (E-Commerce, E-Goverment, E-Procurement, etc.) wächst auch die Anzahl wichtiger E-Mails mit geschäftlichem Hintergrund. Somit ist es mittlerweile selbstverständlich, dass über E -Mail z. B. ein Versandhändler die eingegangenen Aufträge beim Kunden bestätigt, ein Provider den Kunden über AGB Änderungen informiert oder ein Leser einer Zeitschrift ein Abonnement beim Verlag kündigt.
Seit einiger Zeit wird diese Kommunikationsplattform jedoch zunehmend in Bezug auf negative Auswirkungen und Probleme, negativ öffentlich zur Diskussion gebracht. Der Grund für diese Tatsache ist der immer stärker werdende kommerzielle Missbrauch von E-Mail durch das massenweise Versenden von unerwünschten E-Mails. Diese lästigen und ungebeten erhaltenen E-Mails werden als „Spam“ bezeichnet. Kaum ein E-Mail Anwender ist heutzutage davor gefeit, ein „Spam-Opfer“ zu werden. Mittlerweile sind mehr als die Hälfte aller durch das Internet versendeten Nachrichten als Spam einzustufen. Diese Flut an unerwünschten Informationen löst beim Anwender nicht nur Ärgernis aufgrund der Belästigung aus, sondern es können auch wichtige Mails in dieser Masse verloren gehen, da sie schlichtweg falsch gefiltert oder übersehen werden. Im Extremfall kann auch die Mailbox des Empfängers voll laufen, sodass gar keine weitere Mail mehr zugestellt werden kann.
Diese Spam-Problematik ist mittlerweile Inhalt einer Vielzahl von Gesetzen und erfordert regelmäßig die Entwicklung neuer technischer Maßnahmen. Durch die internationale Dimension greifen gesetzliche Verbote auf nationaler Ebene leider wenig. Diese Hausarbeit soll einen Überblick über das umfangreiche Thema der Spam-Problematik geben. In Kapitel 2 wird der Begriff definiert und es wird erläutert, welche wirtschaftlichen Auswirkungen diese Form der Informationsflut hat. Das Kapitel 3 beinhaltet die rechtlichen Hintergründe und die Durchsetzbarkeit der verabschiedeten Regelungen und Gesetze. Die möglichen Gegenmaßnahmen werden im Kapitel 4 behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Spam
- Spam-Arten
- Methoden der Spammer
- Wie Opfer zu Spammer werden
- Gründe von Spamming
- Wirtschaftlicher Schaden
- Rücklauf Problematik
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Gesetzesgrundlagen
- Internationale Regelungen
- Praktische Durchsetzung
- Gegenmaßnahmen
- Was kann der Anwender gegen Spam unternehmen?
- Was kann ein Internet-Service-Provider tun?
- Relay Blocking Lists
- Content Filtering
- Greylisting
- Frequenzanalyse
- Was kann ein Mail-Administrator in einem Unternehmen tun?
- Methoden der zentralen Spamfilter
- Vorgehensweise zur effizienten Spam-Abwehr
- Spezialfilter: CORE
- Absender Authentifizierung
- Fazit und Ausblick
- Quellen
- Internet-Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit soll einen umfassenden Überblick über die Spam-Problematik bieten. Sie befasst sich mit der Definition von Spam, analysiert die verschiedenen Spam-Arten und die Methoden der Spammer, beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und die möglichen Gegenmaßnahmen sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen von Spam. Der Fokus liegt auf der Darstellung der verschiedenen Maßnahmen, die von Anwendern, Internet-Service-Providern und Mail-Administratoren ergriffen werden können, um Spam zu bekämpfen.
- Definition und Arten von Spam
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Spam
- Wirtschaftliche Auswirkungen von Spam
- Technische und organisatorische Maßnahmen gegen Spam
- Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Kampf gegen Spam
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Spam ein und beschreibt die wachsende Bedeutung von E-Mail im digitalen Alltag sowie die negative Entwicklung durch Spam. Kapitel 2 definiert den Begriff Spam und beleuchtet verschiedene Spam-Arten sowie die Methoden der Spammer. Es wird auch auf die Entstehung von Spam durch „Opfer“ und die wirtschaftlichen Auswirkungen eingegangen. Kapitel 3 behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen für Spam und analysiert die Durchsetzbarkeit der relevanten Gesetze. Kapitel 4 konzentriert sich auf Gegenmaßnahmen gegen Spam, wobei verschiedene Möglichkeiten für Anwender, Internet-Service-Provider und Mail-Administratoren aufgezeigt werden. Dieses Kapitel analysiert auch die technischen Maßnahmen wie Content Filtering und Greylisting. Das Kapitel 5 fasst die Kernaussagen der Arbeit zusammen und beurteilt kritisch die Wirksamkeit der beschriebenen Maßnahmen. Es gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Kampf gegen Spam.
Schlüsselwörter
Spam, E-Mail, Internet, Datenschutz, Recht, Wirtschaft, Gegenmaßnahmen, Content Filtering, Greylisting, Relay Blocking Lists, Absender Authentifizierung, UCE, UBE.
- Quote paper
- Markus Erwig (Author), 2005, Die Spam-Problematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44438