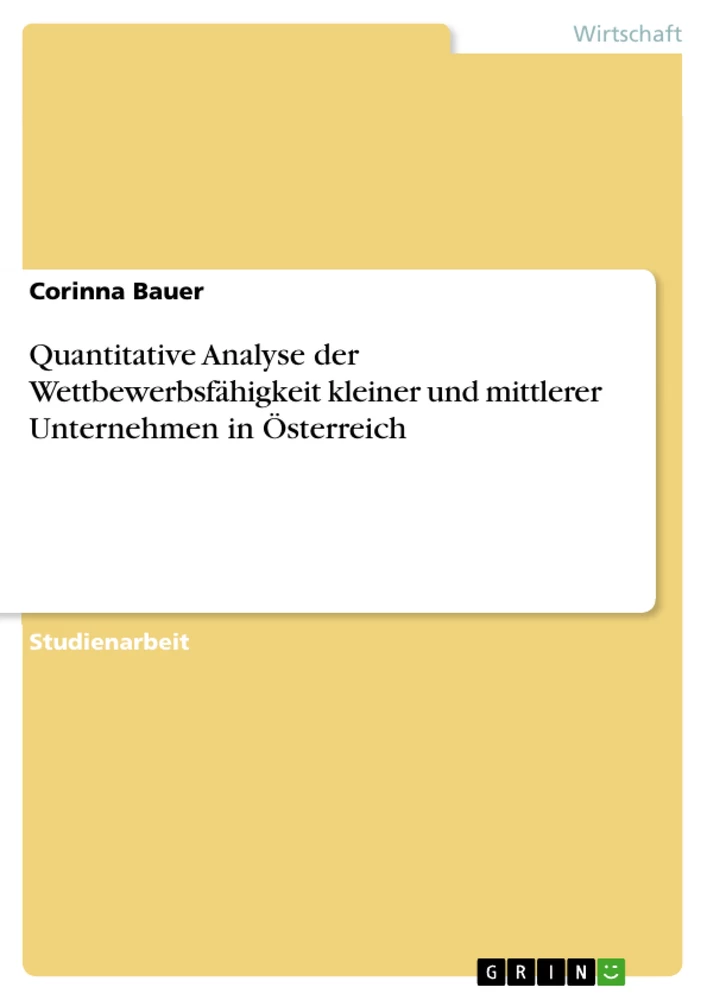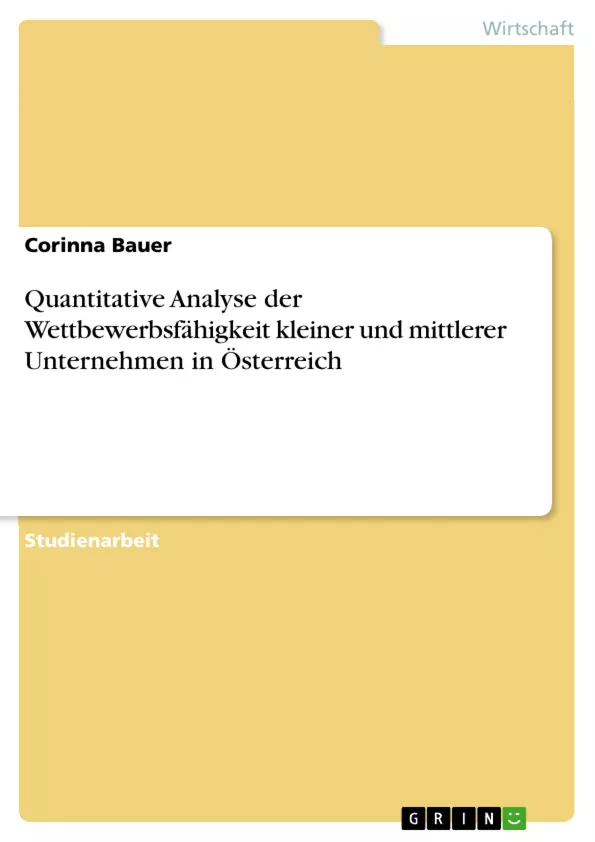Im Zuge dieser Arbeit soll die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich anhand quantitativer Analysen untersucht und interpretiert werden. Als Basis dafür wird eine schriftliche Befragung der IMAD GmbH aus dem Jahr 2005 zum Thema Wettbewerbsfähigkeit herangezogen. Mithilfe eines Fragebogens wurden die Daten von 500 Geschäftsführern von kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich erhoben. Im theoretischen Teil dieser Arbeit wird dargestellt, was unter kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) verstanden wird und welche Bedeutung die KMU für die österreichische Wirtschaft haben. In Kapitel 3 erfolgt eine Datenanalyse, die in die deskriptive Analyse, inferenzstatistische Untersuchungen, Untersuchung interner Konsistenz sowie explorative Faktorenanalyse zu der Wettbewerbsfähigkeit aufgrund interner Funktionen unterteilt ist. Im Rahmen der deskriptiven Analyse wird die Struktur der Stichproben in Bezug auf unterschiedliche Variablen verdeutlicht. Neben der Branchen, Länder oder Betriebsgrößenklassenverteilung wird auch die Entwicklung des Unternehmens in Hinblick auf Umsatz, Gewinn und Marktanteil interpretiert und bewertet. Darüber hinaus wird die subjektive Bewertung der Geschäftsführer zu den wettbewerbsrelevanten Herausforderungen analysiert. Dabei wird explizit auf die wichtigsten und weniger wichtig angesehenen Herausforderungen eingegangen. Ebenso wird eine Auswertung zur Einschätzung der Geschäftsführer der Wettbewerbsfähigkeit aufgrund interner Funktionen sowie unternehmensspezifischer Kompetenzen durchgeführt. Bei dieser Betrachtung werden besonders die wichtigsten Funktionen beziehungsweise Faktoren erläutert. Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spielen in der Europäischen Wirtschaft eine zentrale Rolle. Rund 99% aller Unternehmen in der Europäischen Union zählen zu den KMU. Diese tragen wesentlich zur Entstehung von Arbeitsplätzen bei, fördern den Unternehmergeist und die Innovationsfähigkeit und leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. Dennoch verfügen sie im Vergleich zu Großunternehmen über einen bedeutend geringeren Markteinfluss und sind außerhalb ihres Standortes und Kundenkreises oftmals kaum bekannt. So ergeben sich insbesondere in der Gründungsphase oft Probleme beim Zugang zu Kapital und Krediten. Durch die begrenzten Ressourcen wird der Zugang zu Technologie und Innovationen ebenfalls erschwert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von kleinen und mittleren Unternehmen
- Zielsetzung und Vorgehen
- Kleine und mittlere Unternehmen in Österreich
- Definition und Abgrenzung von KMU
- Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen
- Datenanalyse
- Deskriptive Analyse
- Verteilung nach Branchen, Bundesländern und Betriebsgrößenklassen
- Darstellung der Unternehmensentwicklung
- Darstellung der Herausforderungen und der Wettbewerbsfähigkeit
- Inferenzstatistische Untersuchungen
- Prüfung auf Normalverteilung
- Einfluss der geographischen Lage auf den Unternehmenserfolg
- Erfahrung mit aktuellen Managementkonzepten
- Bedeutung unternehmensspezifischer Kompetenzen
- Untersuchung der internen Konsistenz
- Explorative Faktorenanalyse
- Diskussion und Fazit
- Ergebnisse der Arbeit und kritische Reflexion
- Praktische Relevanz der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Analyse der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Österreich. Sie untersucht, welche Herausforderungen KMU in Österreich bewältigen müssen und welche Faktoren ihren Erfolg beeinflussen. Dabei wird die Rolle von unternehmensspezifischen Kompetenzen und die Bedeutung von aktuellen Managementkonzepten beleuchtet. Die Analyse basiert auf einer schriftlichen Befragung von 500 Geschäftsführern von KMU in Österreich, die im Jahr 2005 durchgeführt wurde.
- Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von KMU in Österreich
- Die Herausforderungen, denen KMU in Österreich gegenüberstehen
- Die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit von KMU in Österreich anhand quantitativer Daten
- Die Relevanz von unternehmensspezifischen Kompetenzen und Managementkonzepten für den Unternehmenserfolg
- Die praktische Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse für KMU in Österreich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von KMU in Österreich heraus und definiert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 widmet sich der Definition von KMU und den Herausforderungen, die KMU in Österreich bewältigen müssen. Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse der quantitativen Datenanalyse, die sich in drei Abschnitte unterteilt: Die deskriptive Analyse beleuchtet die Struktur der Stichprobe und die Unternehmensentwicklung. Die inferenzstatistischen Untersuchungen untersuchen den Einfluss von geographischer Lage, Managementkompetenzen und unternehmensspezifischen Kompetenzen auf den Unternehmenserfolg. Abschließend wird die interne Konsistenz der Befragungsergebnisse und die explorative Faktorenanalyse der Daten zu Wettbewerbsfähigkeit aufgrund interner Funktionen dargestellt. Der Diskussionsteil (Kapitel 4) reflektiert die Ergebnisse der Arbeit und deren praktische Relevanz für KMU in Österreich.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit der quantitativen Analyse der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Österreich. Wichtige Schlüsselwörter sind: KMU, Wettbewerbsfähigkeit, Unternehmenserfolg, Herausforderungen, Managementkonzepte, unternehmensspezifische Kompetenzen, Datenanalyse, deskriptive Statistik, inferenzstatistische Analyse, Faktorenanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung haben KMU für die österreichische Wirtschaft?
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) machen rund 99 % aller Unternehmen aus. Sie sind wesentliche Treiber für Arbeitsplätze, Innovation und den Unternehmergeist.
Was sind die größten Herausforderungen für KMU in Österreich?
KMU kämpfen oft mit begrenztem Zugang zu Kapital und Krediten, erschwertem Zugang zu neuen Technologien und einem geringeren Markteinfluss im Vergleich zu Großkonzernen.
Wie bewerten Geschäftsführer ihre Wettbewerbsfähigkeit?
Die Bewertung basiert oft auf internen Funktionen und unternehmensspezifischen Kompetenzen. Subjektiv sehen viele Geschäftsführer die Innovationsfähigkeit als zentralen Faktor.
Welchen Einfluss hat die geographische Lage auf den Unternehmenserfolg?
Inferenzstatistische Untersuchungen zeigen, dass der Standort Auswirkungen auf den Kundenzugang und die Ressourcenverfügbarkeit hat, was die Wettbewerbsfähigkeit direkt beeinflusst.
Was ist eine explorative Faktorenanalyse im KMU-Kontext?
Diese statistische Methode wird genutzt, um aus einer Vielzahl von Variablen (z. B. Umsatz, Gewinn, Marktanteil) die wesentlichen Erfolgsfaktoren der Wettbewerbsfähigkeit zu identifizieren.
- Quote paper
- Corinna Bauer (Author), 2017, Quantitative Analyse der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen in Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444428