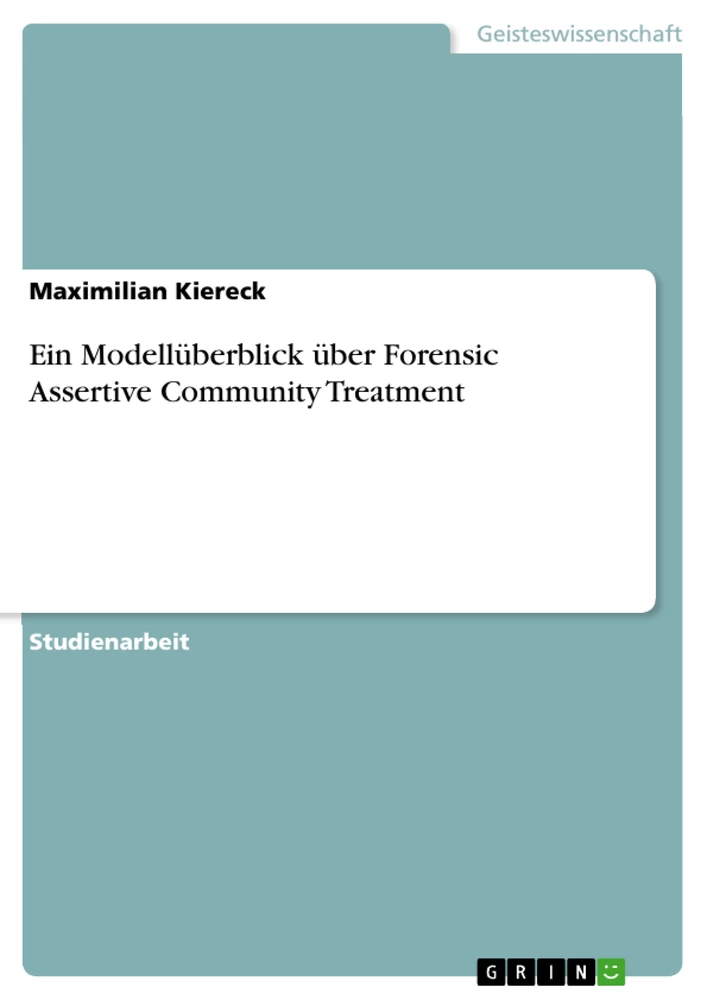In der deutschsprachigen Versorgungslandschaft sind bislang nur wenige Konzepte zur Behandlung ehemalig forensischer Patienten vorhanden. Die Gemeindepsychiatrie steht einerseits vor der Herausforderung, die politischen und gesellschaftlichen Erwartungen zu erfüllen, dass keine weitere Gefahr von den Klienten ausgeht. Andererseits kollidiert ein sozialpsychiatrisches Selbstverständnis mit dem klinischinstitutionellen, oder nach Goffmann totalen Charakter des Maßregelvollzugs. In der deutschsprachigen Literatur finden sich keine Hinweise darauf, dass eine stationäre Behandlung inklusive der damit einhergehenden Entortung aus dem sozialen Umfeld des Betroffenen im besonderen Maße wirksamer ist als eine ambulante Behandlung. Es stellt sich die Frage, wie zukunftsfähig das bislang gelebte Modell der klinischen Sicherung und Besserung ist. Entlassungen aufgrund nichtmehr gegebener Verhältnismäßigkeit und der zunehmend relevanter werdende Aspekt der Verlagerung psychiatrischer Versorgungsstrukturen in die Lebenswirklichkeit von Betroffenen lassen erahnen, dass eine Verständigung zwischen der Gemeindepsychiatrie und der institutionellen Psychiatrie von hohem Stellenwert ist. Die Zugänglichkeit ambulanter psychosozialer Behandlungen ist bisweilen nicht ausreichend gewährleistet, betrachtet man diese im Verhältnis zur Jahres und Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen in der Gesamtbevölkerung. Wenn es für Menschen mit einem normalen bis hohen Funktionsniveau problematisch ist, entsprechende Versorgungsleistungen zu erhalten, ist es für Menschen mit mittleren bis schweren psychischen Störungen voraussichtlich kaum zu bewältigen. Zu betrachten ist auch, dass die Bereitschaft allgemeinpsychiatrischer Dienste sowie durch niedergelassene Ärzte eine Behandlung mit forensischen Patienten zu beginnen gilt als niedrig beschrieben werden kann. Mit dem Modell des Forensic Assertive Community Treatments soll dem Problem Sorge getragen werden und eine zukunftsfähige psychiatrische Versorgungslandschaft entstehen. In der vorliegenden Arbeit wird das Assertive Community Treatment in seiner ursprünglichen Form beschrieben und anschließend zur Behandlung forensischer Klienten erweitert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Grundlagen des Assertive Community Treatments
- 2.1 Hintergrund der Intervention
- 2.2 Aufbau der Intervention
- 2.3 Das „Hamburger Modell“
- 3 Forensic Assertive Community Treatment
- 3.1 Unterschiede zum Assertive Community Treatment
- 4 Rolle der psychiatrischen Pflege
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Forensic Assertive Community Treatment (FACT) als zukunftsfähiges Modell der psychiatrischen Versorgung für ehemalige forensische Patienten. Sie zeigt die Herausforderungen der Gemeindepsychiatrie im Umgang mit diesen Patienten auf und stellt das FACT-Modell als Alternative zu traditionellen stationären Behandlungen vor.
- Herausforderungen der Gemeindepsychiatrie im Umgang mit ehemaligen forensischen Patienten
- Das Assertive Community Treatment (ACT) als psychosoziale Intervention für Menschen mit schweren psychischen Störungen
- Das Forensic Assertive Community Treatment (FACT) als spezifische Anwendung des ACT für forensische Patienten
- Die Rolle der psychiatrischen Pflege im Kontext des FACT
- Zukunftsperspektiven für die psychiatrische Versorgung ehemaliger forensischer Patienten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik der Versorgung ehemaliger forensischer Patienten in der deutschsprachigen Landschaft beleuchtet und die Notwendigkeit für ein neues Modell der psychiatrischen Versorgung hervorhebt. Anschließend werden die Grundlagen des Assertive Community Treatment (ACT) vorgestellt, einschließlich seiner Entstehung, seiner Schlüsselprinzipien und seiner Zielsetzung. Das Kapitel erläutert, wie das ACT dazu beitragen kann, die Lebensqualität und die Selbstständigkeit von Menschen mit schweren psychischen Störungen zu verbessern.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Forensic Assertive Community Treatment (FACT), einem spezifischen Modell des ACT, das für die Behandlung von ehemaligen forensischen Patienten entwickelt wurde. Hier werden die Unterschiede zwischen ACT und FACT erläutert und die Besonderheiten der Versorgung dieser Patientengruppe im Vordergrund stehen.
Im vierten Kapitel wird die wichtige Rolle der psychiatrischen Pflege im Kontext des FACT beleuchtet. Es werden die spezifischen Aufgaben und Herausforderungen der psychiatrischen Pflege bei der Versorgung ehemaliger forensischer Patienten im Rahmen des FACT-Modells beschrieben.
Schlüsselwörter
Forensic Assertive Community Treatment, Assertive Community Treatment, Gemeindepsychiatrie, psychiatrische Versorgung, ehemalige forensische Patienten, psychische Störungen, Rehabilitation, Integration, Lebensqualität, Selbstständigkeit, Reintegration.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Forensic Assertive Community Treatment (FACT)?
FACT ist ein Modell der aufsuchenden ambulanten Behandlung für ehemalige Patienten des Maßregelvollzugs, das psychotherapeutische Hilfe mit sozialer Integration und Rückfallprävention kombiniert.
Was ist der Unterschied zwischen ACT und FACT?
Während ACT (Assertive Community Treatment) allgemein für Menschen mit schweren psychischen Störungen gedacht ist, integriert FACT zusätzlich forensische Aspekte wie Kriminalprävention und die Zusammenarbeit mit der Justiz.
Warum wird FACT als zukunftsfähiges Modell angesehen?
Es ermöglicht eine Verlagerung der Versorgung in die Lebenswirklichkeit der Betroffenen und bietet eine Alternative zur oft kritiserten langfristigen stationären Unterbringung.
Welche Rolle spielt die psychiatrische Pflege im FACT?
Die Pflegekräfte arbeiten im FACT-Team direkt im sozialen Umfeld der Klienten, unterstützen bei der Alltagsbewältigung und überwachen den Gesundheitszustand zur Krisenprävention.
Was ist das "Hamburger Modell"?
Das Hamburger Modell ist eine in Deutschland bekannte Umsetzung des ACT-Ansatzes, die als Grundlage für die Weiterentwicklung zu forensischen Modellen dient.
- Quote paper
- BA Maximilian Kiereck (Author), 2017, Ein Modellüberblick über Forensic Assertive Community Treatment, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444437