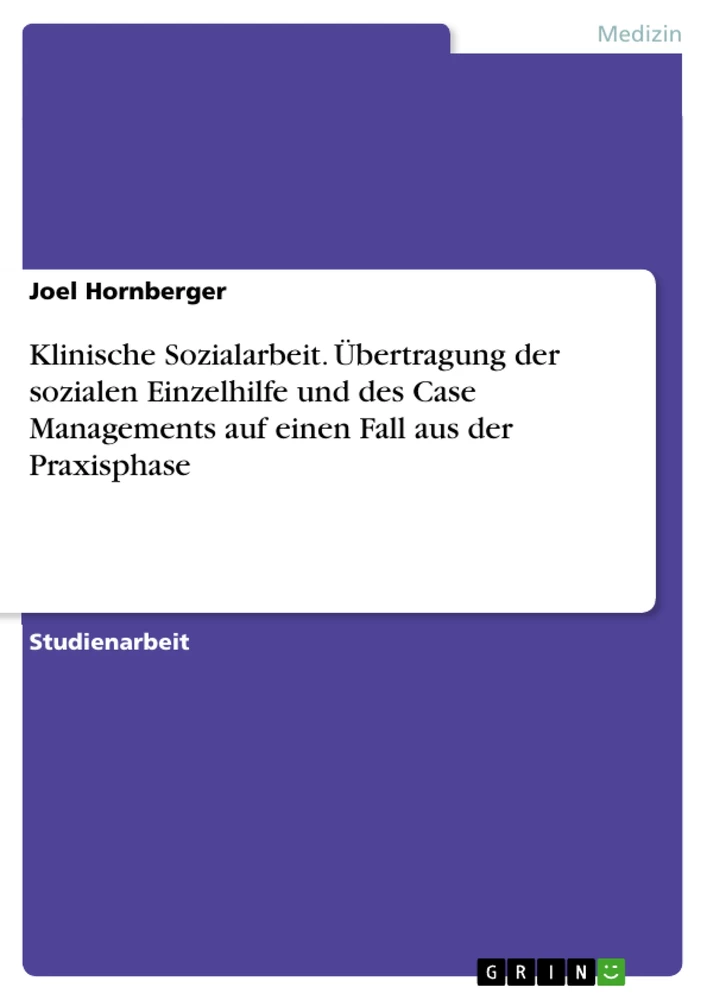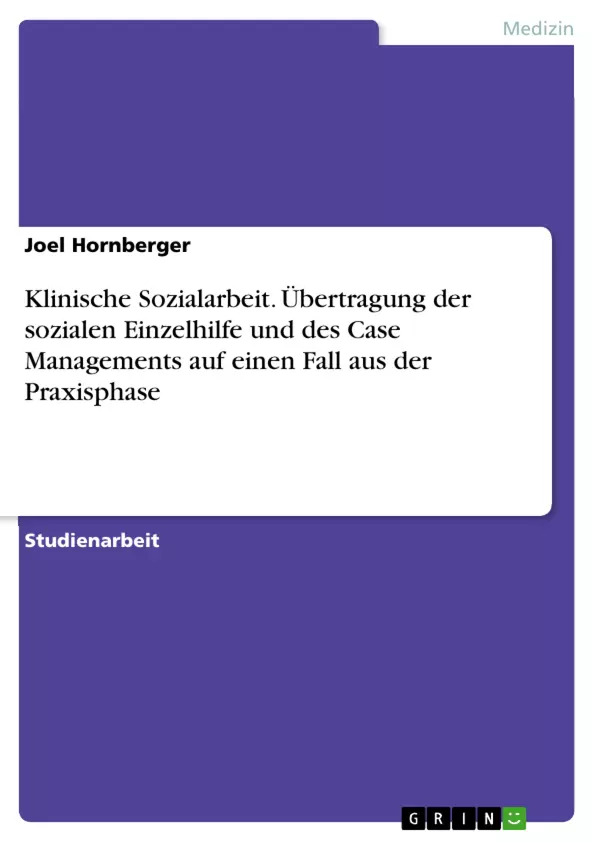Es wird herausgearbeitet, inwieweit soziale Einzelfallhilfe und die Methode des Case Management von klinischen Sozialdienst geleistet bzw. angewendet wird.
Dazu werden die Bereiche Krankenhaussozialarbeit, die soziale Einzelfallhilfe und das Case Management zunächst für sich betrachtet. Anschließend findet eine Diskussion statt in der ein Transfer diskutiert wird. Im Anhang ist das transkripierte Gespräch aus dem Krankenhausalltag angehängt.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zur sozialen Einzelhilfe im Krankenhaus
- Patientenkontakt - Erstgespräch
- Skizzierung des weiteren Hilfevorgangs
- Übertragung des Case Managements
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt die soziale Einzelhilfe im Krankenhaus, insbesondere auf der Urologie-Station. Die Zielsetzung ist es, den Prozess der sozialen Beratung von der Diagnose bis zur Übertragung des Case Managements darzustellen und die verschiedenen beteiligten Akteure und deren Interaktion zu beleuchten.
- Soziale Einzelhilfe im Krankenhauskontext
- Der Prozess der Informationsgewinnung und -bewertung
- Die Rolle der Pflegeanamnese in der interdisziplinären Zusammenarbeit
- Der Einfluss medizinischer Diagnosen auf den Hilfeprozess
- Patientenorientierung und individuelle Bedürfnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Hinführung zur sozialen Einzelhilfe im Krankenhaus: Dieses Kapitel führt in die klinische Sozialberatung im Krankenhaus ein und beschreibt deren Aufgaben im Entlassungsmanagement. Es betont die Bedeutung der sozialen Arbeit im Kontext von Krankheit und Behinderung und die Kombination sozialarbeiterischer Kompetenzen mit medizinischem Wissen. Der individuelle Hilfebedarf wird als zentraler Aspekt hervorgehoben, ebenso wie die Abstimmung der Hilfeplanung mit Patient_innen und Angehörigen. Das Kapitel erläutert das umfassende Beratungsangebot, das psychosoziale, soziale, wirtschaftliche Interventionen, Nachsorge und die Teilhabe am Arbeitsleben umfasst. Die begrenzte Zeit für Beratung während des stationären Aufenthalts und die Zuständigkeiten der Sozialberatung werden ebenfalls thematisiert, ebenso wie der Einfluss medizinischer Diagnosen auf den Hilfeprozess, exemplifiziert am Beispiel von Tumorerkrankungen und deren Auswirkungen auf die Rehabilitation.
Patientenkontakt - Erstgespräch: Dieses Kapitel wird sich voraussichtlich mit dem Ablauf des Erstgesprächs zwischen Sozialarbeiter_in und Patient_in befassen. Es wird vermutlich die Vorbereitung auf das Gespräch, die Informationsgewinnung vor dem Kontakt und die eigentliche Durchführung des Gesprächs detailliert beschreiben. Der Fokus wird wahrscheinlich auf der Etablierung einer vertrauensvollen Beziehung und der gemeinsamen Erarbeitung von Zielen liegen. Die Bedeutung der Anamnese und die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Patient_innen werden wichtige Aspekte sein.
Skizzierung des weiteren Hilfevorgangs: Dieses Kapitel wird voraussichtlich den weiteren Verlauf der sozialen Einzelhilfe nach dem Erstgespräch beschreiben. Es wird wahrscheinlich die verschiedenen Interventionen, die Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften und die kontinuierliche Begleitung der Patient_innen bis zum Entlassungsmanagement detailliert darstellen. Der Fokus wird wahrscheinlich auf der Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Ziele und der Anpassung des Hilfeplans an die sich verändernde Situation der Patient_innen liegen.
Übertragung des Case Managements: Hier wird der Prozess der Übergabe der Betreuung an andere Stellen, wie z.B. ambulante Dienste, beschrieben. Die Sicherstellung einer kontinuierlichen und qualitativ hochwertigen Versorgung nach dem Krankenhausaufenthalt wird hier im Mittelpunkt stehen. Das Kapitel wird vermutlich die verschiedenen Aspekte der Übergabe, die Koordination mit anderen Akteuren und die Begleitung des Übergangs für die Patient_innen detailliert erläutern.
Schlüsselwörter
Soziale Einzelhilfe, Krankenhaus, klinische Sozialberatung, Entlassungsmanagement, Urologie, Patientenorientierung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Pflegeanamnese, medizinische Diagnose, Rehabilitation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sozialen Einzelhilfe im Krankenhaus
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die soziale Einzelhilfe im Krankenhaus, speziell auf einer Urologie-Station. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Prozess der sozialen Beratung von der Diagnose bis zur Übergabe des Case Managements, einschließlich der beteiligten Akteure und deren Interaktion.
Welche Kapitel werden behandelt?
Das Dokument umfasst die Kapitel: "Hinführung zur sozialen Einzelhilfe im Krankenhaus", "Patientenkontakt - Erstgespräch", "Skizzierung des weiteren Hilfevorgangs" und "Übertragung des Case Managements".
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung ist die Darstellung des Prozesses der sozialen Beratung von der Diagnose bis zur Übertragung des Case Managements. Es werden die verschiedenen beteiligten Akteure und deren Interaktion beleuchtet. Im Mittelpunkt steht die soziale Einzelhilfe im Krankenhauskontext, insbesondere auf der Urologie-Station.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen die soziale Einzelhilfe im Krankenhauskontext, den Prozess der Informationsgewinnung und -bewertung, die Rolle der Pflegeanamnese in der interdisziplinären Zusammenarbeit, den Einfluss medizinischer Diagnosen auf den Hilfeprozess, und die Patientenorientierung mit ihren individuellen Bedürfnissen.
Was wird im Kapitel "Hinführung zur sozialen Einzelhilfe im Krankenhaus" behandelt?
Dieses Kapitel führt in die klinische Sozialberatung im Krankenhaus ein, beschreibt deren Aufgaben im Entlassungsmanagement und betont die Bedeutung der sozialen Arbeit im Kontext von Krankheit und Behinderung. Es hebt den individuellen Hilfebedarf, die Abstimmung der Hilfeplanung und das umfassende Beratungsangebot hervor. Die begrenzte Zeit für Beratung und der Einfluss medizinischer Diagnosen (z.B. Tumorerkrankungen) werden ebenfalls thematisiert.
Was wird im Kapitel "Patientenkontakt - Erstgespräch" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt voraussichtlich den Ablauf des Erstgesprächs zwischen Sozialarbeiter_in und Patient_in, einschließlich der Vorbereitung, Informationsgewinnung und Gesprächsführung. Der Fokus liegt auf der Vertrauensbildung, der gemeinsamen Zielerarbeitung und der Berücksichtigung individueller Bedürfnisse.
Was wird im Kapitel "Skizzierung des weiteren Hilfevorgangs" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den weiteren Verlauf der sozialen Einzelhilfe nach dem Erstgespräch, einschließlich der Interventionen, Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften und die Begleitung bis zum Entlassungsmanagement. Die Umsetzung der Ziele und Anpassung des Hilfeplans an die sich verändernde Situation stehen im Mittelpunkt.
Was wird im Kapitel "Übertragung des Case Managements" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der Übergabe der Betreuung an andere Stellen (z.B. ambulante Dienste) und die Sicherstellung einer kontinuierlichen Versorgung nach dem Krankenhausaufenthalt. Die Koordination mit anderen Akteuren und die Begleitung des Übergangs für die Patient_innen werden detailliert erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Soziale Einzelhilfe, Krankenhaus, klinische Sozialberatung, Entlassungsmanagement, Urologie, Patientenorientierung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Pflegeanamnese, medizinische Diagnose, Rehabilitation.
- Quote paper
- Master of Arts Joel Hornberger (Author), 2016, Klinische Sozialarbeit. Übertragung der sozialen Einzelhilfe und des Case Managements auf einen Fall aus der Praxisphase, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444442