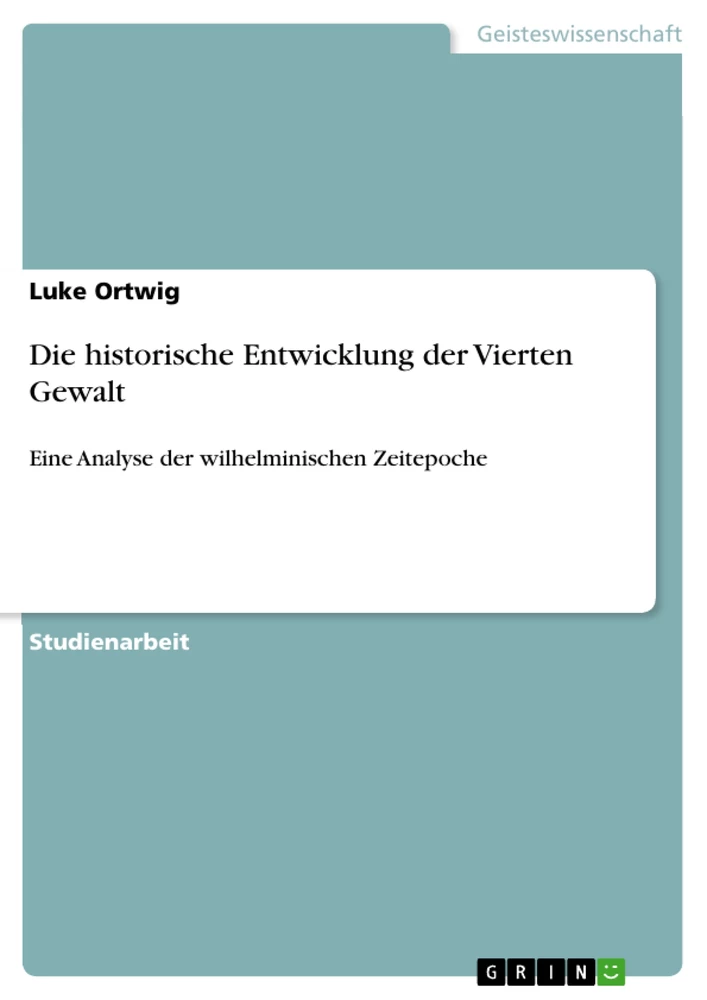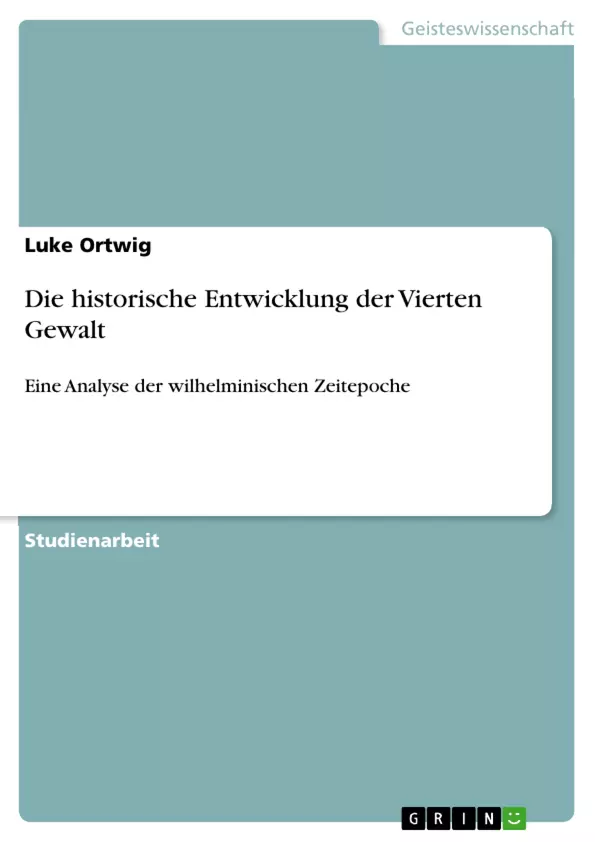Was wäre der moderne Nationalstaat ohne ein Diskurs-stiftendes Pressewesen? Eine Frage, auf die es wohl in unserer modernen Gesellschaft keine wirkliche exakte Antwort gibt. Wir leben in einer pluralistischen Welt, in der es zur Normalität wurde, sich an den „Massenmedien“ zu bedienen und sie als ein natürliches oder allgegenwärtiges Informationsgut anzusehen.
Die Beschreibung der „Massenmedien“ mit dem Begriff der Vierten Gewalt ist in der deutschsprachigen Literatur und Forschung ein modernes Phänomen. Grundlegende Werke sind nach dem 2. Weltkrieg von diversen Autoren aus verschiedenen Forschungsgebieten entstanden. Es ist demnach ein allumfassendes Themengebiet, das verschiedene Aspekte der vielfältigen Forschungsrichtungen und dessen Entwicklungen vereint.
Der Begriff der Vierten Gewalt impliziert die Annahme, dass eine Kohärenz zu den anderen drei Gewalten vorliegt. Die eigentliche Problematik, die der Vierte Gewaltbegriff vorgibt, ist die nicht vorhandene Legitimation der Gewaltausübung durch das Staatswesen. Es gibt keine verfassungsrechtliche Definition, wer die Akteure der Vierten Gewalt darstellen und welche Aufgaben sie im Staatsapparat repräsentieren sollen. Die Definitionsentwicklung wurde nicht durch den Staatsapparat vorgegeben, sondern war ein rein rechtsphilosophischer und subjektiver Vorgang von Forschenden, die sich auf die Funktionen des Pressewesens bzw. der „Massenmedien“ nach dem 2. Weltkriegs fokussierten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionsstandpunkte
- Die Untersuchung des pluralistischen Systems nach Bergsdorf
- Die politische Funktion der Massenkommunikation am Beispiel der wilhelminischen Zeitepoche
- Die Gesellschaftliche Differenzierung und die Generalfunktion
- Die oppositionelle Presse in der wilhelminischen Gesellschaft am Beispiel der SPD - Zeitung ,,Vorwärts“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der historischen Entwicklung des Begriffs "Vierte Gewalt" im Kontext der wilhelminischen Epoche. Sie untersucht die Funktionen des Pressewesens in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und beleuchtet die Rolle der sozialdemokratischen Presse, insbesondere der "Vorwärts", als potenzielles Instrument der Vierten Gewalt.
- Die Entwicklung des Begriffs "Vierte Gewalt" in der deutschsprachigen Forschung
- Die Funktionen des Pressewesens im wilhelminischen System
- Der Einfluss der Massenkommunikation auf die politische Landschaft
- Die Rolle der oppositionellen Presse im Wilhelminischen Reich
- Die Frage, ob die sozialdemokratische Presse als Vierte Gewalt definiert werden kann
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt den Leser in das Thema der Vierten Gewalt ein und stellt die Problematik der Definition und Legitimation dieses Begriffs dar. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Konzepts nach dem Zweiten Weltkrieg und die Bedeutung der Massenmedien in der modernen Gesellschaft.
- Definitionsstandpunkte: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Definitionen der Vierten Gewalt und stellt die Theorien von René Marcic, Jürgen Habermas, Volker Gerhards, Wolfgang Bergsdorf und Martin Löffler vor. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven auf die Funktionen des Pressewesens und die Rolle der außerparlamentarischen Kräfte im demokratischen System beleuchtet.
- Die Untersuchung des pluralistischen Systems nach Bergsdorf: Dieses Kapitel analysiert die Funktionen der Massenkommunikation im wilhelminischen System. Es betrachtet die politische Funktion der Massenmedien und die Auswirkungen der gesellschaftlichen Differenzierung auf die Rolle der Presse.
- Die oppositionelle Presse in der wilhelminischen Gesellschaft am Beispiel der SPD - Zeitung ,,Vorwärts“: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der sozialdemokratischen Presse in der wilhelminischen Epoche. Es beleuchtet die Zeitung "Vorwärts" als ein Beispiel für die oppositionelle Presse und analysiert deren Einfluss auf den politischen Diskurs.
Schlüsselwörter
Vierte Gewalt, wilhelminische Epoche, Massenkommunikation, Pressewesen, politische Funktion, Oppositionelle Presse, sozialdemokratische Partei, "Vorwärts", Definitionsstandpunkte, Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie, Politikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Vierte Gewalt“?
Der Begriff bezeichnet die Massenmedien (Presse), denen neben Exekutive, Legislative und Judikative eine kontrollierende und öffentliche Funktion im Staat zugeschrieben wird.
Ist die „Vierte Gewalt“ verfassungsrechtlich legitimiert?
Nein, es gibt keine verfassungsrechtliche Definition oder direkte Legitimation durch das Staatswesen; der Begriff ist eher ein rechtsphilosophisches und subjektives Konstrukt der Forschung.
Welche Rolle spielte die Zeitung „Vorwärts“ in der wilhelminischen Zeit?
Die SPD-Zeitung „Vorwärts“ diente als Beispiel für eine oppositionelle Presse, die eine kritische Gegenöffentlichkeit im monarchisch geprägten wilhelminischen System schuf.
Wann entstand die moderne Forschung zum Begriff der Vierten Gewalt?
Wesentliche Werke und die intensive wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Phänomen entstanden in Deutschland vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg.
Welche Funktionen erfüllte die Massenkommunikation im wilhelminischen System?
Sie diente der gesellschaftlichen Differenzierung und übernahm zunehmend politische Funktionen, indem sie Diskurse stiftete und als Informationsgut für die Bevölkerung fungierte.
- Quote paper
- Luke Ortwig (Author), 2018, Die historische Entwicklung der Vierten Gewalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444456