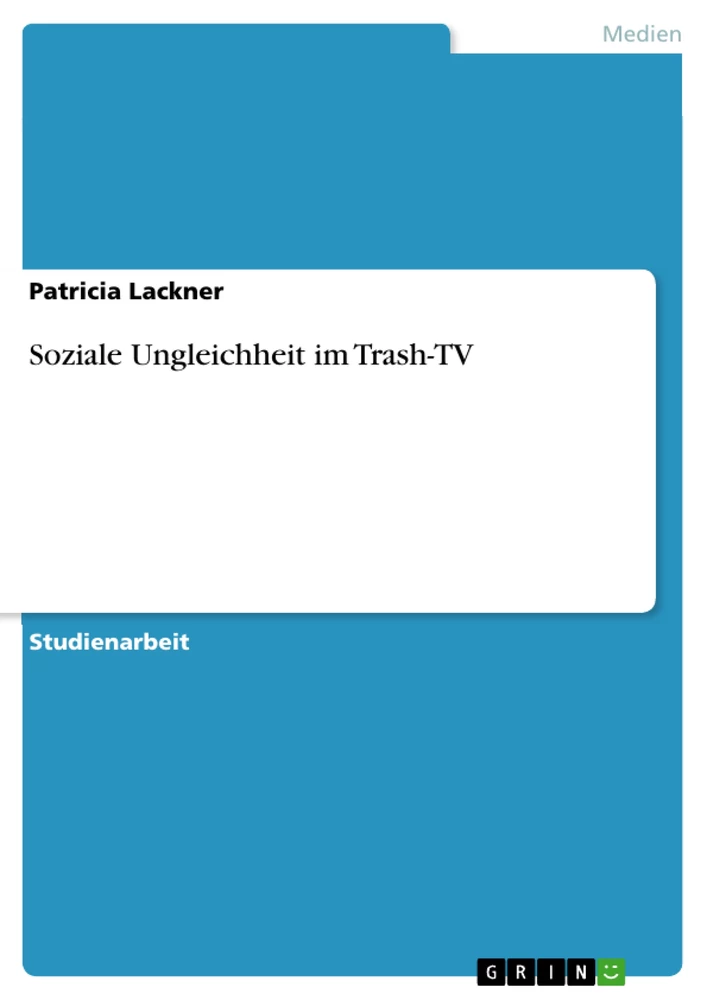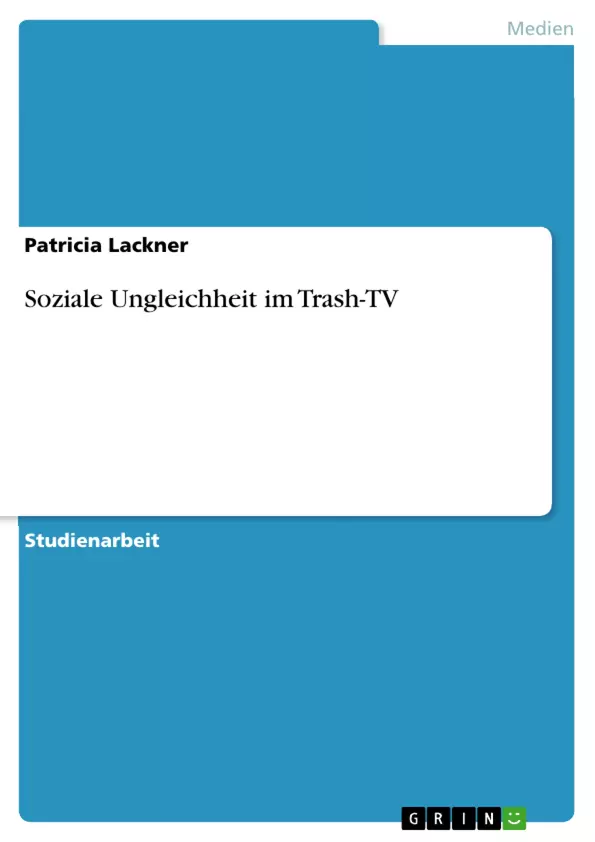Immer öfter geben Prominente durch „Homestories“ Einblick in ihr Privatleben. Der (vermeintliche) Alltag wird von der Kamera eingefangen und danach der breiten Öffentlichkeit zur Schau gestellt. Das millionenschwere Anwesen, die sündhaft teuren Familienkutschen und der verwöhnte Hund werden ins richtige Licht gerückt. Oftmals bekommen die Promis dann auch noch Besuch, meist von ebenfalls bekannten Personen, und das wird gefeiert – natürlich nur mit den edelsten Weinen und Magnum-Sektflaschen. Auf der anderen Seite werden Sendungen ausgestrahlt, die Menschen in misslichen Lagen zeigen. Die Mutter alleinerziehend, die Kinder nehmen Drogen, haben die Schule abgebrochen und werden schnell aggressiv. Die Wohnung ist verdreckt, die Kleidung schmutzig und die Umgangsformen innerhalb der Familie sind mehr als nur rau. So oder so ähnlich sehen die Requisiten und die Hauptfiguren in sogenannten „Trash-TV“-Sendungen aus. Nicht nur bei der Betrachtung dieser Sendungen klafft die gesellschaftliche Schere immer weiter auseinander, und die Ungleichheiten werden auch immer deutlicher sichtbar. Um den Begriff der sozialen Ungleichheit besser verstehen zu können, muss man schon in der Historie weit zurückgehen. In der Ständegesellschaft wurden die Menschen nach Grund und Boden und nach den Eltern eingeteilt. An der Spitze stand der König, es folgten der Klerus als erster Stand, der Adel als zweiter Stand und die Bauern und Bürger stellten den dritten Stand dar. Ein sozialer Aufstieg war fast unmöglich, ein Abstieg hingegen durchaus üblich. (vgl. Bosl 1987: 61-84) Bei der Klassengesellschaft gab es die Kategorien der Industriellen, der Arbeiterklasse und der Angestellten und Beamten. Eingeteilt wurde man aufgrund der Berufshierarchie und des Besitzes industrieller Produktionsmittel. Wiederum konnte man kaum einen sozialen Aufstieg erleben, dafür mit Leichtigkeit einen Abstieg. In der geschichteten Gesellschaft kommt es auf die Bildung und den Beruf an. Der soziale Auf- und Abstieg ist leichter möglich, dennoch selten, weil es auf die individuelle Leistung ankommt.
In dieser Arbeit werde ich beide, in dieser Hinsicht „extremen“, Filmformate des Trash-TV anhand einer Filmanalyse durchleuchten und die heutige soziale Ungleichheit mit Hilfe der Sprache, der Darstellung der Personen und der allgemeinen Lebensumstände herausarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsgegenstand
- 3. Methodologie
- 4. „DIE GEISSENS – EINE SCHRECKLICH GLAMOURÖSE FAMILIE“
- 5. FAMILY STORIES“
- 6. Zusammenfassung
- 7. Fazit
- 8. Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert zwei Formate des Trash-TV, „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ und „Family Stories“, um die Darstellung sozialer Ungleichheiten im deutschen Fernsehen aufzuzeigen. Sie untersucht die spezifischen Inszenierungen der beiden Sendungen, ihre Darstellung von Lebenswelten, Personen und Sprache, sowie die potenziellen Beweggründe der Sender für die Ausstrahlung der Formate.
- Darstellung sozialer Ungleichheiten im Trash-TV
- Filmanalyse von „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ und „Family Stories“
- Untersuchung der Lebenswelten, Personen und Sprache in den beiden Sendungen
- Analyse der Sendermotivation für die Ausstrahlung der Formate
- Vergleich und Gegenüberstellung der beiden Sendungen
Zusammenfassung der Kapitel
- 1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Soziale Ungleichheiten im Trash-TV“ dar und erläutert den Bezug zu den beiden Sendungen „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ und „Family Stories“. Sie führt in die Problematik sozialer Ungleichheiten ein und beleuchtet die historischen Entwicklungen des Begriffs.
- 2. Forschungsgegenstand: Dieses Kapitel erläutert die Auswahl der beiden Sendungen als Forschungsgegenstand und beschreibt die konkreten Folgen, die für die Analyse herangezogen werden. Es wird die Bedeutung der Senderwahl und die Kriterien für die Auswahl der Folgen detailliert dargestellt.
- 3. Methodologie: Dieses Kapitel beschreibt die Methode der Filmanalyse, die für die Untersuchung der beiden Sendungen verwendet wird. Es werden die spezifischen Analysemethoden und Schwerpunkte vorgestellt.
- 4. „DIE GEISSENS – EINE SCHRECKLICH GLAMOURÖSE FAMILIE“: Dieses Kapitel widmet sich der Filmanalyse der Sendung „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“. Es werden die spezifischen Inszenierungen, die Sprache und die Darstellung der Personen und Lebensumstände der Familie Geiss analysiert.
- 5. FAMILY STORIES“: Dieses Kapitel widmet sich der Filmanalyse der Sendung „Family Stories“. Es werden die spezifischen Inszenierungen, die Sprache und die Darstellung der Personen und Lebensumstände der Familie in der ausgewählten Folge analysiert.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Trash-TV, Filmanalyse, „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“, „Family Stories“, Lebenswelten, Sprache, Darstellung, Sendermotivation, Vergleich, Gegenüberstellung.
- Quote paper
- Patricia Lackner (Author), 2014, Soziale Ungleichheit im Trash-TV, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444564