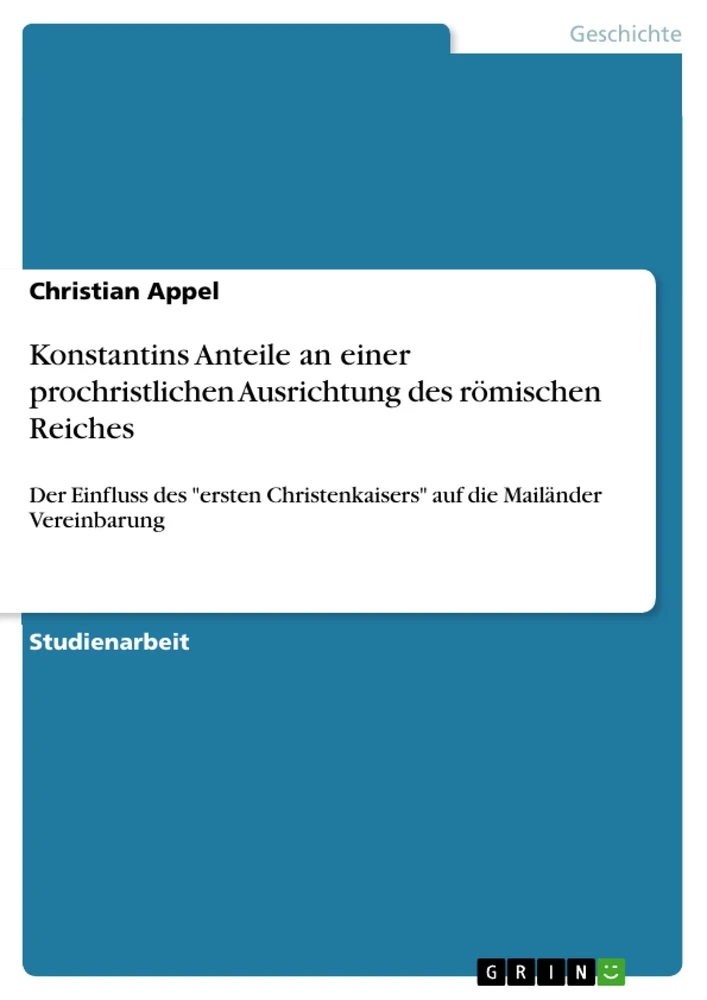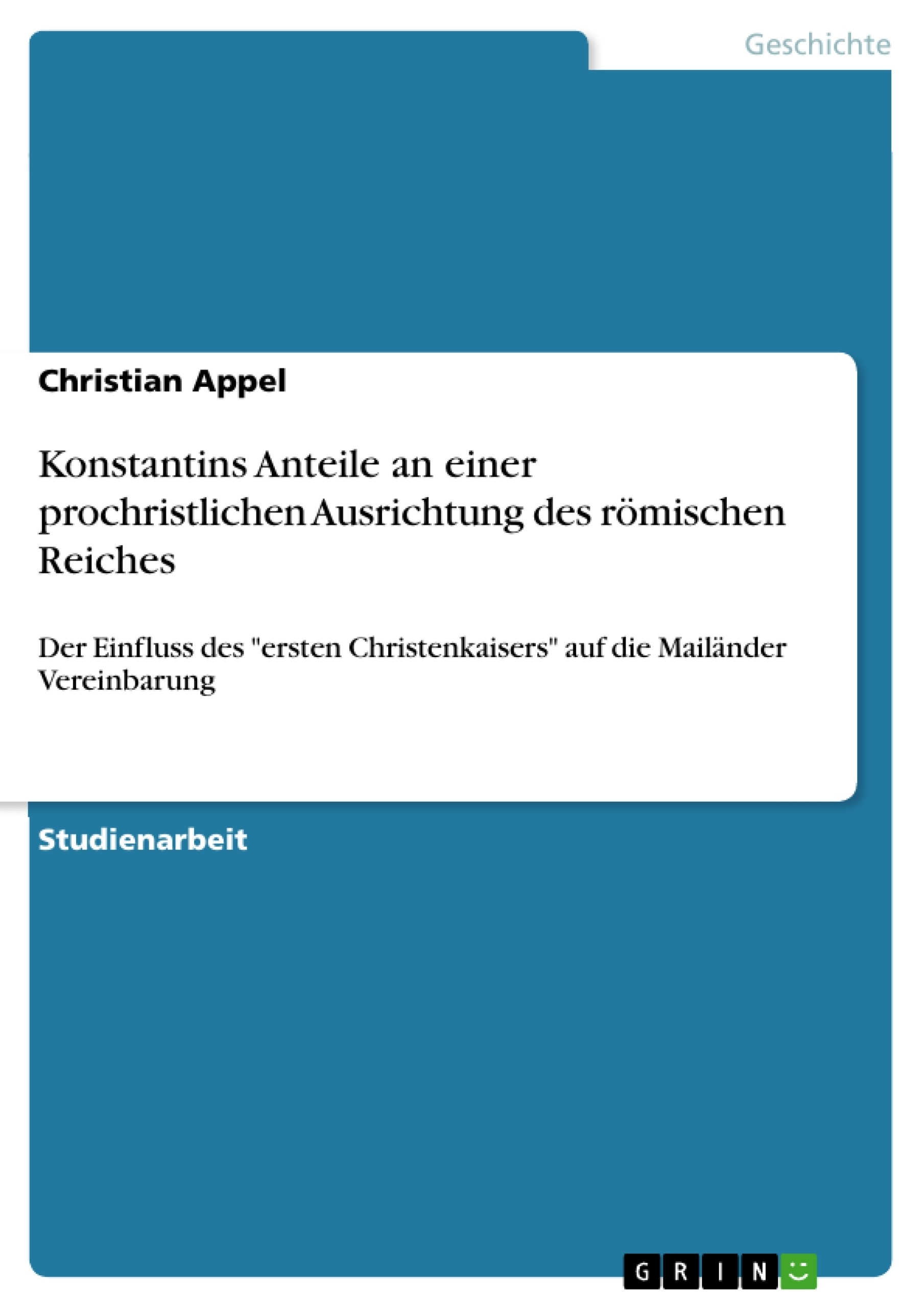Die Mailänder Vereinbarung wird von der Wissenschaft nahezu einstimmig als ein Meilenstein in der römischen Christenpolitik bewertet. Die durch sie am 13. Juni 313 verkündete und später auch im Osten des Reiches als „constitutio“ durchgesetzte Religionsfreiheit begründete einen zentralen Pfeiler in Bezug auf den zukünftigen Erfolg des Christentums in der römischen Spätantike und darüber hinaus. Konstantin, als Augustus im westlichen Reichsgebiet auf der einen Seite und der Augustus des Ostens, Licinius, auf der anderen, waren die beiden Hauptakteure, welche in Mailand eine Entscheidung trafen, die alle nun folgenden Jahrhunderte prägte. Da Konstantin von einer breiten Masse von Historikern als der erste Christenkaiser bezeichnet wird, lässt sich folglich vermuten, dass der Sohn des Constantius Chlorus auch maßgeblich an der Entstehung der Vereinbarung beteiligt, bzw. gar die treibende Kraft hinter dem Treffen mit Licinius war. Dieser These will sich diese Arbeit im Folgenden widmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Quellenlage
- Die Forschungslage
- Der Einfluss Konstantins auf die Mailänder Vereinbarung
- Die Mailänder Vereinbarung – Ein Abbild des Galeriusediktes von 311?
- Die Mailänder Vereinbarung – Eine Folge der drei Schreiben nach Afrika?
- Die Mailänder Vereinbarung – Ein Ergebnis der Machtpolitik des Licinius?
- Fazit
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des römischen Kaisers Konstantin auf die Mailänder Vereinbarung, die im Jahr 313 eine weitreichende Religionsfreiheit im Römischen Reich einführte. Ziel ist es, die Rolle Konstantins bei der Entstehung der Vereinbarung zu untersuchen und zu analysieren, inwieweit er die treibende Kraft hinter diesem historischen Ereignis war.
- Vergleich der Inhalte der Mailänder Vereinbarung mit dem Galeriusedikt von 311
- Analyse der drei Schreiben Konstantins an Statthalter in Afrika im Jahr 312
- Untersuchung der Motive und Interessen des römischen Kaisers Licinius im Hinblick auf die Christen
- Beurteilung des Anteils Konstantins an der Mailänder Vereinbarung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Mailänder Vereinbarung als einen Meilenstein in der römischen Christenpolitik vor und beleuchtet die Rolle Konstantins als potenziellen Schlüsselfaktor. Die wichtigsten Forschungsfragen werden aufgezeigt.
- Die Quellenlage: Dieses Kapitel analysiert die verfügbaren Quellen, darunter die Mailänder Vereinbarung selbst in ihren beiden Versionen sowie das Galeriusedikt von 311 und die Schreiben Konstantins an afrikanische Statthalter.
- Die Forschungslage: Die Forschungsliteratur zur Mailänder Vereinbarung und Konstantins Einfluss auf die Christenpolitik wird vorgestellt. Kontroversen und verschiedene Perspektiven werden beleuchtet.
- Der Einfluss Konstantins auf die Mailänder Vereinbarung: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen der Mailänder Vereinbarung und dem Galeriusedikt von 311, analysiert Konstantins Position im Kontext der drei Briefe nach Afrika und beleuchtet die Motivationslage des Kaisers Licinius.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit umfassen: Mailänder Vereinbarung, Konstantin der Große, Christenpolitik, Religionsfreiheit, Galeriusedikt von 311, Licinius, Quellenkritik, historische Bedeutung, Machtpolitik, prochristliche Politik.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Mailänder Vereinbarung von 313?
Es war eine Übereinkunft zwischen den Kaisern Konstantin und Licinius, die Religionsfreiheit im Römischen Reich gewährte und einen Wendepunkt in der Christenpolitik markierte.
War Konstantin die treibende Kraft hinter der Vereinbarung?
Die Arbeit untersucht die These, dass Konstantin aufgrund seiner prochristlichen Einstellung maßgeblich an der Entstehung und Durchsetzung der Vereinbarung beteiligt war.
Wie unterscheidet sie sich vom Galeriusedikt von 311?
Während das Galeriusedikt das Christentum nur duldete, ging die Mailänder Vereinbarung einen Schritt weiter und garantierte volle Religionsfreiheit und Rückgabe von Kirchengut.
Welche Rolle spielten die Schreiben an afrikanische Statthalter?
Diese Briefe aus dem Jahr 312 zeigen Konstantins frühes Engagement für die Kirche und dienten als Vorläufer für die in Mailand getroffenen Entscheidungen.
Welche Motive hatte Kaiser Licinius?
Die Arbeit analysiert, inwieweit Licinius aus rein machtpolitischen Interessen handelte oder ob er Konstantins Kurs zur Stabilisierung des Reiches folgte.
- Quote paper
- Christian Appel (Author), 2011, Konstantins Anteile an einer prochristlichen Ausrichtung des römischen Reiches, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444651