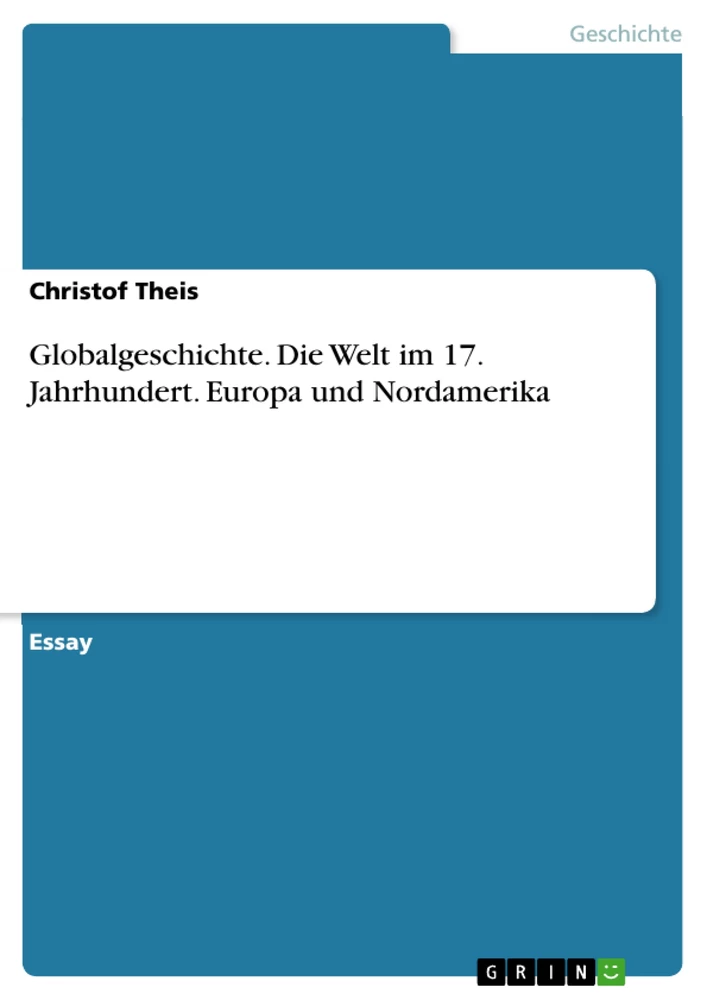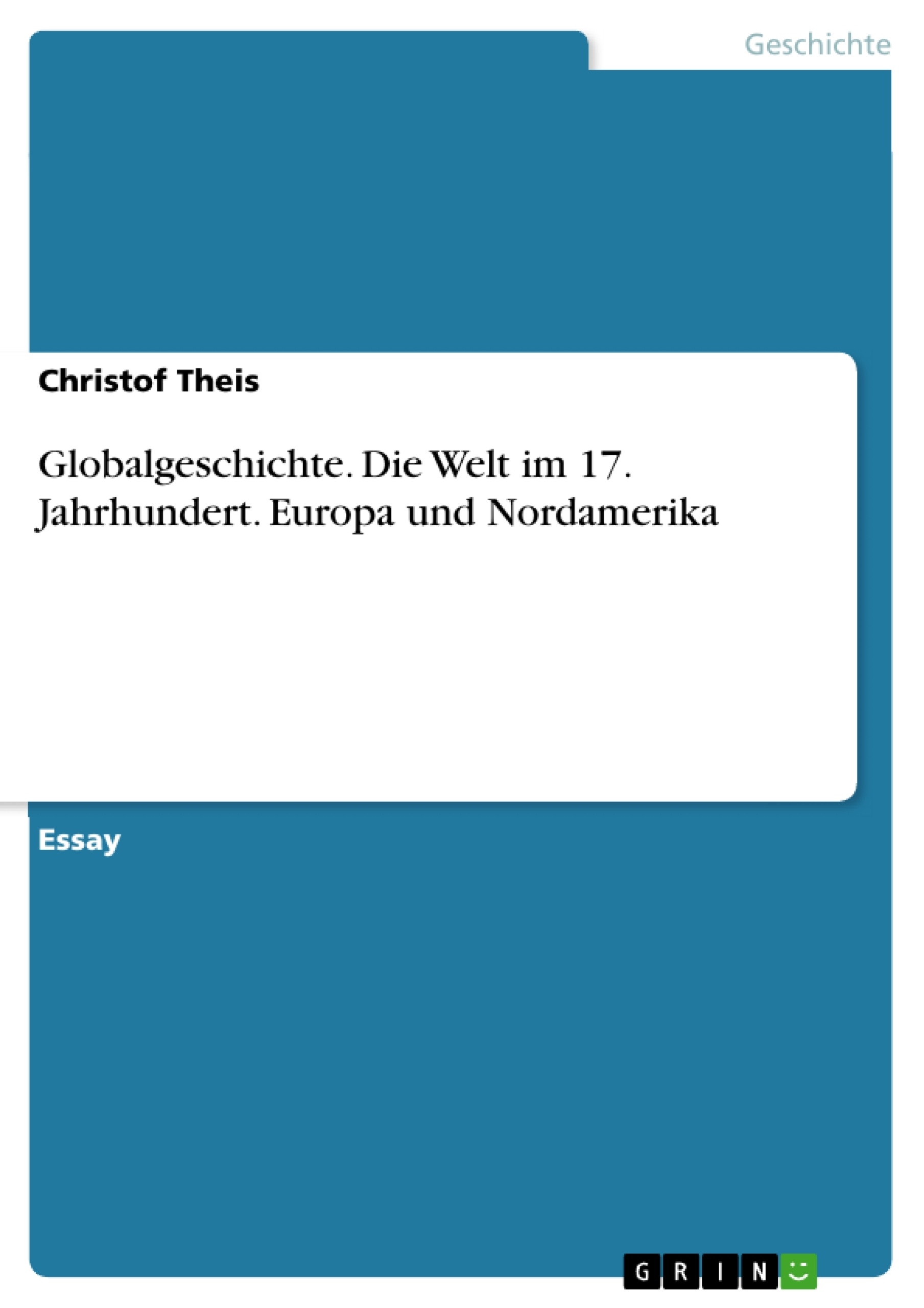Bereits vor der Ankunft der Europäer, im 16. Jahrhundert, existierten Kulturformen auf heutigem amerikanischem Boden. Beispiele für diese indigene Kulturen sind: die Hopewell-Indianer, die Cherokee, Chickasaw oder Natchez, die starke Kontakte mit Mittelamerika vermuten lässt. Betrachtet man Gebiete und Stämme so erkennt man zwei Sprachfamilien, die Algonkin und die Irokesen Da Reit- bzw Lasttiere erst mit den Europäern kamen, hatten die Waldindianer einen hervorragenden Handelsweg über Fluss und Fußwege. Trotz „Modus Vivandi“, einer idyllischen Harmonie, gab es Konflikte innerhalb und außerhalb des Volkes.
In dieser Arbeit kommt es zu einer kurzen zusammenfassenden Darstellung des Textes „Neue Welten für Europäer und Amerikaner Nordamerika“ von Claudia Schnurman, die für die darauffolgenden reflexive Bewegung von Bedeutung sein wird.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Ausgangssituation: Nordamerika vor den europäischen Niederlassungen
- Erste Westeuropäische Anläufe im 16. Jahrhundert
- Das neue Frankreich in Amerika: „La nouvelle France“
- Englische Kolonien
- Neuniederland
- Kolonialer Alltag
- Interkoloniale Kommunikation
- Kommentar zu „Neue Welten für Europäer und Amerikaner, Nordamerika,“ Claudia Schnurmann
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Neue Welten für Europäer und Amerikaner, Nordamerika“ von Claudia Schnurmann befasst sich mit der Geschichte der europäischen Kolonialisierung Nordamerikas. Der Fokus liegt dabei auf den Anfängen der europäischen Präsenz im 16. Jahrhundert und der Entwicklung der verschiedenen europäischen Kolonien im 17. Jahrhundert. Die Arbeit beleuchtet die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte der Kolonialisierung sowie die Beziehungen zwischen Europäern und den indigenen Völkern.
- Die Situation Nordamerikas vor der europäischen Ankunft
- Die ersten europäischen Versuche, sich in Nordamerika zu etablieren
- Die Entwicklung der französischen, englischen und niederländischen Kolonien
- Der koloniale Alltag und die Beziehungen zwischen Europäern und Indianern
- Interkoloniale Kommunikation und Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
Zusammenfassung
1.1 Ausgangssituation: Nordamerika vor den europäischen Niederlassungen
Bereits vor der Ankunft der Europäer im 16. Jahrhundert existierten in Nordamerika verschiedene indigene Kulturen, wie beispielsweise die Hopewell-Indianer, die Cherokee, Chickasaw oder Natchez. Diese Kulturen hatten bereits Kontakte zu Mittelamerika. Die Algonkin und die Irokesen waren die beiden wichtigsten Sprachfamilien. Die Waldindianer nutzten Flüsse und Fußwege als Handelswege, da Pferde erst mit den Europäern kamen. Trotz einer idyllischen Harmonie („Modus Vivandi“) gab es Konflikte innerhalb und außerhalb der indigenen Gesellschaften.
1.2 Erste Westeuropäische Anläufe im 16. Jahrhundert
Im 16. Jahrhundert unternahmen Westeuropäer mehrere Versuche, sich in Nordamerika zu etablieren, die jedoch mit Hoffnung und Angst verbunden waren. Der neue Kontinent wurde später zum Schauplatz politischer Konflikte zwischen Frankreich, England und Spanien. Die Angriffsmöglichkeiten der spanischen Herrschaft waren jedoch begrenzt. Die meisten Siedlungsaktionen blieben ohne Konsequenzen. Feindseligkeiten mit den Indianern waren häufig ein Grund für das Scheitern. 1562/1563 gründeten Jean Ribault und Rene Goulaine de Laudonniere Fort La Caroline in Florida. Dieses fiel jedoch bald an die Spanier unter dem Namen San Marco und wurde mit San Augustin eine europäische Siedlung, die von Dauer sein sollte. Die Kolonien sollten auch wirtschaftliche Vorteile durch den Handel bringen. Mit der Gründung der „West indischen Kompanie“ erklärte die Niederlande 1621 dem spanischen Herrscher den Kampf.
1.3 Das neue Frankreich in Amerika: „La nouvelle France“
Trotz früher Siedlungsprojekte in Amerika gelang den Franzosen erst ab 1603 mit dem zweiten Frankreich (nouvelle France) in Kanada und der Stadt Quebec der Durchbruch. Verschiedene Konflikte zwischen Irokesen und Moahawk sowie andere Streitigkeiten zwangen die Siedlung, sich auf die Krone zu stützen. Oftmals griffen europäische Probleme auf die Kolonien über, wobei Indianer auf beiden Seiten kämpften. Sie waren oft gefangen, da sie von europäischen Kolonien und deren Konflikten umzingelt waren. Obwohl Frankreich oft den Kürzeren zog, so glänzten sie doch durch eine positive Presse, gute Kontakte und Integration der Indianer. Sie begnügten sich „mit Pelzen, vielen Seelen und wenig Land“1.
1.4 Englische Kolonien
Von Jamestown nach Germantown, 1607-1683
Die erste Kolonie entstand 1607 in Jamestown. Da die Könige die Indianer als faul und gottlos betrachteten, beanspruchten sie das „neue“ Land als ihr eigenes. Im Gegensatz zu spanischen Kolonien waren die englischen meist planlos und unkoordiniert. Erst 1696 gelang mit dem „Board of trade and plantation“ eine gewisse Ordnung. John Smith verfasste mehrere Beschreibungen über die Gründungsjahre von Jamestown und die Beziehungen zwischen Indianern und Engländern, wie z.B. den Konflikt mit den Powhatans 1622. Mit der Playmouth Plantation entstand eine zweite Kolonie, die im Gegensatz zu anderen von wohlhabenden Handwerkern und deren Familien besiedelt wurde, um unter ihren strengen politischen und religiösen Regeln leben zu können. 1624 ernannte die Krone Virginia zu einer Kronkolonie. 1683 entstand die Kolonie Germantown, die aus Scharen Einwanderer aus deutschen Territorien bestand. Die Idee war ein Staatsmodell, in dem Nächstenliebe und Toleranz herrschen sollten.
1.5 Neuniederland
Aufgrund mangelnder Koordination gelang es den Niederländern erst später, sich zu den Kolonialmächten zu gesellen. 1614 entstand die Nieuw Nederland Compagnie, die sich auf den Pelzhandel spezialisierte. Den kolonialen Start machte die Provinz Holland mit Neuniederland, dem heutigen New York. Ausschlaggebend für ihren Erfolg war die gute geografische wie auch strategische Position. Die Eroberung der Abc-Inseln durch die WIC schuf weitere wirtschaftliche Vorteile. Später hatte jedoch auch die WIC die üblichen finanziellen und organisatorischen Schwierigkeiten. Neu Niederland und Nieuw holland gingen relativ schnell nach Unstimmigkeiten verloren, im Gegensatz zu anderen Kolonien wie Curacao oder Aruba. Typisch für die Niederlande war der Kosmopolitismus, der sich besonders in Neu-Amsterdam bemerkbar machte. Trotz friedlicher Kontakte zu den Indianern kam es immer wieder zu blutigen Konfrontationen, wobei Verdrängung und Zerstörung indianischer Gesellschaften die Folge waren.
1.6 Kolonialer Alltag
Mittlerweile herrschten mehrere Siedlungsformen in Amerika. Oftmals waren die Kolonien bloße Kopien der Mutterländer (z.B. bei New England). Unterschied war jedoch der höhere Lebensstandard und die höhere Lebenserwartung in den Kolonien. Obwohl der Großteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig war, gab es erfolgreiche Unternehmer, die ihren Erfolg in politische Macht umwandelten. Im 17. Jahrhundert kam es zur Hinwendung zur Manufakturpflanze wie dem Tabak, der ganze Kulturen und Wirtschaftsformen zum Ausdruck brachte. Anfangs erfreuten sich europäische Kontraktarbeiter über den möglichen Erfolg der Plantagenarbeit. Am Ende des 17. Jahrhunderts benutzte man jedoch Schwarzafrikaner als unfreie Zwangsarbeiter, wobei die Hochphase sich jedoch im späten 18. Jahrhundert befindet. Bezüglich der Ureinwohner, der Indianer, so gab es zwar Missionstätigkeit und „Indianerapostel“, die sich teilweise um die Indianer kümmerten. Größtenteils wurden sie jedoch verdrängt, getötet oder teilweise auch als Sklaven unterworfen. Ein Gebiet, auf dem Europäer, Irokesen und Algonkin zusammen kamen, war der Handel von Pelzen aber auch vom so genannten Wampum oder Seawant. Kultureller Austausch und gleichzeitiger Verlust der indianischen Kultur waren die Folge. Anhand der steigenden Konkurrenz zwischen den indianischen Stämmen und der Zusammenarbeit mit den einzelnen Kolonien kam es zu Konflikten und Verdrängungsmechanismen. Nicht nur dass Kolonialherren nun versuchten, die Indianer zu verdrängen, nun versuchten auch die Stämme sich untereinander aus verschiedenen Gebieten zu verjagen. Viele Europäer und Indianer fielen außerdem im „King's Philip's war“ 1675/76 Des Weiteren fielen die Indianer europäischen Krankheiten und Epidemien zum Opfer. Aus der Sicht der Europäer war der Tod der Indianer die gerechte Strafe Gottes.
1.7 Interkoloniale Kommunikation
Auffallend ist, dass die Kolonien keine Einheit bilden. Territoriale Grenzen wurden ignoriert. So kam es nicht nur zu einer mutterländischen Kommunikation, sondern auch zu einer interkulturellen Kommunikation zwischen Kaufleuten und Händlern aus allen Gegenden. Oftmals wurden auch europäische Entscheidungen, einerseits zum Vorteil, andererseits zum Verhängnis für die Kolonien, wie zum Beispiel der „King William's war“ (1689-1697).
Schlüsselwörter
Die Arbeit „Neue Welten für Europäer und Amerikaner, Nordamerika“ beleuchtet die Geschichte der europäischen Kolonialisierung Nordamerikas, insbesondere die Anfänge der europäischen Präsenz im 16. Jahrhundert und die Entwicklung der französischen, englischen und niederländischen Kolonien im 17. Jahrhundert. Wichtige Schlüsselwörter und Themen sind: Kolonialisierung, Nordamerika, Europäische Geschichte, Indigene Kulturen, Indianer, Kolonialismus, Pelzhandel, Handel, Konflikte, Beziehungen, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Welche indigenen Kulturen lebten vor den Europäern in Nordamerika?
Dazu gehörten die Hopewell-Indianer, Cherokee, Chickasaw, Natchez sowie die großen Sprachfamilien der Algonkin und Irokesen.
Was unterschied die französische von der englischen Kolonisation?
Franzosen („La nouvelle France“) integrierten sich oft stärker durch Pelzhandel und Mission, während Engländer meist auf Landbesitz und dauerhafte Siedlungen setzten.
Was war „Neuniederland“?
Eine niederländische Kolonie mit dem Zentrum Neu-Amsterdam (heute New York), die vor allem durch den Pelzhandel der Westindischen Kompanie geprägt war.
Warum scheiterten viele frühe Siedlungsversuche?
Häufige Gründe waren Hunger, Krankheiten, mangelnde Unterstützung aus Europa und blutige Konflikte mit den indigenen Völkern.
Wie veränderte der Kontakt mit Europäern das Leben der Indianer?
Es kam zu einem kulturellen Austausch, aber auch zu massiven Bevölkerungsverlusten durch eingeschleppte Krankheiten, Vertreibung und Versklavung.
- Quote paper
- Christof Theis (Author), 2013, Globalgeschichte. Die Welt im 17. Jahrhundert. Europa und Nordamerika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444718