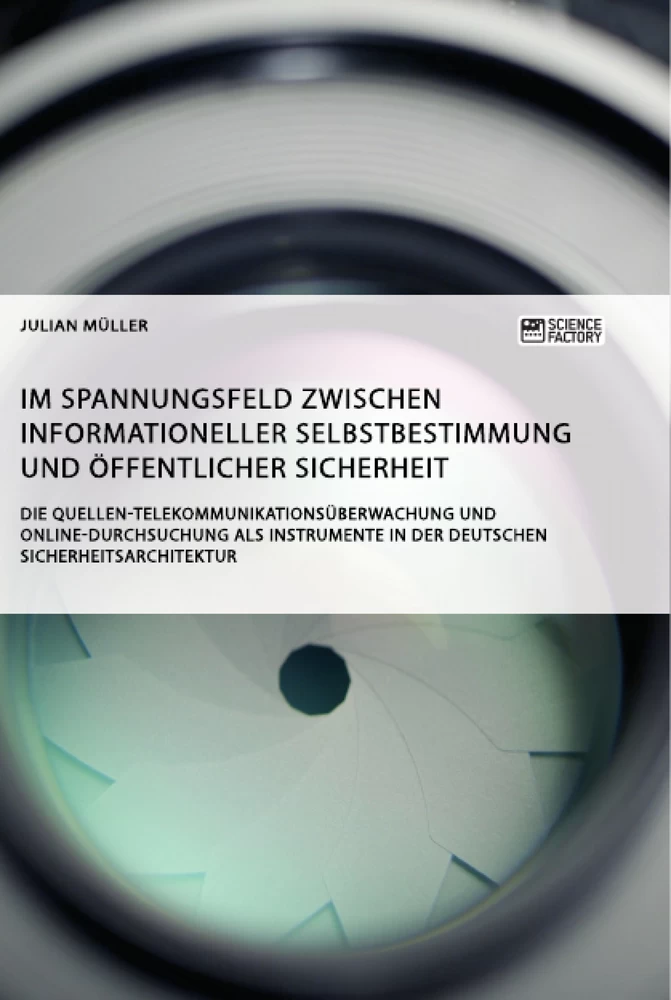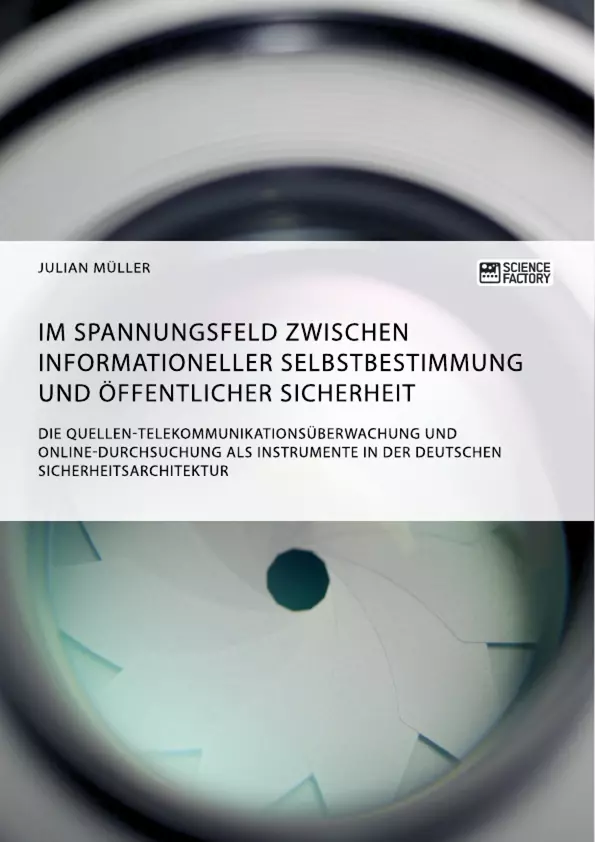Sicherheitsbehörden greifen auf die Daten von Bürgern zurück, wenn sie eine konkrete Gefahr vermuten. Doch wo liegen die juristischen Grenzen eines solchen Vorgehens?
Julian Müller zeigt, in welcher Weise die Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchungen gegenwärtig zur deutschen Sicherheit beitragen. Er untersucht, inwiefern diese Maßnahmen mit dem geltenden deutschen Recht vereinbar sind, besonders mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.
Mit seiner Publikation liefert Müller eine rechtliche Einschätzung zu einem hochaktuellen Thema: Das ideale Nachschlagewerk für alle, die sowohl nach theoretischen Grundlagen als auch praktischen Handlungsempfehlungen suchen.
Aus dem Inhalt:
- Bundesdatenschutzgesetz;
- Öffentliche Sicherheit;
- Quellen-Telekommunikationsüberwachung;
- Online-Durchsuchung;
- Datenschutz;
- Grundgesetz
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Die Telekommunikationsüberwachung, Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung im sicherheitsrechtlichen Kontext
- II.1 Telekommunikationsüberwachung
- II.2 Quellen-Telekommunikationsüberwachung
- II.3 Online-Durchsuchung
- III. Entwicklung und Struktur der Telekommunikationsüberwachung in Deutschland
- IV. Anwender der Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung
- IV.1 Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrbehörden
- IV.2 Inlandsnachrichtendienste
- V. Normative Grundlagen für die Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung
- V.1 Bundesrecht
- V.2 Landesrecht
- V.3 Zwischenergebnis zur Gesetzeslage
- V.4 Allgemeine gesetzesübergreifende Grundsätze der Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung
- VI. Rechtskonformität der Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung
- VI.1 Justizielle Entscheidungen
- VI.2 Zwischenergebnis zur Rechtsprechung
- VI.3 Schrifttum und Sachverständigenurteile
- VII. Juristische Beurteilung und Lösungsvorschläge
- VII.1 Verfassungswidrigkeit der Online-Durchsuchung für Nachrichtendienste
- VII.2 Reduktion der Katalogstraftaten des § 100b StPO
- VII.3 Harmonisierung der Landespolizeigesetze und Landesverfassungsschutzgesetze
- VII.4 Implementierung der Quellen-Telekommunikationsüberwachung in das Artikel 10-Gesetz, Bundesverfassungsschutzgesetz und das Zollfahndungsdienstgesetz
- VIII. Ökonomische Aspekte
- IX. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das vorliegende Werk analysiert die Spannungsfelder zwischen informationeller Selbstbestimmung und öffentlicher Sicherheit im Kontext der Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung. Es untersucht die Entwicklung und den rechtlichen Rahmen dieser Überwachungsinstrumente im deutschen Sicherheitsrecht, sowie deren Anwendung durch Strafverfolgungs- und Nachrichtendienste.
- Die Telekommunikationsüberwachung im Kontext von informationeller Selbstbestimmung und öffentlicher Sicherheit
- Die rechtlichen Grundlagen der Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung
- Die Anwendung dieser Instrumente durch Strafverfolgungs- und Nachrichtendienste
- Die rechtliche und verfassungsrechtliche Beurteilung der Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung
- Mögliche Lösungsansätze zur Harmonisierung von Datenschutz und Sicherheit im Bereich der Telekommunikationsüberwachung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Telekommunikationsüberwachung im Spannungsfeld von Selbstbestimmung und Sicherheit ein. Es beleuchtet die Bedeutung dieser Überwachungsinstrumente im Kontext der digitalen Kommunikation und verweist auf die damit verbundenen ethischen und rechtlichen Herausforderungen.
Im zweiten Kapitel werden die Telekommunikationsüberwachung, Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung im Detail vorgestellt. Es werden ihre jeweiligen Funktionsweisen, rechtlichen Grundlagen und Anwendungsgebiete erläutert.
Das dritte Kapitel zeichnet die Entwicklung der Telekommunikationsüberwachung in Deutschland nach und analysiert die unterschiedlichen Phasen ihrer Einführung und Anpassung an die technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen.
Im vierten Kapitel werden die Anwender der Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung beleuchtet. Es werden die verschiedenen Behörden und deren spezifische Aufgaben im Bereich der Überwachung vorgestellt.
Das fünfte Kapitel widmet sich den normativen Grundlagen für die Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung. Es analysiert die relevanten Gesetze und Rechtsvorschriften auf Bundes- und Landesebene.
Im sechsten Kapitel wird die Rechtskonformität der Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung anhand von Gerichtsentscheidungen, wissenschaftlichen Publikationen und Sachverständigenurteilen beleuchtet.
Das siebte Kapitel befasst sich mit der juristischen Beurteilung der Überwachungsinstrumente und entwickelt Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Rechtslage. Es werden konkrete Handlungsempfehlungen für die Gesetzgebung und die Praxis formuliert.
Das achte Kapitel beleuchtet die ökonomischen Aspekte der Telekommunikationsüberwachung und untersucht die Kosten und den Nutzen dieser Instrumente.
Schlüsselwörter
Telekommunikationsüberwachung, Quellen-Telekommunikationsüberwachung, Online-Durchsuchung, informationelle Selbstbestimmung, öffentliche Sicherheit, Datenschutz, Rechtsstaat, Grundrechte, Strafverfolgung, Nachrichtendienste, Sicherheitsarchitektur, digitale Kommunikation, technologische Entwicklung, Rechtsprechung, Gesetzgebung, Gesetzeslage, Juristische Beurteilung, Lösungsvorschläge, ökonomische Aspekte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen TKÜ und Online-Durchsuchung?
Die Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) überwacht laufende Kommunikation. Die Online-Durchsuchung erlaubt den Zugriff auf gespeicherte Daten auf einem IT-System (z. B. Festplatteninhalte).
Was bedeutet Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ)?
Hierbei wird die Kommunikation direkt am Endgerät (z. B. Smartphone) abgefangen, bevor sie verschlüsselt oder nachdem sie entschlüsselt wurde.
Verletzt die Online-Durchsuchung das Grundgesetz?
Das Bundesverfassungsgericht hat das „Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme“ geschaffen, um enge Grenzen für solche Eingriffe zu setzen.
Wer darf Online-Durchsuchungen durchführen?
In Deutschland sind dies vor allem Strafverfolgungsbehörden (bei schweren Straftaten) und Nachrichtendienste (zur Gefahrenabwehr), jeweils unter strengen gesetzlichen Auflagen.
Welche Rolle spielt das Bundesdatenschutzgesetz hierbei?
Es bildet den Rahmen für den Schutz personenbezogener Daten und setzt fest, unter welchen Bedingungen staatliche Stellen Daten erheben und verarbeiten dürfen.
- Quote paper
- Julian Müller (Author), 2019, Im Spannungsfeld zwischen informationeller Selbstbestimmung und öffentlicher Sicherheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444924