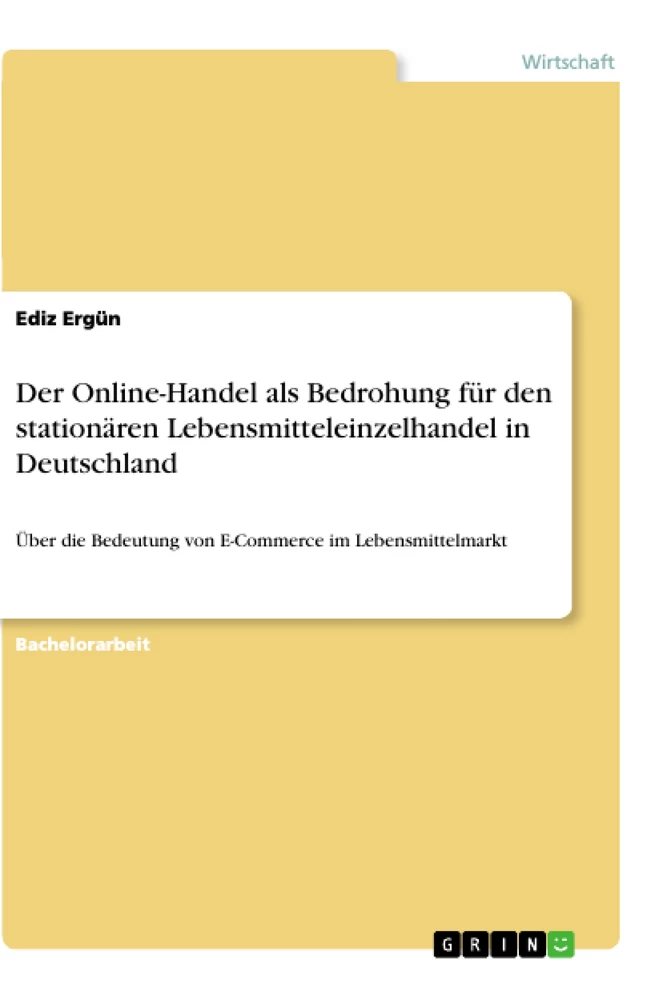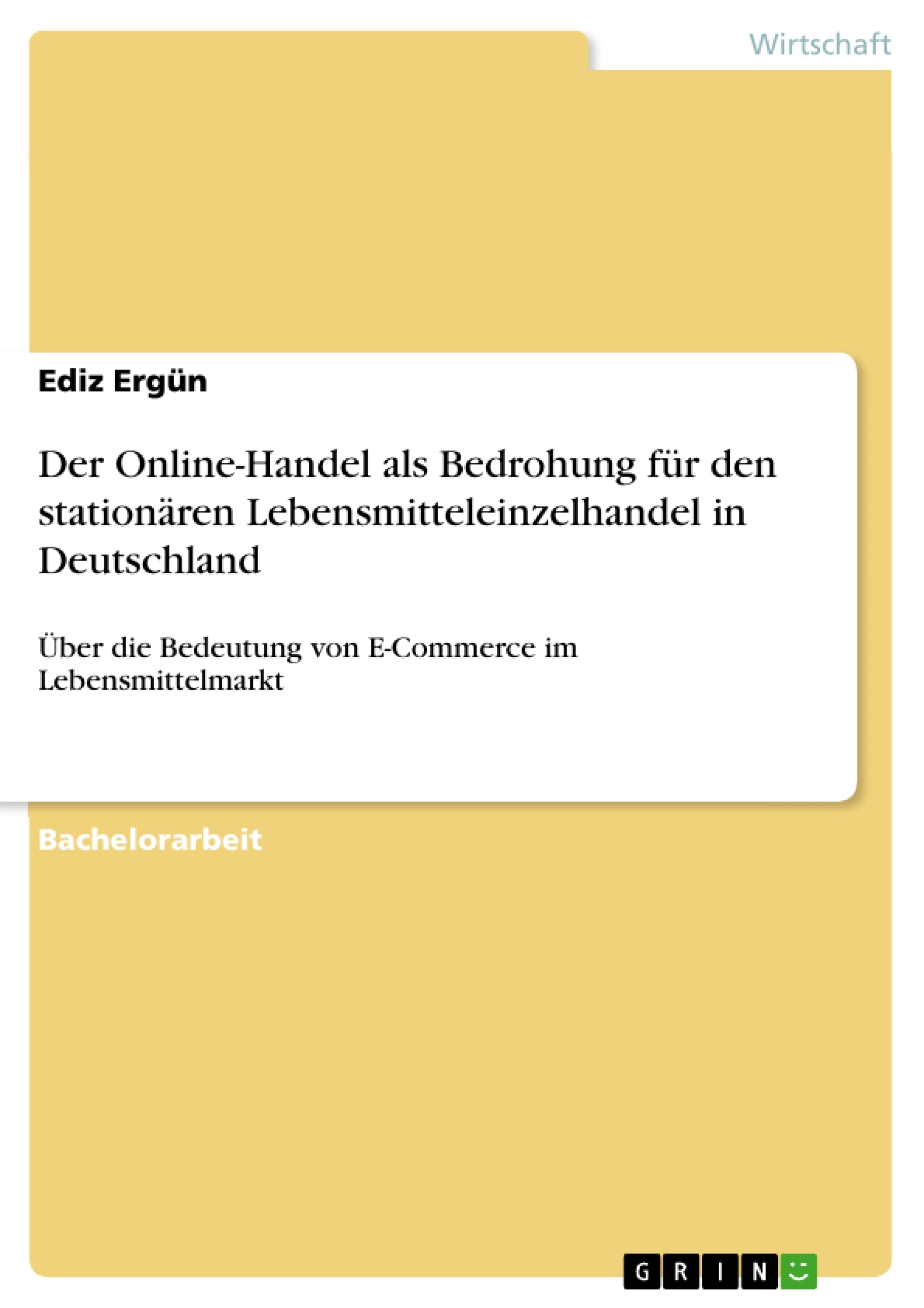Die vorliegende Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen dem Online-Handel und dem stationären Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland.
Der Handel befindet sich in einem ständigen Wandel. Für Unternehmen bedeutet dies entweder neue Möglichkeiten oder aber auch neue Risiken. Unternehmen, die das verstanden haben und sich den neuen Veränderungen bestmöglich anpassen, haben daher einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Seit einigen Jahren macht sich im Einzelhandel eine tektonische Verschiebung der Umsätze vom stationären Handel zum Online-Handel bemerkbar. Die Wachstumsraten sind dabei überdurchschnittlich hoch. Das liegt vor allem an dem veränderten Einkaufsverhalten und dem schnellen technologischen Wandel. Das Internet wird dabei täglich von Millionen Menschen in Deutschland genutzt.
Mit der anfangs beschriebenen Relevanz des Themas soll daher folgende Forschungsfrage untersucht werden: Ist der Online-Handel eine Bedrohung für den stationären Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland? Dafür werden zuerst die theoretischen Begrifflichkeiten geklärt. Es folgt das dritte Kapitel, welche sich mit dem Status Quo im Lebensmittelmarkt beschäftigt. Dabei werden die Märke in Deutschland, Großbritannien und Frankreich durchleuchtet, wobei der deutsche Markt ausführlicher beschrieben wird als die anderen beiden. In Kapitel 4 werden die unterschiedlichen Geschäftsmodelle des Online-Handels dargestellt. Im darauffolgenden Kapitel werden mehrere Barrieren des Online-Lebensmitteleinzelhandels beschrieben. In Kapitel 6 sollen die Unternehmen in der Praxis erläutert werden. Das Kapitel 7 endet mit dem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition theoretischer Begrifflichkeiten
- E-Commerce
- Entwicklung des E-Commerce
- Handel
- Der Stationäre Handel
- Lebensmittel
- Status Quo im Lebensmittelmarkt
- Deutschland
- Großbritannien
- Frankreich
- Geschäftsmodelle des Online Lebensmittelhandel
- Begründung für geringe Verbreitung
- Online Lebensmittelhandel in der Praxis
- Amazon Fresh
- Rewe
- Allyouneed Fresh
- Edeka
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedrohung, die der Online-Handel für den stationären Lebensmittelhandel in Deutschland darstellt. Sie analysiert die Entwicklung des E-Commerce im Lebensmitteleinzelhandel und beleuchtet die relevanten Faktoren, die zu einem verstärkten Wachstum des Online-Lebensmittelhandels führen könnten. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen und Chancen, die sich für den stationären Handel durch den Online-Wettbewerb ergeben.
- Entwicklung des E-Commerce im Lebensmittelhandel
- Veränderte Konsumgewohnheiten und die Rolle des Online-Handels
- Herausforderungen und Chancen für den stationären Lebensmittelhandel
- Geschäftsmodelle des Online-Lebensmittelhandels
- Zukunftsprognosen und Trends im Lebensmitteleinzelhandel
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Einleitung stellt den aktuellen Wandel im Handel dar und beleuchtet die wachsende Bedeutung des Online-Handels, insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel. Es werden wichtige Trends und Statistiken zum Online-Handel in Deutschland präsentiert.
- Kapitel 2: Definition theoretischer Begrifflichkeiten - Dieses Kapitel liefert Definitionen für wichtige Begrifflichkeiten, die im Kontext des Online-Lebensmittelhandels relevant sind. Dazu gehören E-Commerce, Entwicklung des E-Commerce, Handel, stationärer Handel und Lebensmittel.
- Kapitel 3: Status Quo im Lebensmittelmarkt - In diesem Kapitel wird der aktuelle Stand des Lebensmittelmarktes in Deutschland, Großbritannien und Frankreich analysiert. Es werden relevante Statistiken und Daten zum Marktvolumen, den Marktanteilen und den Konsumgewohnheiten in den jeweiligen Ländern präsentiert.
- Kapitel 4: Geschäftsmodelle des Online-Lebensmittelhandels - Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Geschäftsmodellen, die im Online-Lebensmittelhandel zum Einsatz kommen. Es werden die spezifischen Strategien und Angebote der verschiedenen Anbieter beleuchtet.
- Kapitel 5: Begründung für geringe Verbreitung - Dieses Kapitel untersucht die Gründe für die bisherige geringe Verbreitung des Online-Lebensmittelhandels in Deutschland. Es werden wichtige Faktoren wie Konsumentenpräferenzen, Lieferkosten, Produktqualität und Kundenservice analysiert.
- Kapitel 6: Online Lebensmittelhandel in der Praxis - In diesem Kapitel werden verschiedene Praxisbeispiele für den Online-Lebensmittelhandel vorgestellt. Die Arbeit analysiert die Geschäftsmodelle, Strategien und Leistungen von Unternehmen wie Amazon Fresh, Rewe, Allyouneed Fresh und Edeka.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie E-Commerce, Online-Handel, Lebensmitteleinzelhandel, stationärer Handel, Konsumverhalten, Geschäftsmodelle, Marktentwicklung, Marktforschung, Wettbewerbsvorteile, Kundenerwartungen und Zukunftsprognosen.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Online-Handel eine Bedrohung für den stationären Lebensmittelhandel?
Die Arbeit untersucht, ob die Verschiebung der Umsätze zum E-Commerce existenzbedrohend für Supermärkte ist oder ob neue Chancen durch technologischen Wandel und verändertes Konsumverhalten entstehen.
Warum ist der Online-Lebensmittelhandel in Deutschland noch wenig verbreitet?
Wesentliche Barrieren sind hohe Lieferkosten, Bedenken hinsichtlich der Produktqualität (Frische), starke Präferenzen für den physischen Einkauf und ein bereits sehr dichtes Netz an stationären Discountern.
Welche Geschäftsmodelle gibt es im Online-Lebensmittelhandel?
Es wird zwischen reinen Online-Anbietern, Lieferdiensten stationärer Händler (z.B. Rewe, Edeka) und Marktplatz-Modellen wie Amazon Fresh unterschieden.
Wie unterscheidet sich der deutsche Markt von Großbritannien oder Frankreich?
In Ländern wie Großbritannien und Frankreich ist der Online-Anteil am Lebensmittelmarkt deutlich höher. Die Arbeit analysiert die strukturellen Unterschiede und warum Deutschland hier eine Sonderrolle einnimmt.
Welche Rolle spielt Amazon Fresh auf dem deutschen Markt?
Amazon Fresh wird als Praxisbeispiel für einen globalen Player analysiert, der mit hoher technologischer Kompetenz den Wettbewerbsdruck auf etablierte deutsche Supermarktketten erhöht.
Was sind die wichtigsten Trends im Lebensmitteleinzelhandel?
Zentrale Trends sind die Digitalisierung der Lieferkette, personalisierte Kundenansprache im E-Commerce und die Verknüpfung von Online- und Offline-Kanälen (Omnichannel).
- Quote paper
- Ediz Ergün (Author), 2018, Der Online-Handel als Bedrohung für den stationären Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445078