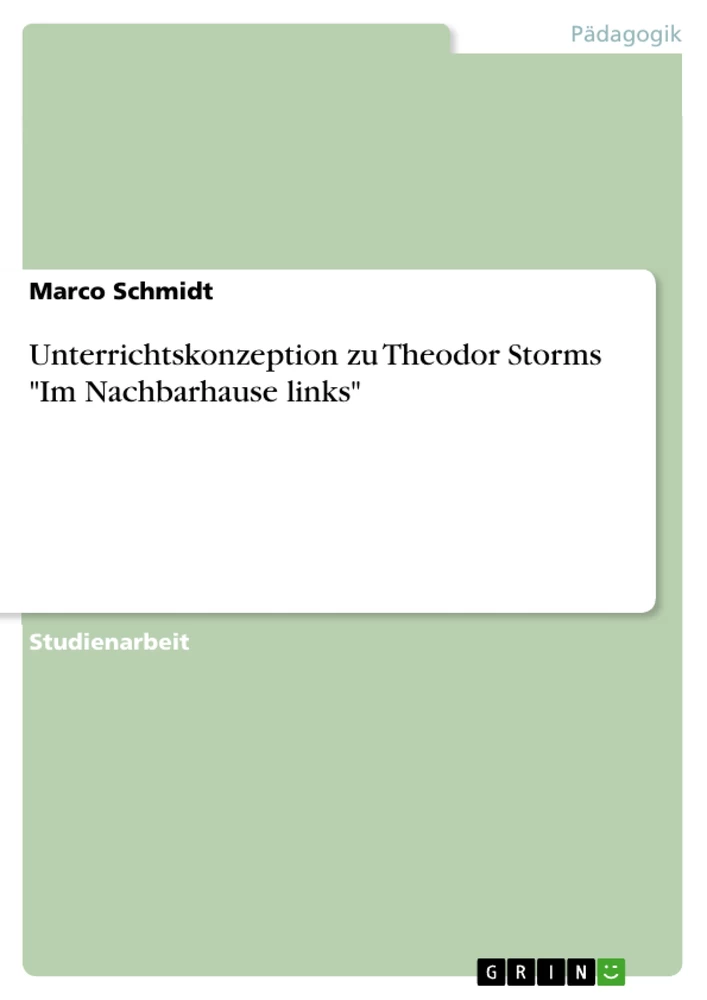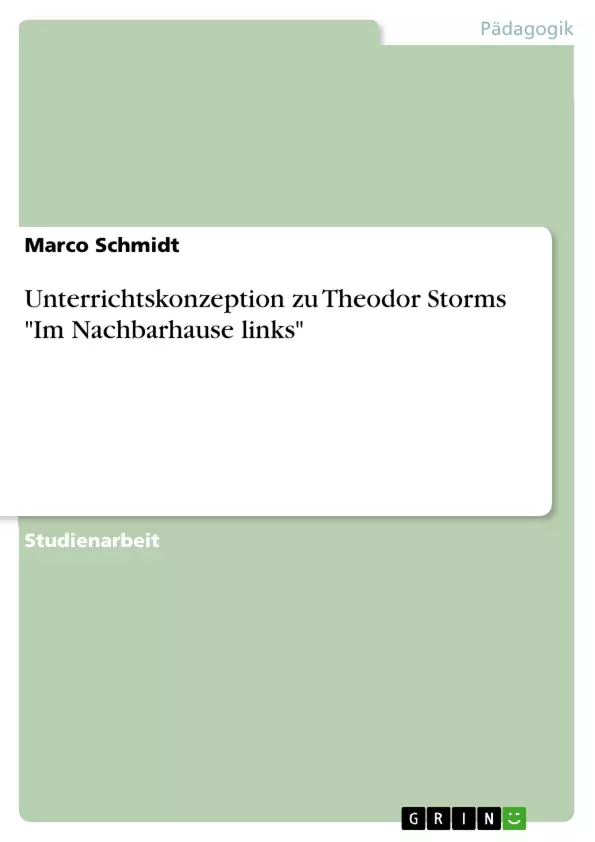In folgender Hausarbeit geht es um die Novelle "Im Nachbarhause links" und dessen Bedeutung für die Literaturdidaktik in der Schule. Exemplarisch wird anhand der Novelle von Theodor Storm eine Unterrichtskonzeption aufgezeigt, die sich auf eine Unterrichtseinheit zum Thema Realismus im Deutschunterricht der Oberstufe bezieht. Dabei wird geprüft, welche Bedeutung die Lektüre für den Deutschunterricht hat und inwiefern sie thematisiert werden kann. Die Unterrichtskonzeption bezieht sich auf die Kernkompetenzen und Lernziele der aktuellen Fachanforderungen des Landes Schleswig-Holsteins.
Zunächst wird noch einmal kurz der historische Hintergrund der Novelle dargestellt, bevor eine Sachanalyse diesem folgt. Anschließend wird auf die Literaturdidaktik in der Schule eingegangen und es werden didaktische Überlegungen aufgestellt. An dieser Stelle werden auch angestrebte Lernziele und Kernkompetenzen der Sekundarstufe II erläutert. Abschließend folgen methodische Überlegungen zur Umsetzung in der Schule und ein umfassendes Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Novelle „Im Nachbarhause links“
- Sachanalyse
- Epoche „Realismus“
- Didaktische Überlegungen
- Literaturdidaktik in der Schule
- Themenschwerpunkte Sekundarstufe II
- Zielsetzung der Konzeption
- Methodische Überlegungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtskonzeption hat zum Ziel, die Novelle „Im Nachbarhause links“ von Theodor Storm für den Deutschunterricht in der Oberstufe aufzuarbeiten. Die Konzeption konzentriert sich auf die didaktische Erschließung der Novelle und die Einbindung in den Themenbereich des Realismus. Ziel ist es, die Schüler*innen mit Storms Werk vertraut zu machen und ihnen ein tieferes Verständnis für die spezifischen Merkmale des Realismus zu vermitteln.
- Desillusionierung im 19. Jahrhundert
- Realismus als literarische Epoche
- Die Bedeutung von Gesellschaft und Individuum in Storms Werk
- Die Rolle der Sprache und der Figurenzeichnung im Realismus
- Didaktische Ansätze für die Lektüre in der Oberstufe
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Storms pessimistische Weltsicht dar und beleuchtet die Bedeutung des „Ekel“, den er gegenüber der Gesellschaft empfindet. Storm kritisiert die „grausame Welt“ und die Entwicklung der Gesellschaft hin zur Förderung der Starken und Eliminierung der Schwachen. Die Einleitung zeichnet bereits die Kernthemen der Novelle „Im Nachbarhause links“ vor, die später näher beleuchtet werden.
Zur Novelle „Im Nachbarhause links“
In diesem Kapitel wird die Novelle „Im Nachbarhause links“ als „Meilenstein auf der Straße der verlorenen Illusion“ (Böttger, 1959) vorgestellt. Der Fokus liegt auf Storms persönlicher Desillusionierung mit der gesellschaftlichen Entwicklung des 19. Jahrhunderts, insbesondere nach der Gründung des Deutschen Reiches. Die Novelle wird als „Desillusionierungsnovelle“ bezeichnet, welche neben anderen Werken wie „Carsten Curator“ und „Draußen im Heidedorf“ eine Kritik an der neuen Gesellschaftsordnung darstellt.
Sachanalyse
Dieser Abschnitt stellt die Novelle „Im Nachbarhause links“ näher vor und analysiert den Einstieg in die Geschichte. Storm lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf das Ende der Geschichte und rückt die Hauptfigur, den Stadtsekretär, ins Rampenlicht. Die Beschreibung des Settings und der beiden Häuser, das „rechte“ und das „linke“, vermittelt dem Leser bereits eine Abneigung gegenüber dem linken Haus und eine gewisse Annahme über die Bewohnerin, Frau Jansen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Theodor Storms Novelle 'Im Nachbarhause links'?
Die Novelle thematisiert die Desillusionierung und den gesellschaftlichen Verfall im 19. Jahrhundert, gespiegelt in der Geschichte einer einsamen Frau und ihres Hauses.
Warum wird das Werk als 'Desillusionierungsnovelle' bezeichnet?
Weil sie Storms pessimistische Sicht auf die gesellschaftliche Entwicklung nach der Reichsgründung zeigt, in der Schwache verdrängt und Ideale enttäuscht werden.
Welche Bedeutung hat die Epoche des Realismus für diese Novelle?
Die Novelle nutzt typisch realistische Merkmale wie die detailgetreue Darstellung der sozialen Wirklichkeit und die psychologische Figurenzeichnung.
Für welche Schulstufe ist diese Unterrichtskonzeption gedacht?
Die Konzeption richtet sich an den Deutschunterricht der Oberstufe (Sekundarstufe II).
Welche Lernziele werden mit der Behandlung des Werkes verfolgt?
Schüler sollen die Merkmale des Realismus erkennen, literarische Analysetechniken vertiefen und sich kritisch mit gesellschaftlichen Wandlungsprozessen auseinandersetzen.
- Quote paper
- Marco Schmidt (Author), 2018, Unterrichtskonzeption zu Theodor Storms "Im Nachbarhause links", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445092