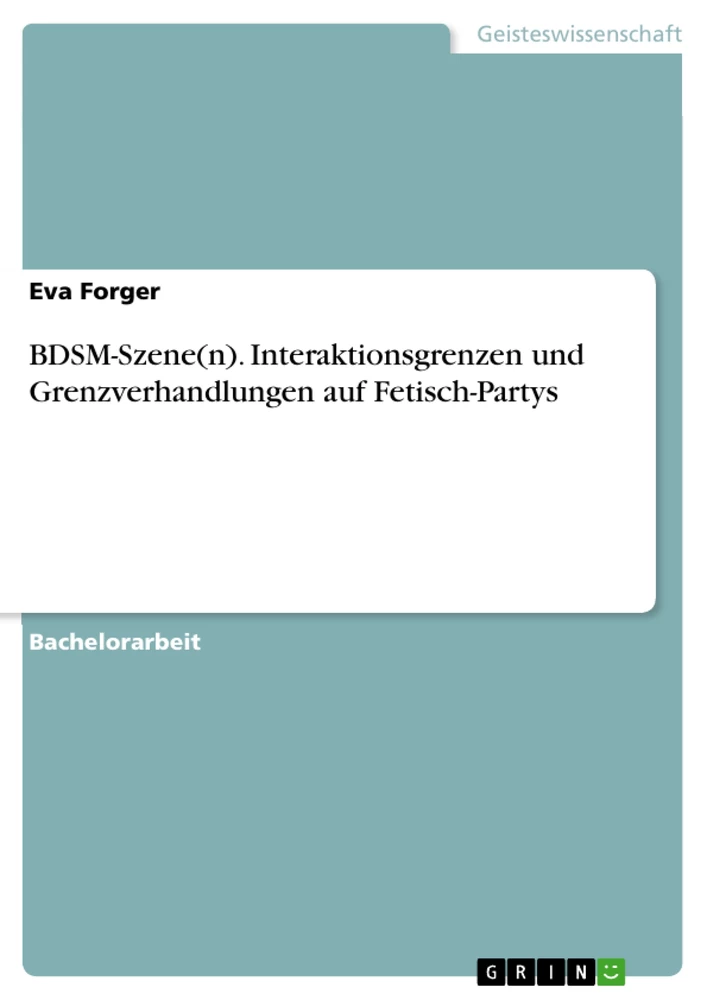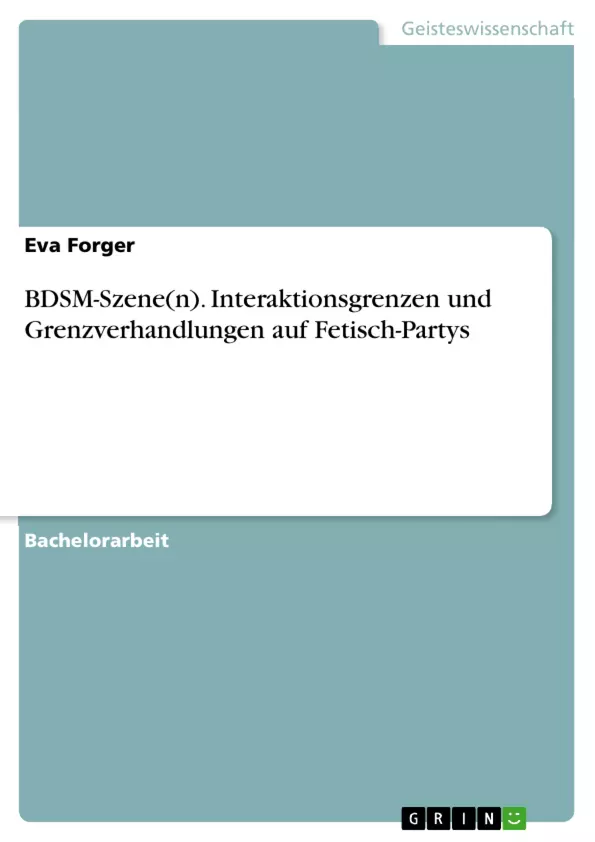In der vorliegenden Arbeit verbinde ich das gewonnene empirische Material über die BDSM-Szene mit dem theoretischen Modell von Erving Goffman zum Rollenverhalten in Interaktionen. Mein Ziel dabei ist, BDSM als soziales Phänomen zu definieren und aufzuzeigen, welche stereotypen Rollentypen die Interaktion im BDSM-Kontext be-stimmen sowie welche sozialen, räumlichen und zeitlichen Grenzen den Rahmen für die Interaktion setzen.
Wie sind Interaktionen während der Fetisch-Party aufgebaut? Welche Rollen gibt es, welchen Regeln unterliegen diese und welche Funktion erfüllen sie? Dies ist hier besonders an dem Punkt interessant, an dem die SM-Szene deutlich von der Mainstream-Gesellschaft abweicht: Während in der Mainstream-Gesellschaft allgemeingültige Werte und Normen vor Gewalt und verletzendem Verhalten schützen, da diese tabuisiert sind, findet sich ein vergleichbares Reglement in der BDSM-Szene so nicht. Da die ‚normalen‘ Tabu-Grenzen aufgehoben sind, entsteht die Begrenzung und Regulierung von Gewalt anders: Hier ist es extrem wichtig, seine Rolle und die daran geknüpften Erwartungen zu kennen und ihnen zu entsprechen, um Gefahr für sich und andere zu vermeiden. So zeigt sich, dass auch – und gerade dort - in gesellschaftlich devianten Bereichen wie der BDSM-Szene rollenentsprechendes Verhalten die Grundlage einer funktionierenden Interaktion darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffliche und theoretische Grundlagen: Goffmans Rollen-Theorie
- 2.1. Der Untersuchungsgegenstand: Was ist BDSM überhaupt?
- 2.1.1. BDSM als Szene
- 2.1.2. Die Fetisch-Party
- 2.2. Bisheriger Stand der Forschung zur BDSM-Szene
- 3. Empirische Untersuchung der BDSM-Szene im Club „Grande Opera“
- 4. Betrachtung und Analyse von Interaktion auf Fetisch-Partys unter rollentheoretischen Gesichtspunkten
- 4.1. Das dichotome Ordnungssystem der BDSM-Szene: Top und Bottom
- 4.2. Weitere Rollen auf Partys der BDSM-Szene
- 4.3. Die Spiel-Interaktion unter rollentheoretischen Gesichtspunkten
- 4.4. Schutz des Selbst und des Anderen in der BDSM-Szene: BDSM-Praktiken als Spiel
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die BDSM-Szene auf Fetisch-Partys, insbesondere die Interaktionsgrenzen und -verhandlungen. Ziel ist es, BDSM als soziales Phänomen zu verstehen und die Rolle von Goffmans Rollentheorie in diesem Kontext zu analysieren.
- Definition von BDSM als soziales Phänomen
- Analyse der Rollentypen und deren Interaktion auf Fetisch-Partys
- Untersuchung der Regeln und Grenzen der Interaktion
- Die Bedeutung von Rollenverhalten für die Sicherheit der Teilnehmer
- Die Konstruktion einer legitimen Verbindung zwischen Erotik und Gewalt im BDSM-Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema BDSM ein und stellt die Frage nach der sozialen Organisation und den Interaktionsmechanismen innerhalb der BDSM-Szene. Sie problematisiert die Einordnung von Sadomasochismus als psychische Störung und betont den soziologischen Aspekt des Phänomens. Die Autorin beschreibt ihr Forschungsinteresse an den sozialen Interaktionen auf Fetisch-Partys und skizziert den Aufbau der Arbeit, in dem sie ihre methodische Vorgehensweise sowie die Verwendung bestehender Literatur erläutert und den Fokus auf Fetisch-Partys als Untersuchungsgegenstand begründet.
2. Begriffliche und theoretische Grundlagen: Goffmans Rollen-Theorie: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert BDSM und die Fetisch-Party als Untersuchungsgegenstände und präsentiert Goffmans Rollentheorie als analytisches Rahmenwerk. Es gibt einen Überblick über den bisherigen Forschungsstand zu BDSM und positioniert die Arbeit im Kontext der bestehenden Literatur. Der Fokus liegt auf der Anwendung von Goffmans Theorie zur Analyse von Interaktion in einem Kontext, in dem die gesellschaftlichen Normen bezüglich Gewalt und Macht neu verhandelt werden.
3. Empirische Untersuchung der BDSM-Szene im Club „Grande Opera“: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Methode der Studie. Die Autorin erläutert, wie sie ihre Daten im Club „Grande Opera“ gesammelt und ausgewertet hat. Es bietet einen Einblick in die methodische Vorgehensweise und die Datenerhebung, aber enthalt keine detaillierte Darstellung der Ergebnisse, welche in den folgenden Kapiteln analysiert werden.
4. Betrachtung und Analyse von Interaktion auf Fetisch-Partys unter rollentheoretischen Gesichtspunkten: In diesem zentralen Kapitel werden die empirischen Ergebnisse unter Anwendung von Goffmans Rollentheorie analysiert. Es untersucht die verschiedenen Rollentypen innerhalb der BDSM-Szene auf Fetisch-Partys (z.B. Top und Bottom), die an diese Rollen geknüpften Erwartungen und die Funktion der Rollen für die Interaktion. Die Analyse beleuchtet die Mechanismen, die die Interaktion regulieren und die Sicherheit der Teilnehmer gewährleisten, trotz des Kontextes von Macht, Gewalt und Grenzüberschreitung. Das Kapitel untersucht, wie die "normalen" gesellschaftlichen Tabus in der BDSM-Szene durch ein System von Rollen und Regeln ersetzt werden.
Schlüsselwörter
BDSM, Fetisch-Party, Interaktion, Rollentheorie, Goffman, Soziale Interaktion, Grenzen, Macht, Gewalt, Subkultur, Soziologie, Ethnologie, Empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Interaktionsgrenzen und -verhandlungen in der BDSM-Szene"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die BDSM-Szene auf Fetisch-Partys, insbesondere die Interaktionsgrenzen und -verhandlungen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von BDSM als soziales Phänomen und der Analyse der Rolle von Goffmans Rollentheorie in diesem Kontext.
Welche konkreten Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition von BDSM als soziales Phänomen; Analyse der Rollentypen und deren Interaktion auf Fetisch-Partys; Untersuchung der Regeln und Grenzen der Interaktion; die Bedeutung von Rollenverhalten für die Sicherheit der Teilnehmer; und die Konstruktion einer legitimen Verbindung zwischen Erotik und Gewalt im BDSM-Kontext.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf Goffmans Rollentheorie, die als analytisches Rahmenwerk dient, um die Interaktionen innerhalb der BDSM-Szene zu verstehen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffliche und theoretische Grundlagen (inkl. Goffmans Rollentheorie und bisherigen Forschungsstand), Empirische Untersuchung der BDSM-Szene im Club „Grande Opera“, Betrachtung und Analyse von Interaktion auf Fetisch-Partys unter rollentheoretischen Gesichtspunkten, und Fazit und Ausblick.
Wo wurde die empirische Forschung durchgeführt?
Die empirische Untersuchung fand im Club „Grande Opera“ statt.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit beschreibt die empirische Methode der Studie, inklusive der Datenerhebung und -auswertung im Club „Grande Opera“. Details zur konkreten Vorgehensweise und den Ergebnissen werden in den entsprechenden Kapiteln erläutert.
Welche zentralen Ergebnisse werden präsentiert?
Das zentrale Kapitel analysiert die empirischen Ergebnisse unter Anwendung von Goffmans Rollentheorie. Es untersucht verschiedene Rollentypen (z.B. Top und Bottom), die an diese Rollen geknüpften Erwartungen und die Funktion der Rollen für die Interaktion. Die Analyse beleuchtet die Mechanismen, die die Interaktion regulieren und die Sicherheit der Teilnehmer gewährleisten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: BDSM, Fetisch-Party, Interaktion, Rollentheorie, Goffman, Soziale Interaktion, Grenzen, Macht, Gewalt, Subkultur, Soziologie, Ethnologie, Empirische Forschung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studierende der Soziologie, Ethnologie und verwandter Disziplinen, die sich für soziale Interaktion, Subkulturen und die Anwendung soziologischer Theorien auf nicht-mainstream-Kontexte interessieren.
Welche Fragen bleiben offen?
Das Fazit und der Ausblick werden offene Fragen und mögliche zukünftige Forschungsansätze adressieren.
- Quote paper
- Eva Forger (Author), 2017, BDSM-Szene(n). Interaktionsgrenzen und Grenzverhandlungen auf Fetisch-Partys, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445096