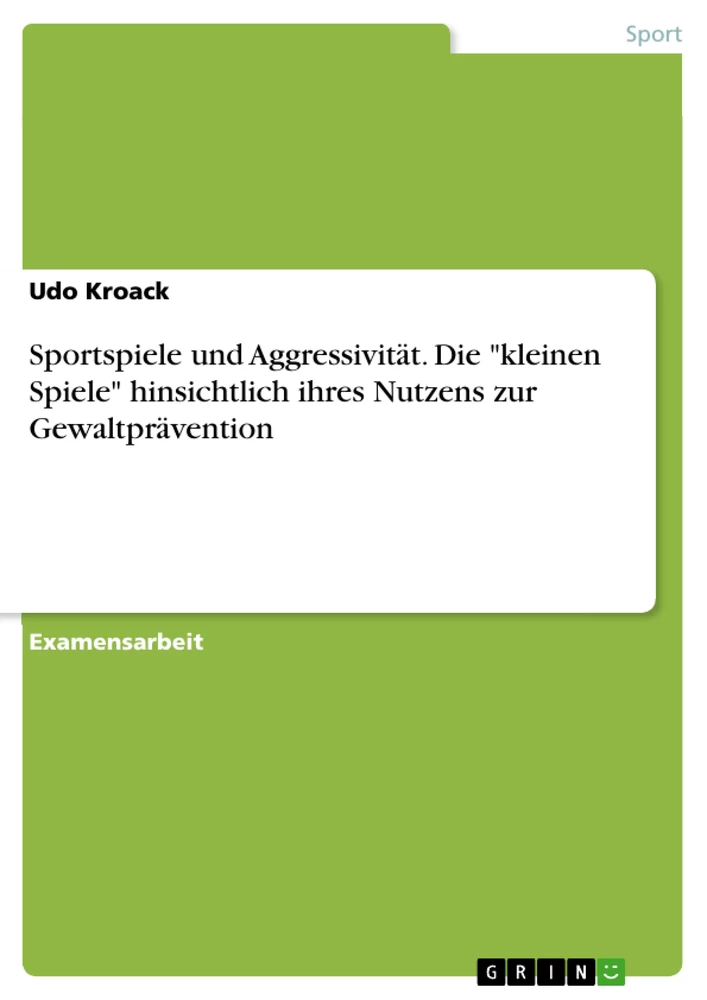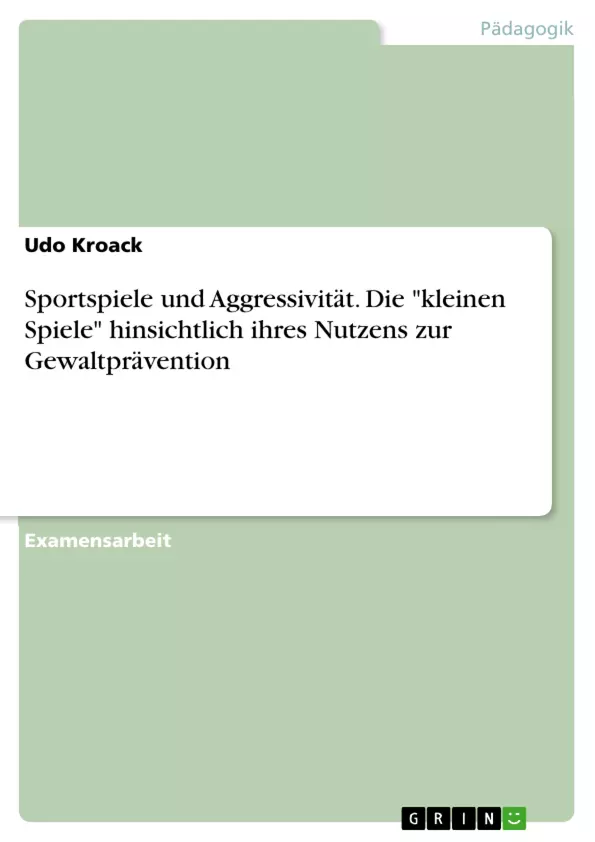Gewalt und Aggression sind allgegenwärtig. Neben den in den Medien erscheinenden offensichtlichen Erscheinungsformen wie Krieg, Kriminalität, ausländerfeindlichen Aktionen, sexuellem Missbrauch etc. gibt es im Alltag unzählige weniger auffällige: Aggressionen im Straßenverkehr, in der Familie, in der Berufswelt (Mobbing), in der Schule, im Sport und subtilere Formen der psychischen Aggression.
Fast täglich berichten die Medien von aggressiven Übergriffen junger Menschen. Hierbei lässt sich feststellen, dass nicht nur die Zahl der Gewalttaten steigt, sondern vor allem die Qualität der Aggressionen sich verändert hat. Viele aggressive Verhaltensweisen werden in unserer modernen „Ellbogengesellschaft“ akzeptiert und von Erwachsenen vorgelebt. Nach HURRELMANN zeigen aktuelle Studien, „dass 10 -12% der Kinder im Schulalter an psychischen Störungen vor allem in den Bereichen Leistung, Emotion und Sozialkontakt leiden. Dazu gehören auch aggressive und gewalthaltige Verhaltensweisen […] wobei offenbar an Hauptschule und Berufsschulen die meisten Probleme wahrgenommen werden“.
Nicht nur weil die Schule von der zunehmenden Aggressivität besonders betroffen ist, sondern vor allem wegen ihres großen Einflusses auf die Kinder ist es sinnvoll, hier mit der Bekämpfung der Aggressivität zu beginnen. Die jetzigen und zukünftigen Lehrer werden besonders im pädagogischen Bereich gefordert sein. Eine wichtige Rolle bei dieser Aufgabe spielen dabei die Sportlehrer, zum einen, weil aggressives Verhalten im Sportunterricht mehr als in anderen Fächern offen auftritt, zum anderen, weil der Sportunterricht eine gute Möglichkeit bietet, die Schüler emotional geöffnet und engagiert zu treffen und sie so positiv zu beeinflussen. Diese Überlegung spiegelt sich auch im Lehrplan des Faches Sport wider: Erziehung zur Fairness und Kooperation sind als wichtige Ziele aufgeführt und sollen auch in die Benotung einfließen. Um Sozialerziehung mit Erfolg durchzuführen, benötigt man Formen des Sports, die gewünschte Verhaltensweisen fördern. Ein schier unerschöpfliches Repertoire bieten die so genannten „Kleinen Spiele“.
In dieser Arbeit sollen die relevanten theoretischen Grundlagen angeführt werden, bevor im anschließenden Teil eine Neuordnung hinsichtlich des aggressiven Gehalts der „Kleinen Spiele“ erfolgt. Zusätzlich wird noch ein Vorschlag einer progressiven Abfolge ausgewählter Spiele, die zur Erziehung zum Umgang mit Aggressionen sinnvoll erscheinen, ausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Problemstellung
- I. Theoretischer Grundlagenteil
- 1. Begriffsklärung „Aggression“
- 2. Konzepte zur Erklärung von Aggression
- 2.1. Triebdynamisches/ Instinkttheoretisches Aggressionsverständnis
- 2.2. Die Frustrations-Aggressions-Hypothese
- 2.3. Lerntheorethische Deutungsansätze
- 3. Katharsis durch Sport ?
- 4. Vorüberlegungen zum Einsatz der Kleinen Spiele im Sportunterricht
- II. Praktischer Teil
- 1. Begriffliche Eingrenzung „Kleine Spiele“
- 2. Kurzbeschreibung der verschiedenen Spieltypen nach der Systematik von E. und H. DÖBLER
- 3. Auswahl der Kriterien zur Neueinteilung der „Kleinen Spiele“
- 4. Neuordnung der Spielesammlung von E. und H. DÖBLER
- 5. Einteilung nach pädagogischen Kriterien
- 5.1. Kooperationsfördernde Spiele
- 5.2. Spiele zum Umgang mit Aggressionen
- 5.3. Pädagogisch bedenkliche Spiele
- III. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die pädagogischen Möglichkeiten von „Kleinen Spielen“ im Sportunterricht, um Kinder und Jugendliche im Umgang mit Aggressionen zu fördern und sie zu kooperativem Verhalten anzuregen.
- Thematisierung der Bedeutung von Sport und Spiel für die Sozialerziehung
- Analyse verschiedener Konzepte zur Erklärung von Aggression
- Systematische Einordnung und Neuordnung von „Kleinen Spielen“ nach pädagogischen Kriterien
- Entwicklung eines didaktisch sinnvollen Spielangebots zur Förderung kooperativen Verhaltens und des Umgangs mit Aggressionen
- Relevanz des Themas im Kontext der steigenden Aggressivität in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Problemstellung: Die Arbeit führt zunächst das Problem der zunehmenden Aggressivität von Kindern und Jugendlichen in der heutigen Gesellschaft aus. Sie betont die Rolle des Sports und des Sportunterrichts in der Sozialerziehung und die Notwendigkeit, angemessene Methoden zur Bekämpfung von Aggression zu entwickeln.
- Theoretischer Grundlagenteil: Der theoretische Teil der Arbeit befasst sich mit dem Begriff der Aggression und verschiedenen Konzepten zur Erklärung aggressiven Verhaltens. Dies umfasst die Triebtheorie, die Frustrations-Aggressions-Hypothese und lerntheoretische Ansätze. Des Weiteren wird die Frage untersucht, ob Sport eine Katharsis für aggressive Impulse bieten kann.
- Praktischer Teil: Der praktische Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Definition und Einordnung von „Kleinen Spielen“ im Sportunterricht. Es werden verschiedene Spieltypen nach der Systematik von E. und H. DÖBLER vorgestellt und anhand pädagogischer Kriterien neugeordnet. Die Arbeit gliedert die Spiele in drei Kategorien: kooperationsfördernde Spiele, Spiele zum Umgang mit Aggressionen und pädagogisch bedenkliche Spiele.
Schlüsselwörter
Aggression, Sportunterricht, „Kleine Spiele“, pädagogische Kriterien, Sozialerziehung, Kooperation, Aggressionstraining, Spielformen, didaktische Ordnung, Lehrplan, Verhaltensauffälligkeiten, Kinder, Jugendliche.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen „Kleine Spiele“ bei der Gewaltprävention?
„Kleine Spiele“ bieten ein Repertoire, um kooperatives Verhalten zu fördern und Schülern einen kontrollierten Umgang mit Aggressionen in einem emotional engagierten Umfeld zu ermöglichen.
Welche Aggressionstheorien werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit erläutert das triebdynamische Verständnis, die Frustrations-Aggressions-Hypothese sowie lerntheoretische Deutungsansätze.
Bietet Sport eine „Katharsis“ für aggressive Impulse?
Die Arbeit untersucht kritisch die Frage, ob Sport als Ventil für Aggressionen dienen kann (Katharsis-Hypothese) oder ob er aggressives Verhalten eher verstärkt.
Wie werden die Spiele in dieser Arbeit neu geordnet?
Die Spiele werden nach pädagogischen Kriterien in kooperationsfördernde Spiele, Spiele zum Umgang mit Aggressionen und pädagogisch bedenkliche Spiele unterteilt.
Warum ist der Sportunterricht besonders für Sozialerziehung geeignet?
Da aggressives Verhalten hier oft offen auftritt, können Sportlehrer Schüler in emotionalen Momenten direkt erreichen und Fairness sowie Kooperation praktisch einüben.
- Quote paper
- Udo Kroack (Author), 1998, Sportspiele und Aggressivität. Die "kleinen Spiele" hinsichtlich ihres Nutzens zur Gewaltprävention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4452