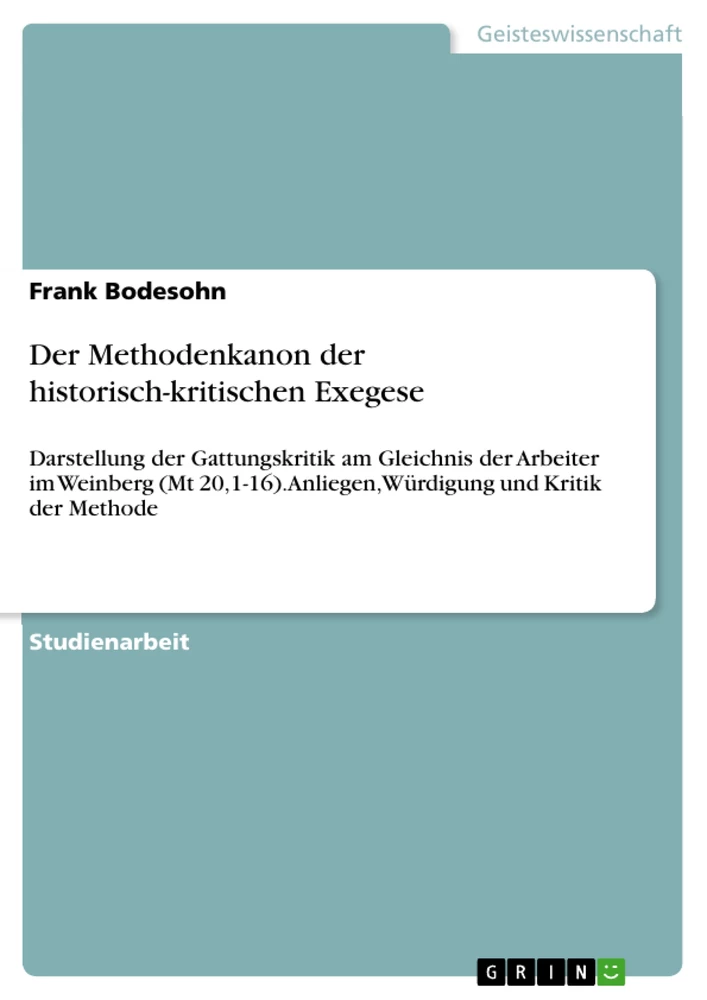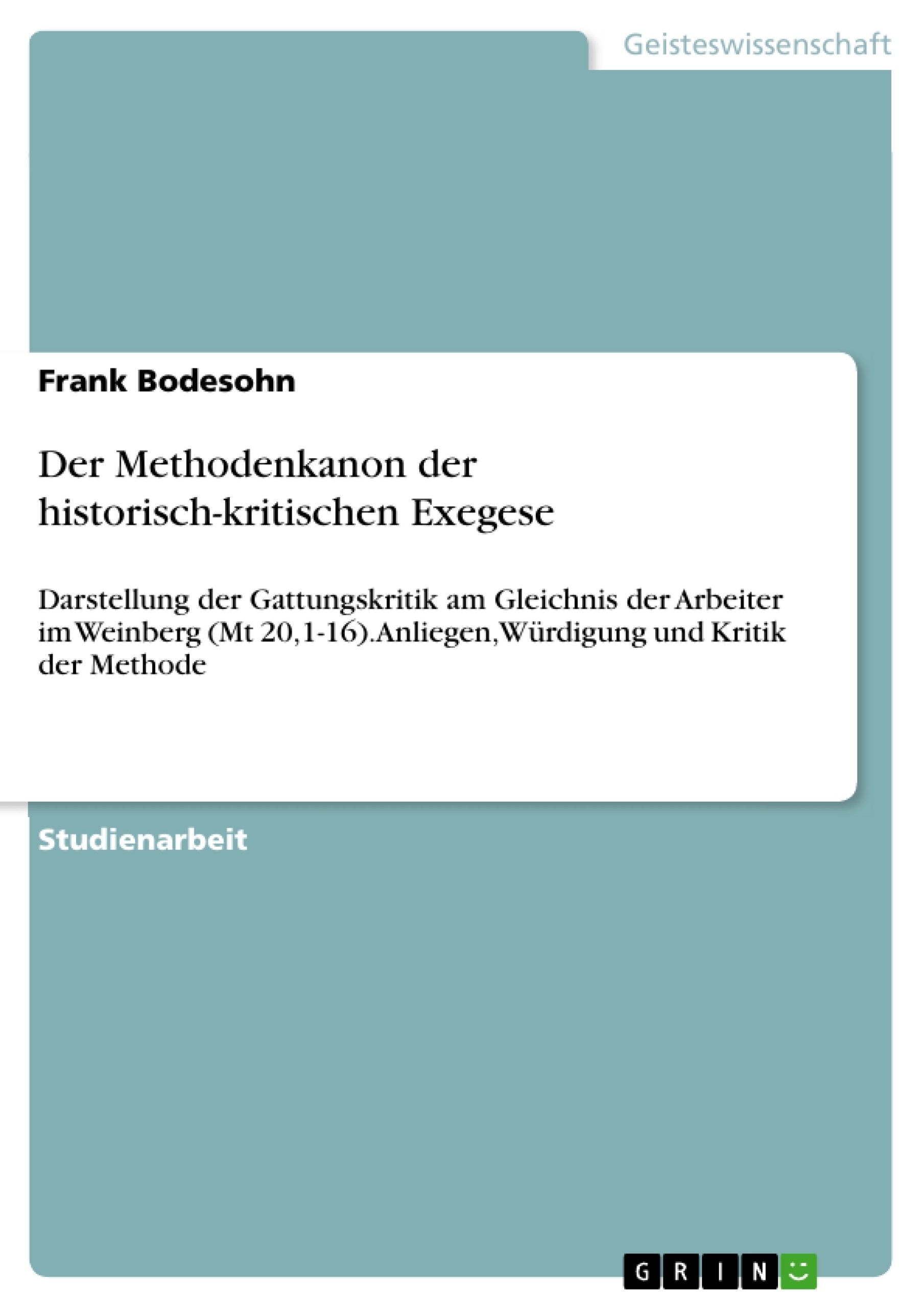Das Christentum ist eine Schriftreligion, die heilige Schrift der Christen ist die Bibel. In der Geschichte des Christentums sind diese Texte auf unterschiedliche Weise ausgelegt worden. Ziel der Auslegung (Exegese) der Schrift ist das Verstehen. Bezüglich der Art und Weise des Zugangs zu den biblischen Texten gibt es unterschiedliche Methoden, die in der Geschichte des Christentums unterschiedlich angewendet und beurteilt worden sind.
Folgend sei als ein möglicher exegetischer Zugang der historisch-kritische Methodenkanon vorgestellt und exemplarisch das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg (Mt 20,1-16) gattungskritisch ausgelegt sowie Vor- und Nachteile der Methode und ihrer (ausschließlichen) Anwendung diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Anliegen der historisch-kritischen Exegese
- Geschichtlich gewordener Glaube
- Patristische und mittelalterliche Exegese
- Exegese der Neuzeit - auf der Suche nach dem Ursprung der Texte
- Der Methodenkanon der historisch-kritischen Exegese
- Textkritik
- Die Gattungskritik am Beispiel der „Arbeiter im Weinberg“
- Inhalt des Gleichnisses
- Gattungsbestimmung
- Würdigung und neue Erkenntnisse
- Verdienst und Kritik der historisch-kritischen Exegese
- Kanonische Exegese
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, den Methodenkanon der historisch-kritischen Exegese darzustellen und anhand des Gleichnisses der Arbeiter im Weinberg (Mt 20,1-16) zu erläutern. Dabei werden die Vor- und Nachteile dieser Methode diskutiert und in den Kontext der Geschichte der Bibelauslegung eingeordnet.
- Historisch-kritische Exegese als Methode der Bibelauslegung
- Entwicklung der Bibelauslegung von der patristischen bis zur neuzeitlichen Exegese
- Gattungskritik als Teil des Methodenkanons der historisch-kritischen Exegese
- Anwendung der Gattungskritik auf das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg
- Würdigung und Kritik der historisch-kritischen Exegese
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bibelauslegung ein und stellt die historisch-kritische Exegese als einen möglichen Zugang zu den biblischen Texten vor. Sie skizziert das Anliegen der Arbeit, nämlich die Darstellung und exemplarische Anwendung des Methodenkanons der historisch-kritischen Exegese am Gleichnis der Arbeiter im Weinberg, sowie die kritische Auseinandersetzung mit der Methode.
Das Anliegen der historisch-kritischen Exegese: Dieses Kapitel beschreibt das Ziel der historisch-kritischen Exegese, den Sinn biblischer Texte zu erforschen. Es betont die Notwendigkeit einer zeitgemäßen Interpretation aufgrund der großen zeitlichen Distanz zwischen der Entstehung der Texte und der Gegenwart. Die Entwicklung des Verständnisses der Bibel über die Jahrhunderte wird skizziert, beginnend mit dem Fokus auf Einheitlichkeit und Inspiration in der patristischen und mittelalterlichen Exegese bis hin zur Neuzeit, in der die Genese und Autorintention der Texte verstärkt ins Zentrum der Betrachtung rückt. Der Abschnitt beleuchtet die Herausforderungen und die kritische Begleitung durch das kirchliche Lehramt. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Bibel als geschichtlich gewachsenes Dokument.
Die Gattungskritik am Beispiel der „Arbeiter im Weinberg“: Dieses Kapitel widmet sich der Anwendung der Gattungskritik auf das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Es wird den Inhalt des Gleichnisses analysiert und dessen Gattung bestimmt. Durch die Analyse der literarischen Form und des Kontextes soll ein tieferes Verständnis des Sinns des Gleichnisses erreicht werden. Die Zusammenfassung dieses Kapitels würde die spezifischen Ergebnisse der Gattungsanalyse und deren Bedeutung für die Interpretation des Gleichnisses erläutern.
Würdigung und neue Erkenntnisse: Dieses Kapitel bewertet die Verdienste und die Kritikpunkte der historisch-kritischen Exegese. Es wird die Bedeutung dieser Methode für das Verständnis biblischer Texte gewürdigt, aber auch deren Grenzen und potentielle Schwächen diskutiert. Ein Vergleich mit anderen Auslegungsmethoden, wie beispielsweise der kanonischen Exegese, könnte ein zentraler Bestandteil dieses Kapitels sein und die Ergebnisse dieses Vergleichs fließen in die Zusammenfassung ein.
Schlüsselwörter
Historisch-kritische Exegese, Bibelauslegung, Gleichnis der Arbeiter im Weinberg, Gattungskritik, Textkritik, Patristik, Mittelalter, Neuzeit, Kanonische Exegese, Hermeneutik, Wort Gottes, Autorintention, Entstehungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Historisch-kritische Exegese am Beispiel des Gleichnisses der Arbeiter im Weinberg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die historisch-kritische Exegese als Methode der Bibelauslegung. Sie erläutert den Methodenkanon anhand des Gleichnisses der Arbeiter im Weinberg (Mt 20,1-16) und diskutiert Vor- und Nachteile dieser Methode im Kontext der Geschichte der Bibelauslegung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Bibelauslegung von der Patristik bis zur Neuzeit, die historisch-kritische Exegese als Methode, die Gattungskritik als Teil dieser Methode, die Anwendung der Gattungskritik auf das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg sowie eine Würdigung und Kritik der historisch-kritischen Exegese im Vergleich zu anderen Methoden (z.B. kanonische Exegese).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Anliegen der historisch-kritischen Exegese (inkl. Textkritik und der Entwicklung der Exegese über die Jahrhunderte), ein Kapitel zur Gattungskritik am Beispiel des Gleichnisses der Arbeiter im Weinberg (inkl. Inhalts- und Gattungsanalyse), ein Kapitel zur Würdigung und neuen Erkenntnissen (inkl. Vergleich mit der kanonischen Exegese) und einen Ausblick.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Darstellung und exemplarische Anwendung des Methodenkanons der historisch-kritischen Exegese am Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Die Arbeit zielt auf eine kritische Auseinandersetzung mit der Methode und deren Einordnung in die Geschichte der Bibelauslegung ab.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit wendet die historisch-kritische Exegese, insbesondere die Gattungskritik, an. Sie analysiert den Text des Gleichnisses und untersucht dessen literarische Form und Kontext, um zu einem tieferen Verständnis des Sinns zu gelangen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Historisch-kritische Exegese, Bibelauslegung, Gleichnis der Arbeiter im Weinberg, Gattungskritik, Textkritik, Patristik, Mittelalter, Neuzeit, Kanonische Exegese, Hermeneutik, Wort Gottes, Autorintention, Entstehungsgeschichte.
Welche Zusammenfassung der Kapitel gibt es?
Die Einleitung führt in die Thematik ein. Das Kapitel zur historisch-kritischen Exegese beschreibt deren Ziel und Entwicklung. Das Kapitel zur Gattungskritik analysiert das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Das Kapitel zur Würdigung und neuen Erkenntnissen bewertet die Vor- und Nachteile der historisch-kritischen Exegese und vergleicht sie mit anderen Methoden.
- Quote paper
- Frank Bodesohn (Author), 2018, Der Methodenkanon der historisch-kritischen Exegese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445216