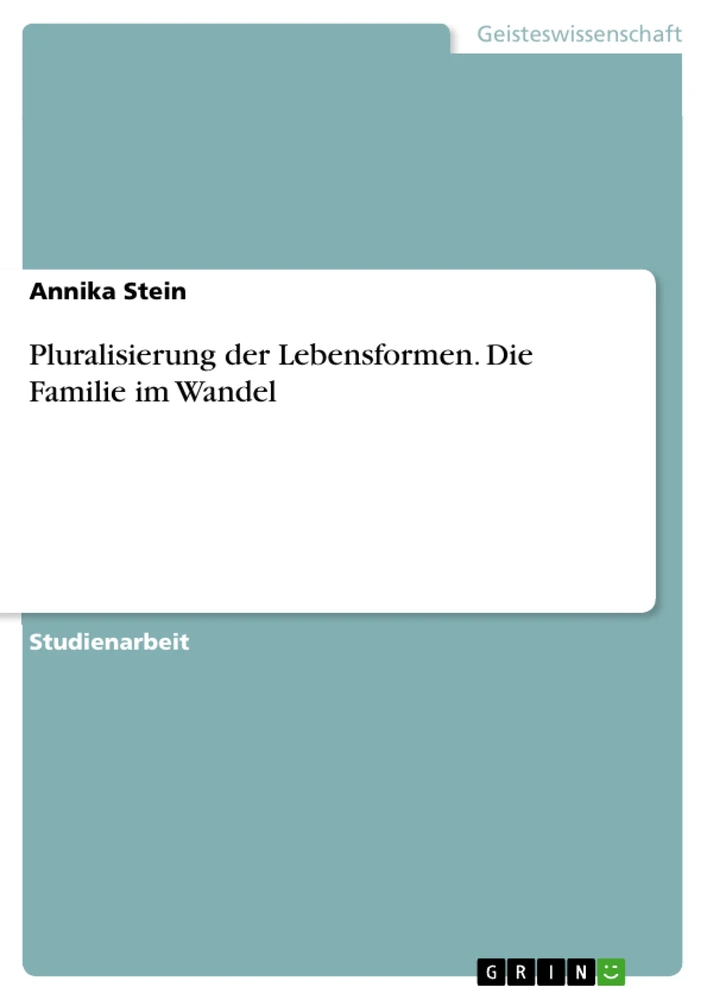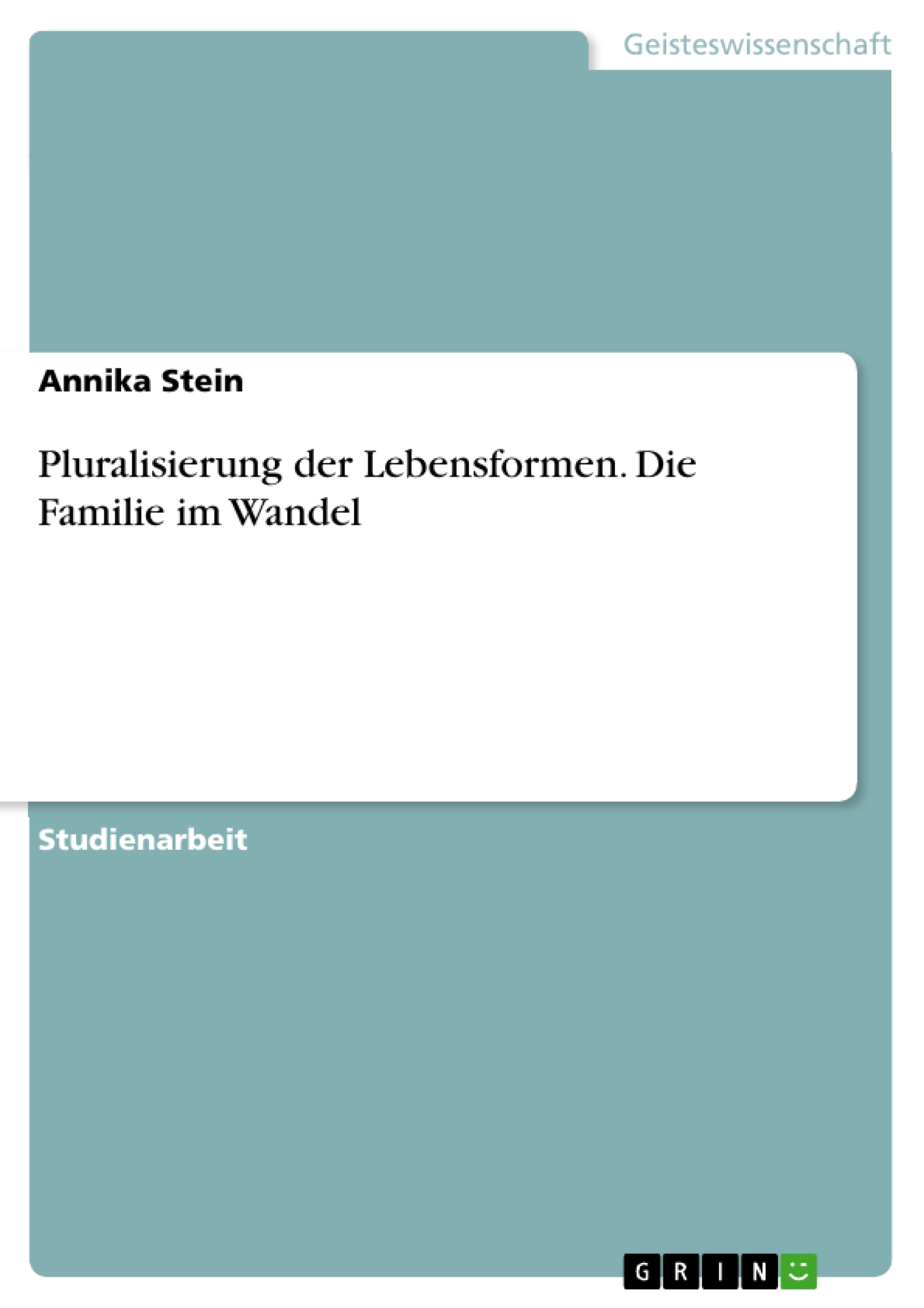Die Institution Familie unterliegt seit Mitte der 60er Jahre ausgeprägten Wandlungsprozessen. Zahlreiche Sozialwissenschaftler sind der Überzeugung, die Familie und Ehe durchlebe derzeit eine Krise. Andere stehen der Krisenrede kritisch gegenüber und lehne diese ab. Sie betonen stattdessen die Stabilität und Kontinuität dieser Institutionen. Die Debatte um eine mögliche Krise erschwert die Tatsache, dass beide Positionen über empirisch belegbares Material verfügen.
Dieselben empirischen Belege werden für die eigene Argumentation verwendet. Die Art und Weise, wie empirisches Material gewertet wird, ist also in diesem Fall vom eigenen Standpunkt abhängig und unterliegt der eigenen Interpretation.
Bevor ein Urteil gefällt werden kann, müssen die aktuellen Veränderungen im Bereich der familiären Lebensformen, vor dem Hintergrund der historischen Situation in der Nachkriegszeit betrachtet werden. Die Mitte der 50er bis Mitte der 1960er Jahre zeichnet sich durch die einmalige Dominanz nur einer spezifischen Lebensform aus. Nie zuvor in der Geschichte Deutschlands war das der Fall. Möglicherweise erscheint deshalb vielen die gegenwärtige Zeit als besonders krisenhaft. Das ungewöhnlich homogene Bild der bürgerlichen Familie, das aus einem Ehepaar und deren leiblichen Kindern besteht, galt als unhinterfragtes Leitbild der Gesellschaft. Auch wenn heutzutage noch die Mehrheit in konventionellen Familienverbänden lebt, so haben sich durch den sozialen Wandel weitere Lebensformen gebildet. Merkmale dieser gesellschaftlichen Veränderungen sind unter anderem die sinkende Geburtenrate, die in allen entwickelten Industriestaaten zu verzeichnen ist. Überdies werden mehr Ehen geschieden und generell seltener geheiratet. Es entstehen neue Haushaltstypen aus nichtehelichen, kinderlosen und gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Der Verlust der Monopolstellung von Ehe und Familie wird begleitet von einem Anstieg der Alleinerziehenden und Stieffamilien.
Im Allgemeinen ist ein Zuwachs an Optionsmöglichkeiten und Handlungsspielräumen erkennbar. Es soll in der Arbeit besonders der Wandel von Familie und Ehe herausgestellt werden. Folgende Forschungsfrage wird untersucht: Ist eine Pluralisierung an Lebensformen erkennbar und wenn ja, wie beeinflusst sie die Institutionen Ehe und Familie?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pluralisierung der Lebensformen
- Entstehungs- und Erklärungsversuche
- Theorien
- Differenzierungstheorie
- Deinstitutionalisierung der Familie
- Individualisierungsthese
- Familie im Wandel
- Sozialform des „ganzen Hauses“
- Bürgerliche Familie
- Familie heute
- Merkmale der Pluralisierung
- Geburtenrate
- Rückgang der Eheschließungen
- Mehr Scheidungen
- Neue Lebensformen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel von Ehe und Familie im Kontext der Pluralisierung von Lebensformen. Sie beleuchtet die Entstehung und die verschiedenen Erklärungsansätze für diese Pluralisierung, analysiert historische Veränderungen der Familienstrukturen und beschreibt die Merkmale dieser Pluralisierung anhand von Daten zu Eheschließungen, Scheidungen und neuen Lebensformen. Der Fokus liegt auf dem Wandel der Institution Familie und Ehe selbst, wobei geschlechtsspezifische Veränderungen und demografische Aspekte wie die Geburtenrate ausgeblendet werden.
- Pluralisierung von Lebensformen und deren Ursachen
- Historischer Wandel der Familienstrukturen
- Merkmale der Pluralisierung (Eheschließungen, Scheidungen, neue Lebensformen)
- Theorien zur Erklärung der Pluralisierung (Differenzierung, Deinstitutionalisierung, Individualisierung)
- Einfluss der Pluralisierung auf die Institutionen Ehe und Familie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel der Institution Familie seit Mitte der 60er Jahre und die kontroverse Debatte um eine mögliche "Krise" der Familie. Sie betont die unterschiedliche Interpretation empirischer Daten und die Notwendigkeit, den Wandel vor dem Hintergrund der historisch einmaligen Homogenität der Familienstrukturen in der Nachkriegszeit zu betrachten. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach der Erkennbarkeit einer Pluralisierung von Lebensformen und deren Einfluss auf Ehe und Familie.
Pluralisierung der Lebensformen: Dieses Kapitel untersucht den Begriff der Pluralisierung und verschiedene Erklärungsansätze. Es beleuchtet die Entstehung neuer Lebensformen im Kontext sinkender Heirats- und Geburtenraten sowie steigender Einpersonenhaushalte und nichtehelicher Lebensgemeinschaften. Es werden unterschiedliche wissenschaftliche Positionen zur Pluralisierungsthese diskutiert, von Befürwortern bis hin zu skeptischen Vertretern, die die Übertragbarkeit der These auf alle Bevölkerungsgruppen in Frage stellen. Der Kapitel diskutiert die Herausforderungen bei der Beurteilung der Pluralisierung aufgrund der vielschichtigen Interpretation empirischer Daten und erwähnt die Bedeutung des Werkes von Ulrich Beck "Risikogesellschaft" für die Debatte.
Familie im Wandel: Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung der Familie, von der Sozialform des „ganzen Hauses“ über die bürgerliche Familie bis hin zur Familie heute. Es beleuchtet die Veränderungen in den Familienstrukturen über die Jahrzehnte hinweg und beschreibt die komplexen Entwicklungen, die zu den gegenwärtigen vielfältigen Familienformen geführt haben. Obwohl die konventionelle Familienform weiterhin die Mehrheit darstellt, werden die verschiedenen Entwicklungsstufen detailliert analysiert, um den Wandel umfassend darzustellen.
Merkmale der Pluralisierung: Dieses Kapitel beschreibt die zentralen Merkmale der Pluralisierung von Lebensformen anhand von demografischen Daten. Es analysiert den Rückgang der Geburtenrate, den Rückgang der Eheschließungen und den Anstieg der Scheidungsraten in entwickelten Industrienationen. Diese demografischen Trends werden als wesentliche Faktoren für die wachsende Vielfalt an Lebensformen dargestellt und in den Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen eingeordnet. Die Kapitel beleuchtet den damit einhergehenden Verlust der Monopolstellung traditioneller Familienmodelle.
Schlüsselwörter
Pluralisierung, Lebensformen, Familie, Ehe, Wandel, Familienstrukturen, Differenzierungstheorie, Deinstitutionalisierung, Individualisierung, demografischer Wandel, Geburtenrate, Eheschließungen, Scheidungen, Einpersonenhaushalte, nichteheliche Lebensgemeinschaften, empirische Daten, soziale Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Pluralisierung von Lebensformen und Wandel von Ehe und Familie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wandel von Ehe und Familie im Kontext der Pluralisierung von Lebensformen. Sie analysiert die Entstehung und Erklärungsansätze dieser Pluralisierung, historische Veränderungen der Familienstrukturen und beschreibt deren Merkmale anhand demografischer Daten (Eheschließungen, Scheidungen, neue Lebensformen). Der Fokus liegt auf dem Wandel der Institutionen Ehe und Familie selbst, wobei geschlechtsspezifische Veränderungen und demografische Aspekte wie die Geburtenrate ausgeblendet werden.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Pluralisierung von Lebensformen und deren Ursachen, den historischen Wandel der Familienstrukturen, die Merkmale der Pluralisierung (Eheschließungen, Scheidungen, neue Lebensformen), Theorien zur Erklärung der Pluralisierung (Differenzierung, Deinstitutionalisierung, Individualisierung) und den Einfluss der Pluralisierung auf die Institutionen Ehe und Familie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung: beschreibt den Wandel der Familie seit Mitte der 60er Jahre und die Debatte um eine "Krise" der Familie. Sie betont die unterschiedliche Interpretation empirischer Daten und die Notwendigkeit, den Wandel vor dem Hintergrund der Nachkriegszeit zu betrachten. Pluralisierung der Lebensformen: untersucht den Begriff der Pluralisierung und verschiedene Erklärungsansätze, beleuchtet die Entstehung neuer Lebensformen und diskutiert wissenschaftliche Positionen zur Pluralisierungsthese. Familie im Wandel: befasst sich mit der historischen Entwicklung der Familie von der Sozialform des „ganzen Hauses“ bis zur Familie heute. Merkmale der Pluralisierung: beschreibt den Rückgang der Geburtenrate, den Rückgang der Eheschließungen und den Anstieg der Scheidungsraten und ordnet diese in den Kontext gesellschaftlicher Veränderungen ein. Fazit: [Inhalt nicht im Preview spezifiziert]
Welche Theorien werden zur Erklärung der Pluralisierung herangezogen?
Die Arbeit behandelt die Differenzierungstheorie, die Deinstitutionalisierungsthese und die Individualisierungsthese als Erklärungsansätze für die Pluralisierung von Lebensformen.
Welche demografischen Daten werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den Rückgang der Geburtenrate, den Rückgang der Eheschließungen und den Anstieg der Scheidungsraten in entwickelten Industrienationen als zentrale Merkmale der Pluralisierung.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Pluralisierung, Lebensformen, Familie, Ehe, Wandel, Familienstrukturen, Differenzierungstheorie, Deinstitutionalisierung, Individualisierung, demografischer Wandel, Geburtenrate, Eheschließungen, Scheidungen, Einpersonenhaushalte, nichteheliche Lebensgemeinschaften, empirische Daten, soziale Veränderungen.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Ist eine Pluralisierung von Lebensformen erkennbar und wie beeinflusst sie Ehe und Familie?
Wie wird die "Krise der Familie" in der Arbeit behandelt?
Die Einleitung thematisiert die kontroverse Debatte um eine mögliche "Krise" der Familie und betont die Notwendigkeit, den Wandel vor dem Hintergrund der historisch einmaligen Homogenität der Familienstrukturen in der Nachkriegszeit zu betrachten.
Welche Einschränkungen der Analyse werden erwähnt?
Die Arbeit weist darauf hin, dass die Beurteilung der Pluralisierung aufgrund der vielschichtigen Interpretation empirischer Daten herausfordernd ist und die Übertragbarkeit der Pluralisierungsthese auf alle Bevölkerungsgruppen in Frage gestellt wird.
- Quote paper
- Annika Stein (Author), 2018, Pluralisierung der Lebensformen. Die Familie im Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445395