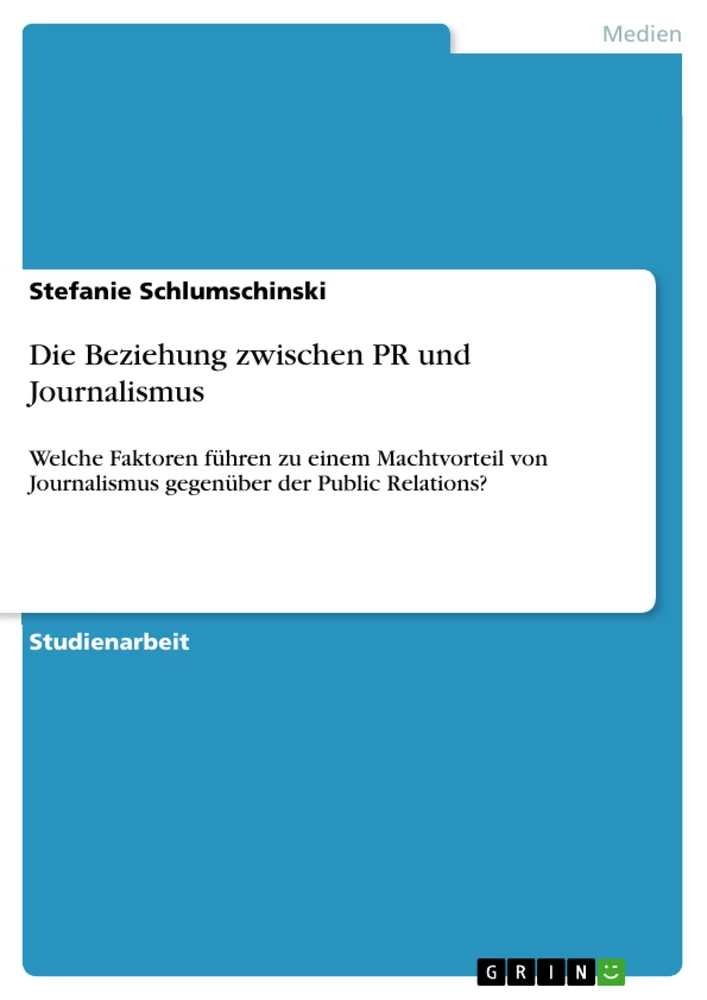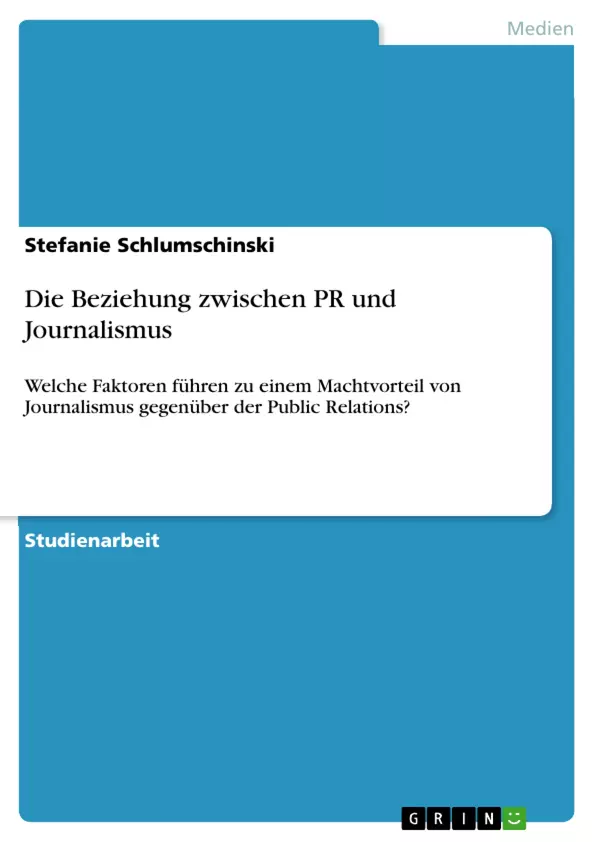Journalismus und Public Relations (PR) sind in der heutigen Mediengesellschaft kaum noch wegzudenken. Darüber hinaus gilt die Beziehung zwischen Journalisten und PR-Tätigen als umstritten. Aus wissenschaftlicher Perspektive gibt es unterschiedliche Lösungsansätze und Theorien, die zum Teil sehr verschiedenartige Rückschlüsse erlauben und zusammengefasst keinen einheitlichen Forschungsstand ergeben. Im Rahmen dieser Ausarbeitung werden primär drei verschiedene Darstellungen (Konkret: die Determinationsthese, das Intereffikationsmodell und die Medialisierungsthese) aufgegriffen, erläutert und im weiteren Verlauf auf die Forschungsfrage übertragen.
Die Forschungsfrage lautet: Welche Faktoren führen zu einem Machtvorteil von Journalismus gegenüber Public Relations? Die Frage impliziert, dass der Journalismus Macht auf die PR wirkt. Ist das tatsächlich so? Auf die Forschungsfrage bezogen wird insbesondere die Medialisierungsthese interessante und seltene Einblicke gewähren, weil sie als die einzige Perspektive gilt, die einen Einfluss von Journalismus auf PR thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Macht
- 3. Public Relations
- 3.1 Journalismus
- 3.2 Die wichtigsten Unterschiede zwischen PR und Journalismus
- 4. Theorien und Modelle
- 4.1 Determinationsthese
- 4.2 Das Intereffikationsmodell
- 4.3 Medialisierungsthese
- 5. Faktoren für einen Machtvorteil von Journalismus
- 5.1 Der Krisenfall
- 5.2 Selektionen, inhaltliche Differenzen und Aufmerksamkeit
- 6. Reflexion
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Beziehung zwischen Public Relations (PR) und Journalismus und analysiert, welche Faktoren zu einem Machtvorteil von Journalismus gegenüber PR führen. Sie beleuchtet drei Theorien (Determinationsthese, Intereffikationsmodell und Medialisierungsthese), um die komplexen Interaktionen zwischen PR und Journalismus zu verstehen.
- Definition und Abgrenzung von Macht, Journalismus und PR
- Analyse der Determinationsthese, des Intereffikationsmodells und der Medialisierungsthese
- Identifizierung von Faktoren, die zu einem Machtvorteil von Journalismus führen
- Bedeutung der Medialisierungsthese für das Verständnis des Einflusses von Journalismus auf PR
- Diskussion der Rolle von Krisen und selektiver Berichterstattung im Kontext von Machtbeziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Einleitung führt in die Thematik der Beziehung zwischen PR und Journalismus ein und stellt die Forschungsfrage nach den Faktoren für einen Machtvorteil von Journalismus. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Forschungsansätze und betont die Relevanz der Medialisierungsthese.
- Kapitel 2: Macht - In diesem Kapitel wird der Begriff der Macht aus der Perspektive von Max Weber definiert und auf den Kontext von PR und Journalismus übertragen. Es wird betont, dass beide Bereiche unterschiedliche Interessen verfolgen und Macht als das erfolgreiche Durchsetzen dieser Interessen verstanden wird.
- Kapitel 3: Public Relations - Das Kapitel beleuchtet die Vielfältigkeit der Definitionen von Public Relations und stellt unterschiedliche Perspektiven aus Berufspraxis und Wissenschaft dar. Es werden verschiedene Definitionen aus unterschiedlichen Fachrichtungen aufgezeigt, um die Komplexität des Begriffs zu verdeutlichen.
- Kapitel 3.1: Journalismus - Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Journalismus und betont die Notwendigkeit, verschiedene Dimensionen zu betrachten, um eine umfassende und operationale Definition zu entwickeln. Es werden verschiedene Merkmale und Tätigkeiten von Journalisten aufgezeigt, die für eine genaue Eingrenzung des Begriffs relevant sind.
- Kapitel 3.2: Die wichtigsten Unterschiede zwischen PR und Journalismus - Hier werden die grundlegenden Unterschiede zwischen PR und Journalismus zusammengefasst. Während Journalismus die Fremddarstellung kollektiv relevanter Informationen anstrebt, verfolgt PR die Selbstdarstellung partikularer Interessen. PR zeichnet sich durch Auftragskommunikation aus, während Journalismus unabhängige und objektive Berichterstattung anstrebt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Ausarbeitung sind Journalismus, Public Relations, Macht, Medialisierung, Determinationsthese, Intereffikationsmodell, Krisenkommunikation, Selektion, Aufmerksamkeit, und Medienwirkungsforschung.
- Quote paper
- Stefanie Schlumschinski (Author), 2016, Die Beziehung zwischen PR und Journalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445436