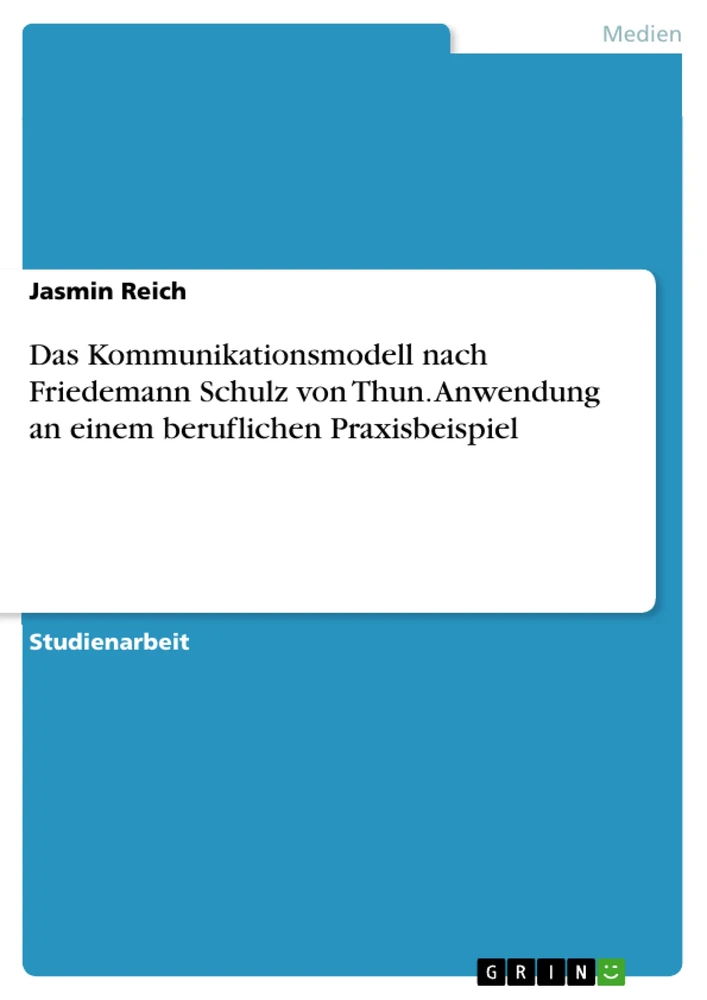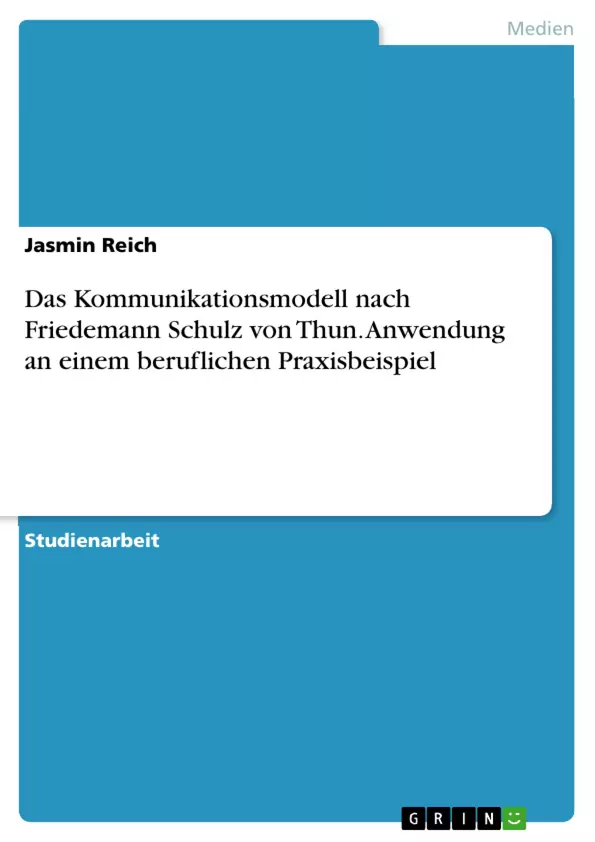Die folgende Arbeit befasst sich im Schwerpunkt mit dem Vier-Ohren-Modell nach Friedemann Schulz von Thun. Zunächst werden in einem der thematischen Einführung dienenden Kapitel alle wichtigen Fragen rund um die Kommunikation und Kommunikationsmodelle eingegangen. Was ist Kommunikation? Welche Merkmale bestimmen diese? Welche Kommunikationsmodelle gibt es? Im Anschluss erfolgt ein Überblick über das bereits erwähnte, von Friedemann Schulz von Thun entwickelte Kommunikationsmodell, das Vier-Ohren-Modell. Dies wird vertiefend im Bereich der vier Ebenen einer Nachricht erklärt. In Kapitel vier findet eine konkrete Anwendung des Vier-Ohren-Modells anhand eines ausgewählten Praxisbeispiels statt. In diesem werden die vier Möglichkeiten, wie eine einfache Nachricht: verstanden und interpretiert werden kann, aufgezeigt. Zudem werden Schlussfolgerungen gezogen, die sich daraus für den persönlichen Alltag eines jeden Menschen ergeben. Das abschließende Kapitel bildet noch einmal eine Zusammenfassung über das Vier-Ohren-Modell, sowie die wichtigsten Erkenntnisse daraus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Kommunikation?
- 3. Das , Vier-Ohren-Modell' nach Schulz von Thun
- 3.1 Friedemann Schulz von Thun
- 3.2 Das Vier-Ohren-Modell
- 3.2.1 Sachebene: Worüber ich dich informiere
- 3.2.2 Selbstoffenbarung: Was ich von mir selbst kundgebe
- 3.2.3 Beziehungsebene: Was ich von dir halte und wie wir zueinander stehen
- 3.2.4 Appellebene: Wozu ich dich veranlassen möchte
- 4. Anwendung des , Vier-Ohren-Modell' nach Schulz von Thun in einer alltäglichen-beruflichen Situation
- 4.1 Praxisbeispiel: Situationsbeschreibung
- 4.2 Analyse durch das Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das Vier-Ohren-Modell nach Friedemann Schulz von Thun anhand eines beruflichen Praxisbeispiels. Sie befasst sich mit der Bedeutung von Kommunikation im Alltag und untersucht, wie die verschiedenen Ebenen der Kommunikation im Vier-Ohren-Modell eine Botschaft beeinflussen können.
- Definition und Merkmale von Kommunikation
- Kommunikationsmodelle und ihre Bedeutung
- Das Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun und seine vier Ebenen
- Anwendung des Vier-Ohren-Modells in einer beruflichen Situation
- Schlussfolgerungen für den persönlichen Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition von Kommunikation und den Merkmalen, die sie ausmachen. Es werden verschiedene Kommunikationsmodelle vorgestellt und die Bedeutung von Kommunikation im Alltag hervorgehoben. Kapitel zwei analysiert das Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun, welches die vier Ebenen einer Nachricht beschreibt: Sachebene, Selbstoffenbarung, Beziehungsebene und Appellebene. Kapitel drei bietet eine konkrete Anwendung des Modells an einem Praxisbeispiel aus dem beruflichen Alltag. Hier werden die Auswirkungen der vier Ebenen auf das Verstehen und Interpretieren einer Botschaft untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der zwischenmenschlichen Kommunikation, Kommunikationsmodellen, dem Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun, den vier Ebenen einer Nachricht, Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appellebene sowie der Anwendung des Modells im beruflichen Alltag.
- Quote paper
- Jasmin Reich (Author), 2018, Das Kommunikationsmodell nach Friedemann Schulz von Thun. Anwendung an einem beruflichen Praxisbeispiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445691