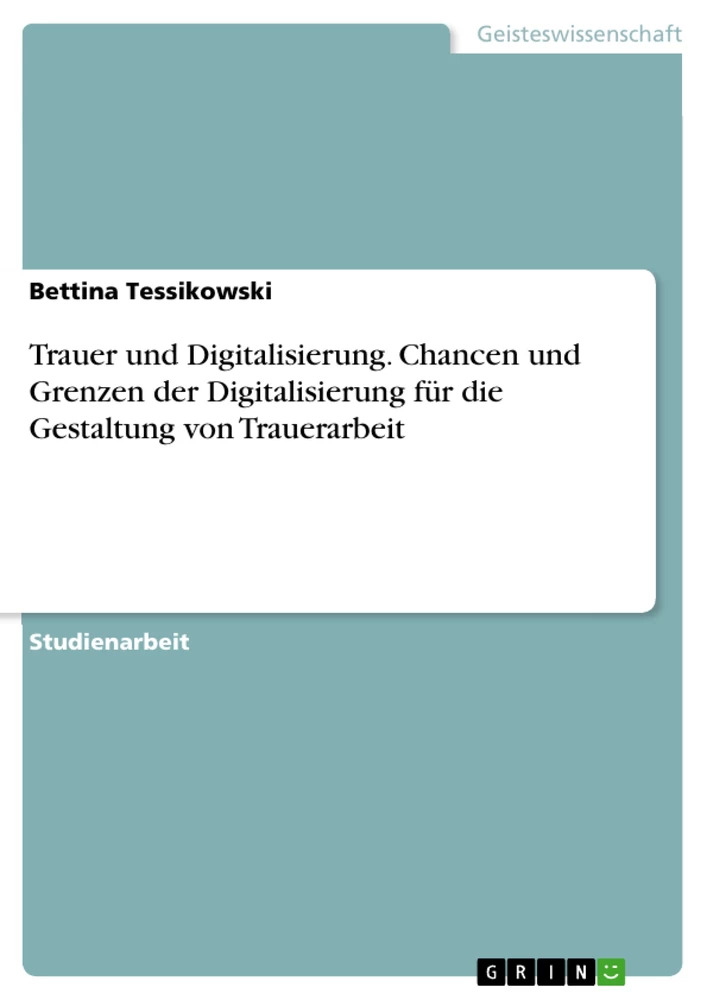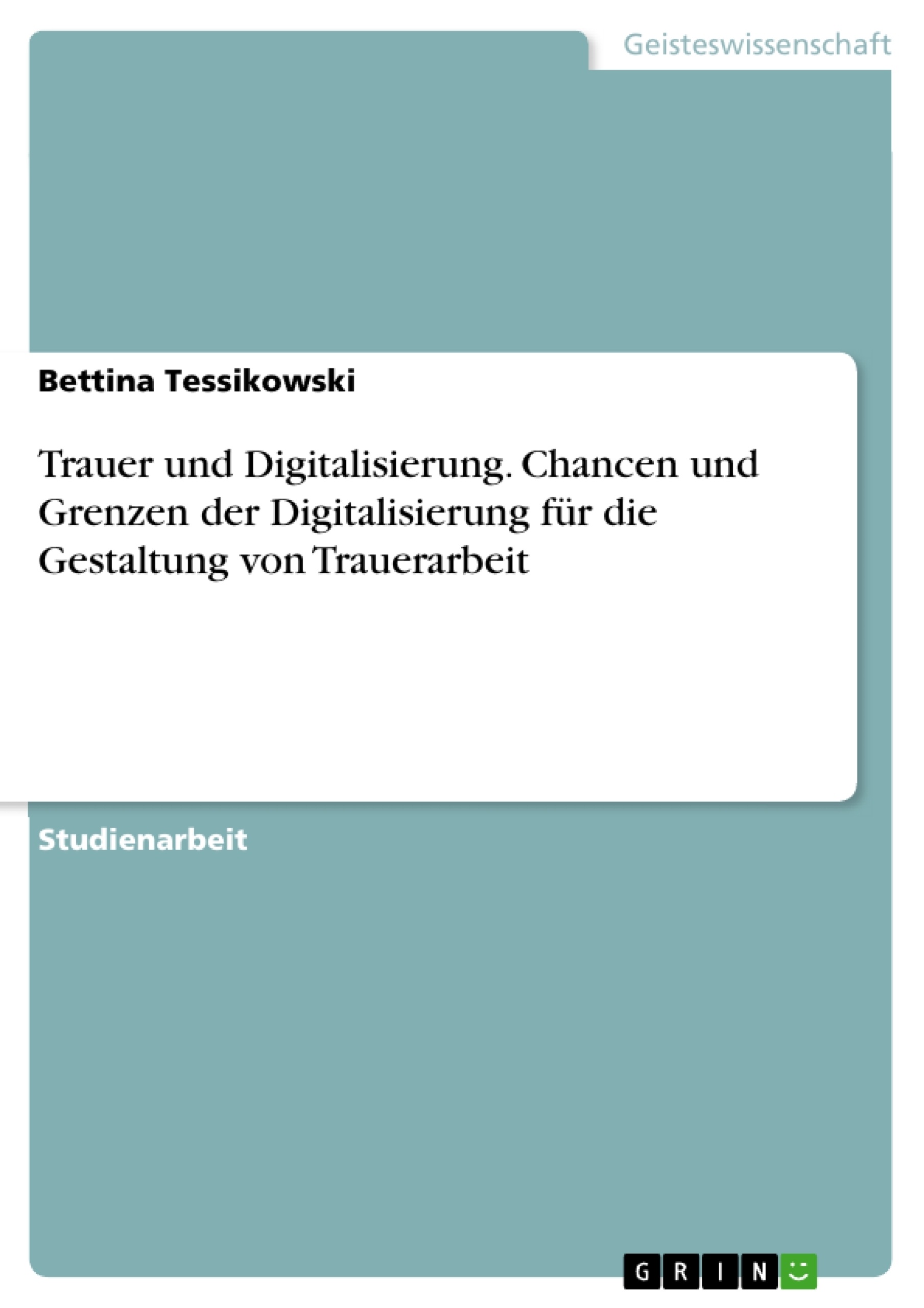Wie gehe ich mit dem Verlust eines geliebten Menschen um?
In der Folge "be right back" der Serie "Black Mirror" geht es genau um diese Frage, wie man mit einem solchen Verlust im Todesfall umgeht und welche Rolle auch die Digitalisierung dabei spielen kann. Wird im Zuge dieser Folge die verstorbene Person wieder „lebendig gemacht“, indem die Digitalisierung die Möglichkeit bietet auf Grund von gespeicherten Daten und der Nutzung des Internets zu Lebzeiten des Verstorbenen, mit diesem oder zumindest seinem „virtuellen-Ich“ zu schreiben und zu telefonieren und mit dieser Person am Ende sogar im realen Leben in Form einer Art nachgestellten Puppe sogar zu leben, drängte sich mir die Frage auf, inwieweit unsere moderne, digitalisierte Gesellschaft tatsächlich solche Möglichkeiten bietet.
Nachdem ich zwar unter anderem auch darauf gestoßen bin, dass Versuche der digitalen Sicherung einer Person schon unternommen werden und es auch ähnliche Tendenzen gibt, wie sie in dieser Folge gezeigt werden, suchte ich in einem zweiten Schritt nach Formen digitaler Trauerarbeit, welche es tatsächlich schon gibt und auch im hohen Maße genutzt werden. In diesem Zuge hat sich mir die Frage gestellt, ob digitale Möglichkeiten der Trauerarbeit eher eine Grenze überschreiten oder auch Hilfe bieten können. Demzufolge soll es in dieser Arbeit um die Digitalisierung als Herausforderung der Trauerarbeit in der Moderne gehen. Konkret werde ich dabei das Hauptaugenmerk auf Entwicklungen in Deutschland richten.
Um aber Vor- und Nachteile abwiegen zu können wird es zunächst kurz um Trauer nach einem Todesfall in Form von Trauerphasen und Bräuchen im Zuge eines Trauerfalls gehen, um einen kurzen Einblick zu gewährleisten. Vor der Vorstellung der Möglichkeiten der Trauerarbeit welche durch die Digitalisierung möglich wurden, soll zunächst versucht werden sich dem Begriff der Digitalisierung zu nähern, um nach diesen beiden Schritten Chancen und Grenzen der digitalen Trauerbewältigung analysieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Digitalisierung - eine Herausforderung für Trauerarbeit in der Moderne.
- Trauer und Trauerbewältigung in der modernen Gesellschaft..
- Trauerverhalten und Phasen des Trauerns nach Gerhard Schmied.
- Riten und Bräuche der Trauerzeit in der modernen Gesellschaft..
- Annäherungen an den Begriff der Digitalisierung
- Digitale Angebote und Möglichkeiten der Trauerbewältigung in unserer Zeit..
- Gedenkseiten
- QR Codes
- Virtuelle Friedhöfe.
- Trauer auf Social Networking Sites am Beispiel Facebook.
- Chancen und Grenzen digitalisierter Formen der Trauer-bewältigung ....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen der Digitalisierung für die Trauerarbeit in der modernen Gesellschaft, insbesondere in Deutschland. Sie untersucht die Möglichkeiten und Grenzen digitaler Angebote in der Trauerbewältigung und analysiert, ob digitale Formate eine Hilfe oder eine Grenze überschreiten.
- Trauerphasen und Riten in der modernen Gesellschaft
- Möglichkeiten der digitalen Trauerbewältigung
- Chancen und Grenzen digitaler Trauerarbeit
- Der Einfluss der Digitalisierung auf die Trauerkultur
- Ethik und Digitalisierung im Kontext der Trauerarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz der Digitalisierung für die Trauerarbeit in der Moderne dar. Das zweite Kapitel behandelt Trauer und Trauerbewältigung in der modernen Gesellschaft. Es stellt die Trauerphasen nach Gerhard Schmied vor und setzt diese in Bezug zu Riten und Bräuchen der modernen, westlichen Gesellschaft. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit dem Begriff der Digitalisierung und seinen vielfältigen Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche. Im vierten Kapitel werden digitale Angebote und Möglichkeiten der Trauerbewältigung, wie Gedenkseiten, QR Codes, virtuelle Friedhöfe und Trauer auf Social Networking Sites am Beispiel Facebook, vorgestellt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Digitale Trauerarbeit, Trauerbewältigung, Digitalisierung, Trauerphasen, Riten, Bräuche, Gedenkseiten, QR Codes, Virtuelle Friedhöfe, Social Networking Sites, Facebook, Ethik, Grenzen, Chancen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei der Trauerarbeit?
Die Digitalisierung bietet neue Räume für Trauer, wie virtuelle Gedenkseiten oder Friedhöfe, die unabhängig von Ort und Zeit den Austausch über Verstorbene ermöglichen.
Was sind die Trauerphasen nach Gerhard Schmied?
Die Arbeit setzt sich mit dem Trauerverhalten und den Phasen auseinander, die Menschen nach einem Verlust durchlaufen, und vergleicht diese mit modernen Riten.
Wie werden QR-Codes auf Friedhöfen genutzt?
QR-Codes auf Grabsteinen verlinken oft zu digitalen Gedenkseiten, auf denen Lebensläufe, Fotos oder Videos des Verstorbenen für Besucher abrufbar sind.
Gibt es ethische Grenzen bei der digitalen Trauer?
Ja, die Arbeit diskutiert, ob Konzepte wie das "virtuelle Ich" oder die digitale Wiederbelebung Verstorbener (wie in Science-Fiction-Serien angedeutet) eine gesunde Trauerbewältigung behindern.
Wie beeinflusst Facebook die Trauerkultur?
Social Networking Sites ermöglichen eine kollektive Form der Trauer, bei der Profile Verstorbener in Gedenkzustände versetzt werden und Freunde öffentlich Abschied nehmen können.
- Quote paper
- Bettina Tessikowski (Author), 2018, Trauer und Digitalisierung. Chancen und Grenzen der Digitalisierung für die Gestaltung von Trauerarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445734