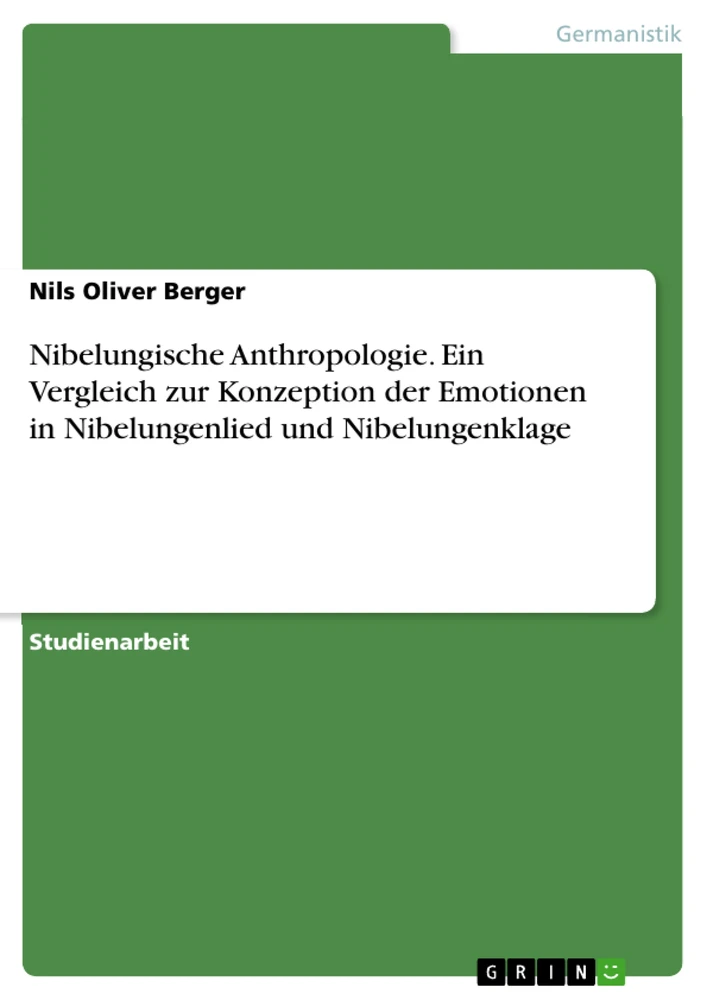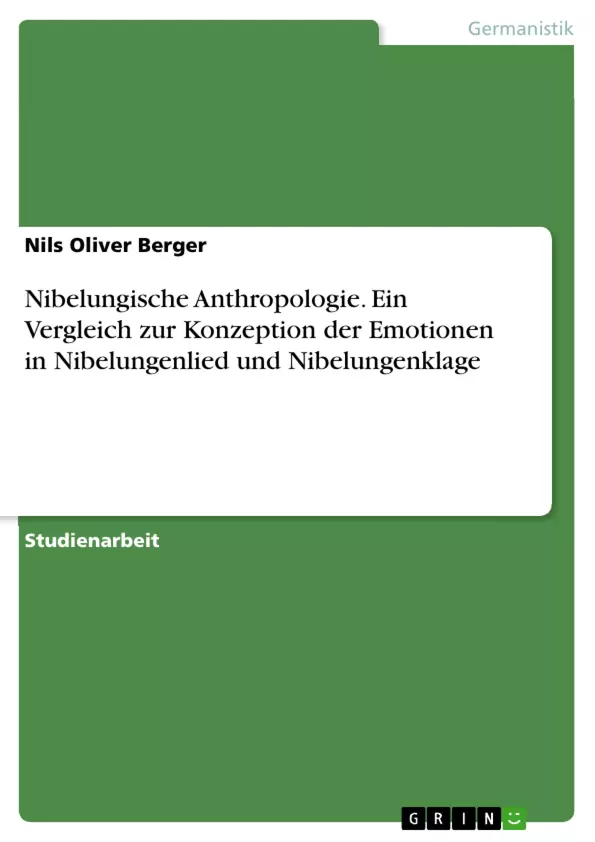Seit der Wiederentdeckung im Jahre 1755 hat das Nibelungenlied eine wechselvolle Interpretationsgeschichte erlebt. Bei der Interpretation der Figuren ging man lange Zeit von fest umrissenen komponierten Charakteren aus, ihre im Text genannten Emotionen sollten Handlungsantrieb und Spiegel tiefster persönlicher Regungen sein. Dieser Interpretationsansatz stieß jedoch an seine Grenzen, denn die Figuren des Nibelungenliedes handeln bisweilen inkonsequent oder gar widersprüchlich, was sich mit der benannten Konzeption, die Protagonisten als geschlossen geformte Charaktere zu betrachten, nicht abschließend erklären ließ.
Als Gegenentwurf einer Analyse entwickelte Jan-Dirk Müller die „Nibelungische Anthropologie.“ In seiner These versucht er darzulegen, daß man einen mittelalterlichen Text wie das Nibelungenlied nicht ohne weiteres mit unserem neuzeitlichen Verständnis rezipieren könne. Unser Verständnis für Handlungsmotivationen könne bei der Analyse zu Schlüssen führen, die abseits des Verständnisses des mittelalterlichen Zeitgenossen wie auch der Konzeption des (unbekannten, aber de facto vorhandenen) Verfassers liegen.
Die Frage lautet nun, ob sich Müllers Konzept, das er schlüssig zu belegen weiß, auch auf die Nibelungenklage übertragen lässt. „Lied“ und „Klage“ sind, von zwei Ausnahmen abgesehen, den Fassungen n und k, in den komplett erhaltenen Fassungen des Nibelungenepos stets als ein einheitlicher Text überliefert. Wenn die Forschung in Bezug auf Fragen nach dem Autor, Entstehungszeitpunkt und -ort bis heute z.T. verschiedene Auffassungen vertritt, so ist sie doch weitgehend einig, dass beide Texte, Nibelungenlied und –klage, stilistisch und inhaltlich deutlich zu unterscheiden sind.
Auf den folgenden Seiten werde ich mich eingehender mit dem Konzept Jan-Dirk Müllers befassen und die Frage erörtern, ob sich sein Konzept der „Nibelungischen Anthropologie“ auch auf die Konzeption der Klage übertragen lässt. Bei der Beantwortung dürfte entscheidend sein, in welcher Beziehung/Relation „Lied“ und „Klage“ zueinander stehen.
Die Beleuchtung der Entstehungsgeschichte des Nibelungenliedes wie auch der Nibelungenklage soll Anhaltspunkte liefern für die Beantwortung der Frage, ob “Klage“ und „Lied“ möglicherweise vom gleichen Autor angefertigt wurden, oder zumindest dem gleichen Entstehungskontext entspringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Nibelungenlied
- Ursprung des Nibelungenliedes
- Das Wirken des Nibelungenstoffes
- Die Wiederentdeckung der Nibelungenhandschriften
- Das Nibelungenlied: Hintergründe des Inhalts
- Die Nibelungenklage
- Inhalt
- Ursprünge der Nibelungenklage
- Die Frage nach Autor und Entstehungszeitpunkt
- Selbstreferenz der „Klage“
- Entstehungszeitpunkt
- Der Kompromiß: Die Theorie der „Passauer Nibelungen-Werkstatt“
- Die erzählerische Funktion der „Klage“ in Bezug auf das „Lied“
- Zusammenfassung: Die Relation von Nibelungenlied und „Klage“
- Mit welcher Intention setzt die „Klage“ das „Lied“ fort?
- Emotionen: Einsatz und Gebrauch im Nibelungenlied
- Jan-Dirk Müllers These der „Nibelungischen Anthropologie“
- Werner Schröder: „Das Leid in der, Klage'”
- Richard Leichers Analyse der Trauerriten in der Nibelungenklage
- Vergleich der Konzeptionen am Beispiel Etzels:
- Werner Schröder:
- Jan-Dirk Müller:
- Richard Leicher
- Schlußbetrachtung: Entspricht das Konzept der Emotionen in der „Klage“ der im „Lied“?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Konzeption von Emotionen im Nibelungenlied und der Nibelungenklage. Die Arbeit befasst sich mit der These von Jan-Dirk Müller, der eine „Nibelungische Anthropologie“ entwickelt, die das Verständnis von Emotionen in mittelalterlichen Texten neu beleuchtet. Die Arbeit untersucht, ob sich Müllers Konzept auf die Nibelungenklage übertragen lässt und analysiert die verschiedenen Konzeptionen von Emotionen in beiden Texten.
- Die „Nibelungische Anthropologie“ von Jan-Dirk Müller
- Die Konzeption von Emotionen im Nibelungenlied
- Die Konzeption von Emotionen in der Nibelungenklage
- Die Beziehung zwischen Nibelungenlied und Nibelungenklage
- Der Einfluss der Entstehungszeit auf das Verständnis von Emotionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung setzt den Leser mit der Fragestellung der Arbeit und den Inhalten von Nibelungenlied und Nibelungenklage vertraut. Sie stellt die Bedeutung der Forschung zum Nibelungenlied für das Verständnis der Nibelungenklage heraus.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Nibelungenlied. Es erläutert den Ursprung des Textes, die Verbreitung des Nibelungenstoffes in anderen Werken und die Wiederentdeckung der Nibelungenhandschriften im 18. Jahrhundert.
Kapitel 3 analysiert die Nibelungenklage und beleuchtet ihren Inhalt, ihre Ursprünge und die Frage nach dem Autor und dem Entstehungszeitpunkt. Es wird auf die Beziehung zwischen Nibelungenlied und Nibelungenklage eingegangen und die Intention der Fortsetzung des „Liedes“ durch die „Klage“ beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich der Konzeption von Emotionen im Nibelungenlied. Es stellt die „Nibelungische Anthropologie“ von Jan-Dirk Müller vor und analysiert die verschiedenen Ansätze von Werner Schröder und Richard Leicher zur Interpretation von Emotionen in der Nibelungenklage.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Nibelungenklage, Emotionen, mittelalterliche Literatur, „Nibelungische Anthropologie“, Jan-Dirk Müller, Werner Schröder, Richard Leicher, Entstehungszeit, Rezeption, Textanalyse, mittelhochdeutsche Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Nibelungische Anthropologie“?
Es ist eine These von Jan-Dirk Müller, die besagt, dass Emotionen im Nibelungenlied nicht als psychologische Charaktertiefe, sondern als formelhafte Handlungsantriebe verstanden werden müssen.
Was ist der Unterschied zwischen Nibelungenlied und Nibelungenklage?
Das „Lied“ schildert den heroischen Untergang, während die „Klage“ als Fortsetzung versucht, das Geschehene zu reflektieren, zu betrauern und einen Sinn darin zu finden.
Lassen sich Emotionen im Mittelalter mit heutigen Maßstäben messen?
Nein, die Arbeit argumentiert, dass mittelalterliche Texte eine eigene Konzeption von Emotionen haben, die oft an soziale Rollen und Riten gebunden ist.
Was war die „Passauer Nibelungen-Werkstatt“?
Es ist eine Theorie, nach der beide Texte in einem ähnlichen zeitlichen und räumlichen Kontext (Passau um 1200) entstanden sein könnten.
Wie wird die Figur Etzel in der „Klage“ dargestellt?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Analysen (u. a. Schröder und Müller) zur Darstellung von Etzels Trauer und Leid nach der Katastrophe.
- Arbeit zitieren
- Nils Oliver Berger (Autor:in), 2005, Nibelungische Anthropologie. Ein Vergleich zur Konzeption der Emotionen in Nibelungenlied und Nibelungenklage, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446245