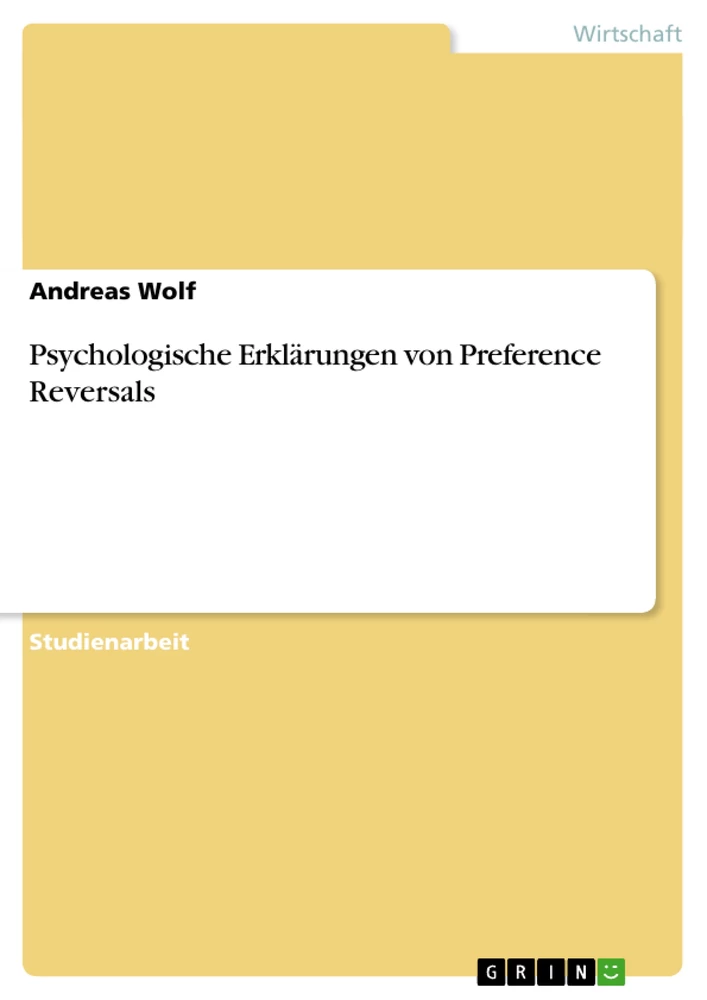Als Grundannahme des Entscheidens und Handelns gilt, dass Menschen entsprechend der Situation, in der sie sich befinden, handeln. Das heißt, dass bei gegebenen konsistenten Präferenzen eines Subjektes dessen Entscheidung rational abläuft. Die Formulierung des Rationalitätsprinzips findet seine Präzisierung in der Erwartungsnutzentheorie. Diese wurde durch von Neumann und Morgenstern (1947) entwickelt und durch Savage (1954) um Ereignisse erweitert, die keine vorgegebenen Eintrittswahrscheinlichkeiten haben (Subjective Expected Utility Theory). Im Rahmen der Erwartungsnutzentheorie wird davon ausgegangen, dass das Entscheidungssubjekt seinen Erwartungsnutzen maximiert.
Diese Theorie der rationalen Wahl basiert auf strengen Annahmen über das menschliche Entscheidungsverhalten. Hierzu gehören insbesondere das Axiom der Vollständigkeit und Transitivität, das Stetigkeits-, Unabhängigkeits- und das Reduktionsaxiom. Diese Axiome sind durch theoretische Stringenz, Klarheit und reduktionistische Einfachheit gekennzeichnet. Wenig überraschend ist, dass zu den Vorhersagen der Erwartungsnutzentheorie in Entscheidungsexperimenten konstante empirische Gegenevidenzen auftreten, die die oben genannten Axiome verletzen. Diese Gegenevidenzen werden auch als Anomalien des Entscheidungsverhaltens bezeichnet, die darauf hindeuten, dass das Erwartungsnutzenmodell nicht immer mit dem realen Entscheidungsverhalten übereinstimmt.
Eine der verblüffendsten Inkonsistenzen ist neben zahlreichen anderen beobachteten Anomalien des Entscheidungsverhaltens das Phänomen der Preference Reversals (Präferenzumkehrungen). Es wurde erstmals von Lindman (1965) und später von Slovic und Lichtenstein (1968) entdeckt. Letztere haben in Laborexperimenten festgestellt, dass Versuchspersonen inkonsistente Präferenzen aufwiesen. Das Phänomen der Preference Reversals beschäftigte seitdem zunächst die Psychologie und wegen weitreichender Bedeutung konsistenter Präferenzen für die Entscheidungstheorie später auch die Wirtschaftswissenschaften. Die psychologischen Erklärungsansätze für Preference Reversals, die die wirtschaftswissenschaftliche Forschung am stärksten beeinflusst haben, bilden den Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Das Phänomen des Preference Reversals
- Psychologische Erklärungsansätze für Preference Reversals
- Mangelnde Motivation bzw. Mängel im Versuchsaufbau
- Deskriptiv geprägte Erklärungsansätze
- Anchoring und Adjustment
- Contingent Weighting Theory
- Prominence-Effekt
- Skalenkompatibilitätseffekt
- Modellierung des Contingent Weighting Ansatzes
- Erklärungsgehalt deskriptiver Erklärungsansätze
- Kontextbezug als Einflussfaktor auf die Präferenzenbildung
- Formell geprägte Erklärungsansätze
- Expression Theory
- Grundannahmen der Expression Theory
- Preference Reversals im Rahmen der Expression Theory
- Change-of-Process Theory
- Expression Theory
- Preference Reversals - Laboreffekt oder Marktrealität?
- Würdigung psychologischer Erklärungsansätze
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen der Preference Reversals, einem beobachteten Widerspruch im Entscheidungsverhalten von Menschen. Dabei werden insbesondere die psychologischen Erklärungsansätze untersucht, die die wirtschaftswissenschaftliche Forschung in diesem Bereich am stärksten beeinflusst haben. Die Arbeit analysiert, wie diese Ansätze das Phänomen der Preference Reversals erklären können und welche Bedeutung sie für die Entscheidungstheorie haben.
- Das Phänomen der Preference Reversals
- Deskriptive und formelle Erklärungsansätze für Preference Reversals
- Die Bedeutung psychologischer Erklärungsansätze für die Entscheidungstheorie
- Die Relevanz von Preference Reversals für die Praxis
- Die Grenzen psychologischer Erklärungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Phänomen der Preference Reversals, das in den 1960er Jahren von Lindman und Slovic/Lichtenstein entdeckt wurde. Es wird gezeigt, wie dieses Phänomen die klassische Annahme rationalen Entscheidungsverhaltens in Frage stellt, die sich auf die Erwartungsnutzentheorie stützt. Die folgenden Kapitel befassen sich dann mit verschiedenen psychologischen Erklärungsansätzen für Preference Reversals. Dazu zählen sowohl deskriptive Ansätze wie Anchoring und Adjustment sowie die Contingent Weighting Theory, als auch formelle Ansätze wie die Expression Theory und die Change-of-Process Theory. Es wird untersucht, inwieweit diese Ansätze das Phänomen der Preference Reversals erklären können und welche Implikationen sie für die Entscheidungstheorie haben. Die Arbeit endet mit einer Würdigung der psychologischen Erklärungsansätze und einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Preference Reversals, Entscheidungstheorie, Erwartungsnutzentheorie, Psychologie, Deskriptive Erklärungsansätze, Formelle Erklärungsansätze, Anchoring und Adjustment, Contingent Weighting Theory, Expression Theory, Change-of-Process Theory, Laboreffekt, Marktrealität, Inkonsistenzen, Anomalien, Entscheidungsverhalten.
Häufig gestellte Fragen zu Preference Reversals
Was ist ein „Preference Reversal“ (Präferenzumkehrung)?
Es beschreibt das Phänomen, dass Menschen bei unterschiedlichen Abfragemethoden widersprüchliche Vorlieben für dieselben Optionen zeigen.
Was besagt die Erwartungsnutzentheorie?
Sie geht davon aus, dass Individuen rational handeln und stets ihren Erwartungsnutzen maximieren, basierend auf konsistenten Präferenzen.
Was sind Anchoring und Adjustment?
Es ist ein psychologischer Effekt, bei dem Menschen sich an einem Anfangswert (Anker) orientieren und ihre Schätzung davon ausgehend nur unzureichend anpassen.
Was ist der Skalenkompatibilitätseffekt?
Ein Merkmal erhält mehr Gewicht, wenn es auf derselben Skala wie die Antwort ausgedrückt wird (z. B. Geldwerte bei Preisabfragen).
Sind Preference Reversals nur Laboreffekte?
Die Arbeit untersucht, ob diese Anomalien auch in der realen Marktwirtschaft existieren oder nur unter künstlichen Versuchsbedingungen auftreten.
- Quote paper
- Andreas Wolf (Author), 2005, Psychologische Erklärungen von Preference Reversals, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44639