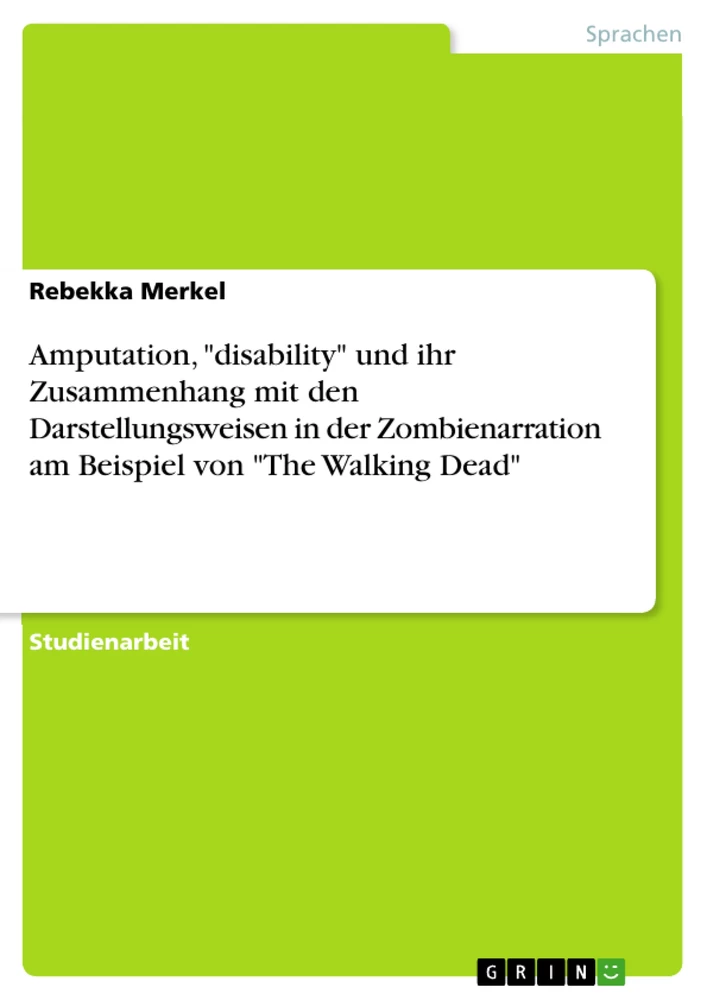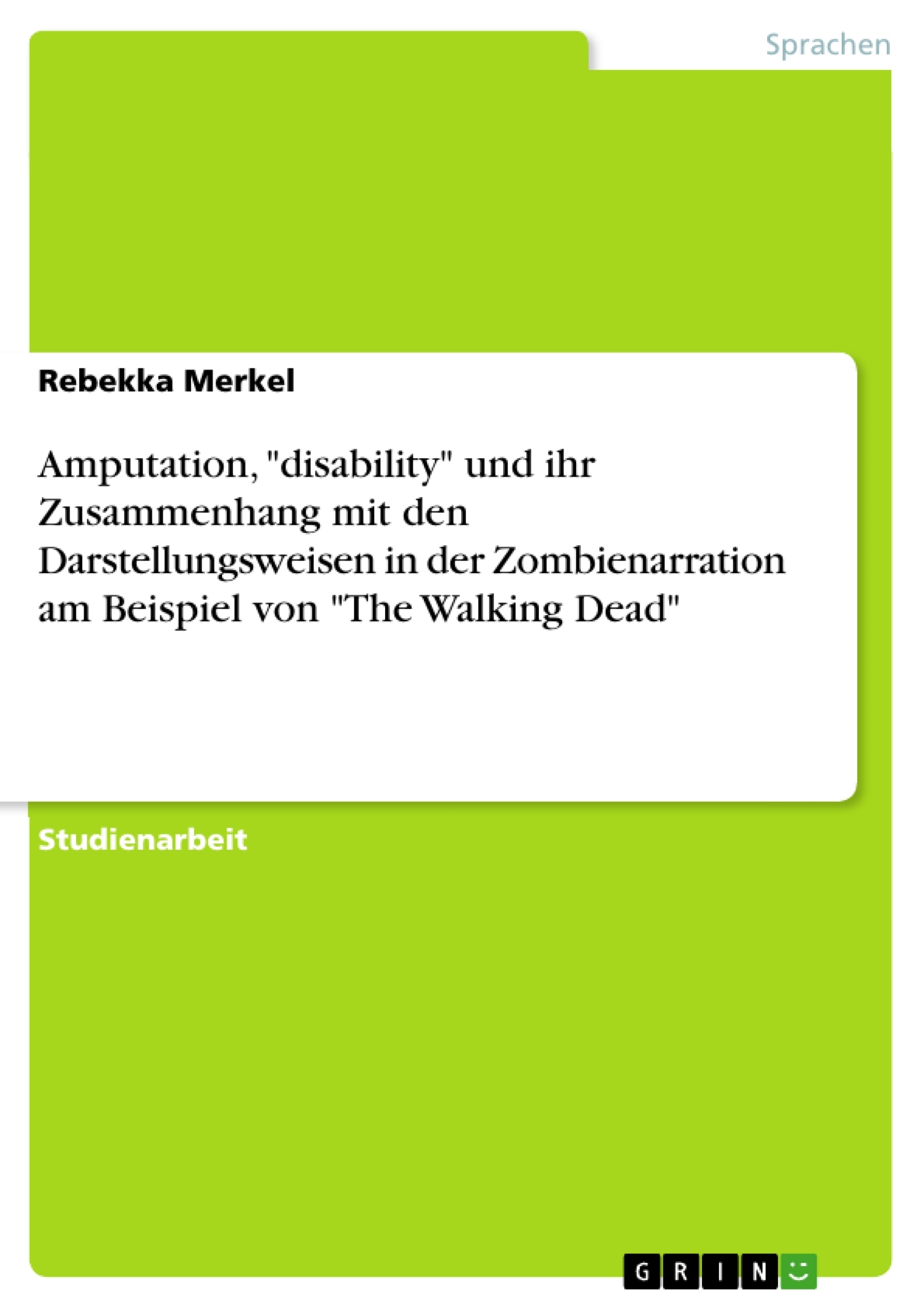Das Konzept der Amputation hat in der Literaturgeschichte eine tiefgreifende Bedeutung. Häufig wird eine Amputation nicht als wichtig für den Verlauf der Geschichte wahrgenommen, doch in ihr, und der daraus folgenden disability, lassen sich viele narrative Besonderheiten erschließen, die erst bei genauerer Betrachtung ihre Bedeutung aufzeigen. Vor allem disabilities, die aus der Amputation zu entstehen scheinen, erzeugen einen Charakter mit besonderen Eigenschaften. Ein Charakter mit amputierten Gliedmaßen ist immer auch ein Charakter, mit einer besonderen Geschichte und besonderen anderen Fähigkeiten. Dies lässt sich aber nicht nur in der Literatur, sondern auch in Filmen und Serien finden. Vor allem ein Serie wie "The Walking Dead" weist Amputationen in hoher Zahl auf. Deshalb eignet sie sich gut als Forschungsgegenstand.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Disability Studies
- Ableism, disability und Disability Studies - Eine Begriffserklärung
- Disability Studies und ihre Bedeutung in der medialen Darstellung
- Die Entwicklung der Zombienarration in der Popkultur
- Zombienarration in Verbindung mit den Disability Studies
- Die Darstellung von Zombies in der Zombienarration
- Die Darstellung der Überlebenden Menschen in der Zombienarration
- The Walking Dead
- Amputationen in The Walking Dead
- Amputationen an Menschen
- Amputationen bei Zombies
- Disability und ihre Deutungsmöglichkeit in The Walking Dead
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Zombies und Menschen in einer postapokalyptischen Welt, insbesondere im Kontext der Serie The Walking Dead. Sie analysiert die Beziehung zwischen Disability Studies und der Zombienarration und erforscht, wie die Serie The Walking Dead diese Aspekte darstellt. Ziel ist es, die Entwicklung des Zombiebildes in der Popkultur aufzuzeigen und die Bedeutung von Disability und Ableism in diesem Kontext zu untersuchen.
- Die Entwicklung der Zombienarration in der Popkultur
- Disability Studies und ihre Bedeutung in der medialen Darstellung
- Die Darstellung von Zombies in der Zombienarration
- Disability und Ableism in Bezug auf Menschen und Zombies in The Walking Dead
- Die Bedeutung der Amputation als Symbol in der Serie The Walking Dead
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Zombienarration in der heutigen Popkultur und den wachsenden Einfluss der Disability Studies auf die Medieninterpretation dar. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Disability Studies und erklärt die Begriffe Ableism, disability und deren Bedeutung in Bezug auf die gesellschaftliche Konstruktion von Körperlichkeit. Im dritten Kapitel wird ein kurzer Überblick über die Entwicklung der Zombienarration in der Popkultur gegeben, um die aktuelle Darstellung in The Walking Dead besser zu verstehen. Kapitel vier untersucht die Verbindung zwischen Zombienarration und Disability Studies und analysiert die Darstellung von Zombies und Überlebenden in diesem Kontext. Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf die Serie The Walking Dead und betrachtet die Rolle von Amputationen und Disability in der Geschichte. Dieses Kapitel untersucht sowohl Amputationen an Menschen als auch an Zombies und analysiert deren Bedeutung im Kontext der Serie. Die Schlussfolgerungen werden in Kapitel sechs gezogen, wobei die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und ein Fazit gezogen werden.
Schlüsselwörter
Disability Studies, Ableism, Zombienarration, The Walking Dead, Amputation, Popkultur, Medienanalyse, gesellschaftliche Konstruktion von Körperlichkeit, Überlebenskampf, postapokalyptische Welt.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Thema Amputation in „The Walking Dead“ thematisiert?
Amputationen treten in der Serie häufig auf, sowohl bei Menschen (oft als Überlebensstrategie nach einem Biss) als auch bei Zombies. Sie dienen als narratives Mittel, um Charakterentwicklung und die Härte der Welt darzustellen.
Was untersuchen die Disability Studies in Bezug auf Zombies?
Sie analysieren die Darstellung von körperlichen Beeinträchtigungen und wie Begriffe wie „normal“ oder „behindert“ in einer Welt, in der Körperlichkeit alles ist, neu konstruiert werden.
Was bedeutet Ableism im Kontext der Zombienarration?
Ableism bezeichnet die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. In Zombiefilmen zeigt sich dies oft im radikalen Fokus auf Fitness und körperliche Unversehrtheit als Voraussetzung für das Überleben.
Welche symbolische Bedeutung hat eine Amputation für einen Charakter?
Ein amputierter Charakter trägt oft eine besondere Geschichte des Verlusts und der Überwindung mit sich. Die Behinderung wird zum Teil seiner Identität und seiner besonderen Fähigkeiten im Überlebenskampf.
Wie hat sich das Bild des Zombies in der Popkultur entwickelt?
Vom voodoo-basierten Sklaven-Zombie über den Romero-Ghul bis hin zum modernen, schnellen oder zerfallenden Zombie spiegelt die Figur stets aktuelle gesellschaftliche Ängste und Konzepte von Körperlichkeit wider.
Sind Zombies selbst als „disabled“ (behindert) zu betrachten?
Die Arbeit untersucht, ob die körperliche Versehrtheit der Zombies sie in Kategorien der Disability rückt und wie dies die Wahrnehmung von Bedrohung und Menschlichkeit beeinflusst.
- Arbeit zitieren
- Rebekka Merkel (Autor:in), 2017, Amputation, "disability" und ihr Zusammenhang mit den Darstellungsweisen in der Zombienarration am Beispiel von "The Walking Dead", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446396