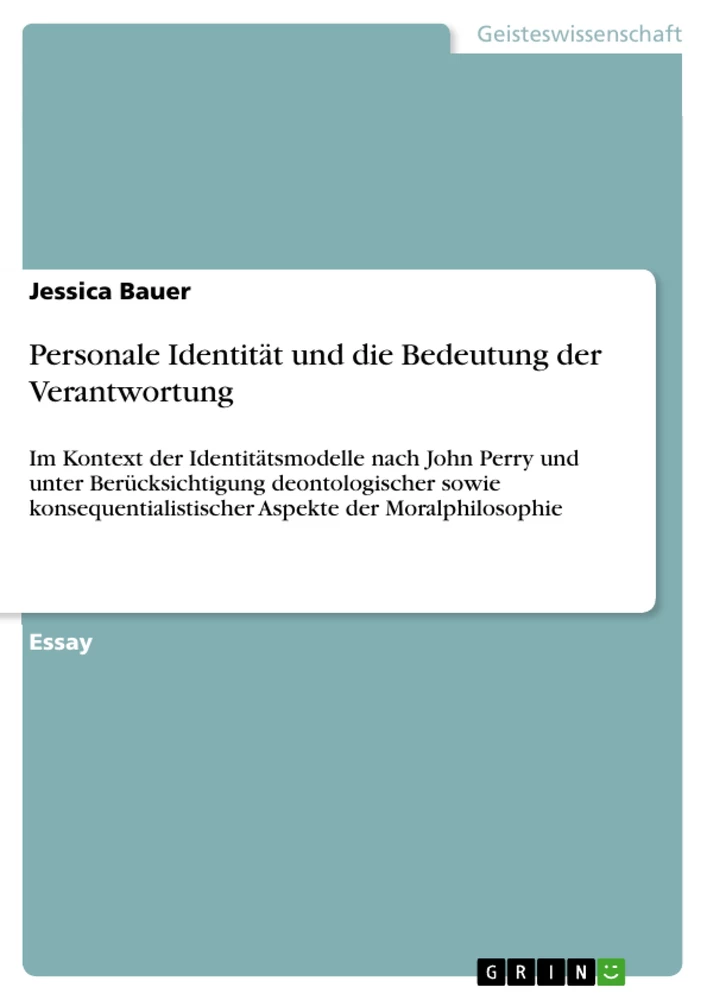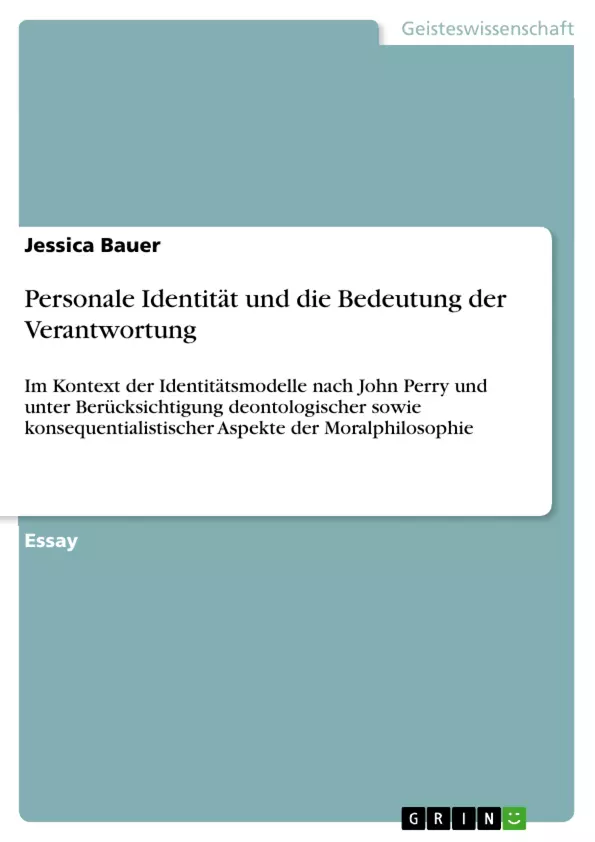Die Frage nach personaler Identität ist als solche eine vieldiskutierte, welche sich in philosophischen Kreisen unterschiedlicher Ansätze und Denkrichtungen bedient. Besonderes Interesse gilt ihr, da sie zur Auseinandersetzung mit Thematiken, die sich auf die Unsterblichkeit oder grundgenerell auf ein Leben nach dem Tod beziehen, als wesentlicher Bestandteil oder gar Voraussetzung gesehen werden muss. Ein entscheidender Punkt dieser Frage, mit welcher sich bekannte Philosophen wie Hegel, Locke oder Perry beschäftigten, ist die Suche nach einer Begriffsklärung, welche, in Bezug auf die personale Identität, einhergeht mit der Trennung oder Zusammensetzung von Körper und Seele, und letztendlich das Problem, das sich durch polarisierende Ansichten und zwiespältige Meinungen zwischen den einzelnen Philosophen daraus ergibt.
Die schriftliche Untersuchung soll unter Berücksichtigung deontologischer und konsequentialistischer Aspekte der Moralphilosophie klären, inwiefern sich die von John Perry vorgestellten Modelle zur Identität eignen, um moralische Verantwortung zu zeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Grundlegendes zum moralischen Aspekt
- 3. Identitätsmodelle
- 3.1 Modell der Zweigsprache
- 3.2 Modell der Personenstadien
- 4. Abschluss
- 5. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Bedeutung von Verantwortung im Kontext der von John Perry vorgestellten Modelle der persönlichen Identität. Dabei werden deontologische und konsequentialistische Aspekte der Moralphilosophie berücksichtigt.
- Analyse der von John Perry vorgeschlagenen Modelle der persönlichen Identität
- Untersuchung der Rolle der Erinnerung bei der Definition der persönlichen Identität
- Beurteilung der Relevanz von deontologischen und konsequentialistischen Ansätzen für die Frage der moralischen Verantwortung
- Bewertung der Plausibilität der Modelle im Hinblick auf ihre Fähigkeit, moralische Verantwortung zu erklären
- Diskussion der ethischen Implikationen der verschiedenen Identitätskonzepte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der persönlichen Identität und ihre philosophischen Debatten ein. Sie stellt die zentralen Ansätze des körperlichen und psychischen Kriteriums vor und beleuchtet John Perrys Position, die sich auf das psychische Kriterium nach Locke stützt, insbesondere mit dem Fokus auf die Rolle der Erinnerung. Die Einleitung erläutert Perrys Kritik am körperlichen Kriterium und stellt seine Sichtweise auf das Bewusstsein als entscheidenden Faktor für die Klärung der persönlichen Identität vor.
Das Kapitel "Grundlegendes zum moralischen Aspekt" gibt einen kurzen Überblick über die beiden wichtigsten Strömungen in der Moralphilosophie: die Deontologie und den Konsequentialismus. Es wird auf die unterschiedlichen Handlungsmotive und die Bedeutung von Gesetzen bzw. Folgen für die moralische Beurteilung von Handlungen hingewiesen.
Schlüsselwörter
Personale Identität, Moralphilosophie, John Perry, Deontologie, Konsequentialismus, Erinnerung, Bewusstsein, Identitätsmodelle, Zweigsprache, Personenstadien, Moralische Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist personale Identität in der Philosophie?
Es ist die Frage, was eine Person über die Zeit hinweg dieselbe sein lässt, oft diskutiert anhand körperlicher oder psychischer Kriterien.
Welche Modelle stellt John Perry zur Identität vor?
Perry diskutiert unter anderem das Modell der Zweigsprache und das Modell der Personenstadien, um die Kontinuität des Selbst zu erklären.
Wie hängen Identität und moralische Verantwortung zusammen?
Verantwortung setzt voraus, dass die Person, die eine Tat begangen hat, identisch ist mit der Person, die dafür zur Rechenschaft gezogen wird.
Welche Rolle spielt die Erinnerung für die Identität?
Nach Locke und Perry ist die psychische Kontinuität durch Erinnerungen ein wesentliches Kriterium für die Definition derselben Person.
Was ist der Unterschied zwischen Deontologie und Konsequentialismus?
Deontologie bewertet Handlungen nach Pflichten und Regeln, während der Konsequentialismus den moralischen Wert allein an den Folgen einer Handlung misst.
- Citation du texte
- Jessica Bauer (Auteur), 2017, Personale Identität und die Bedeutung der Verantwortung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446506