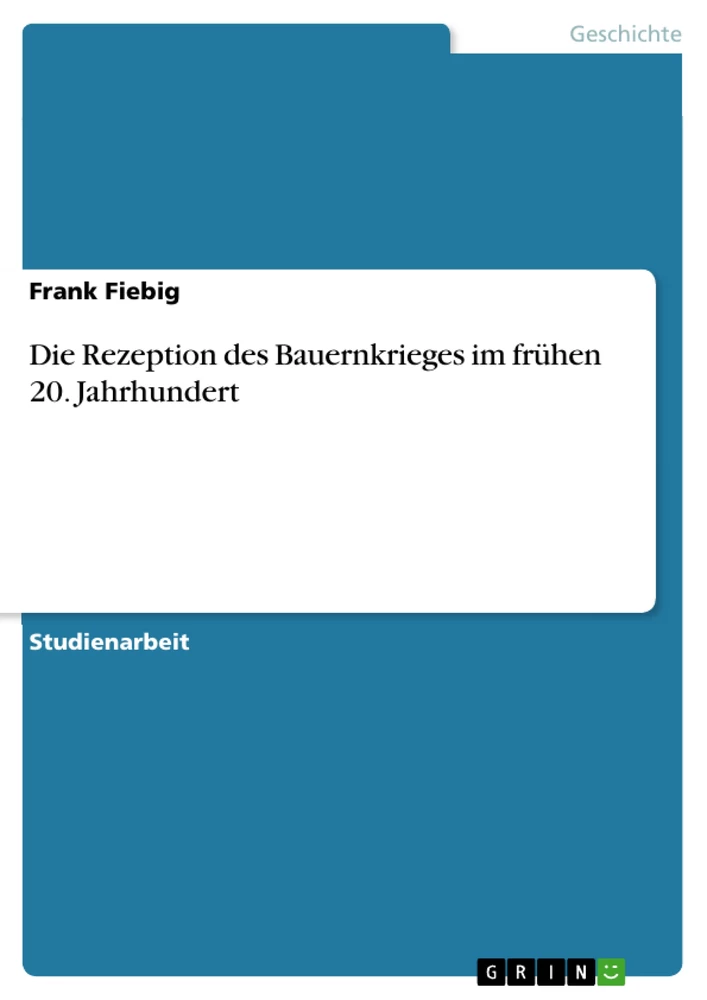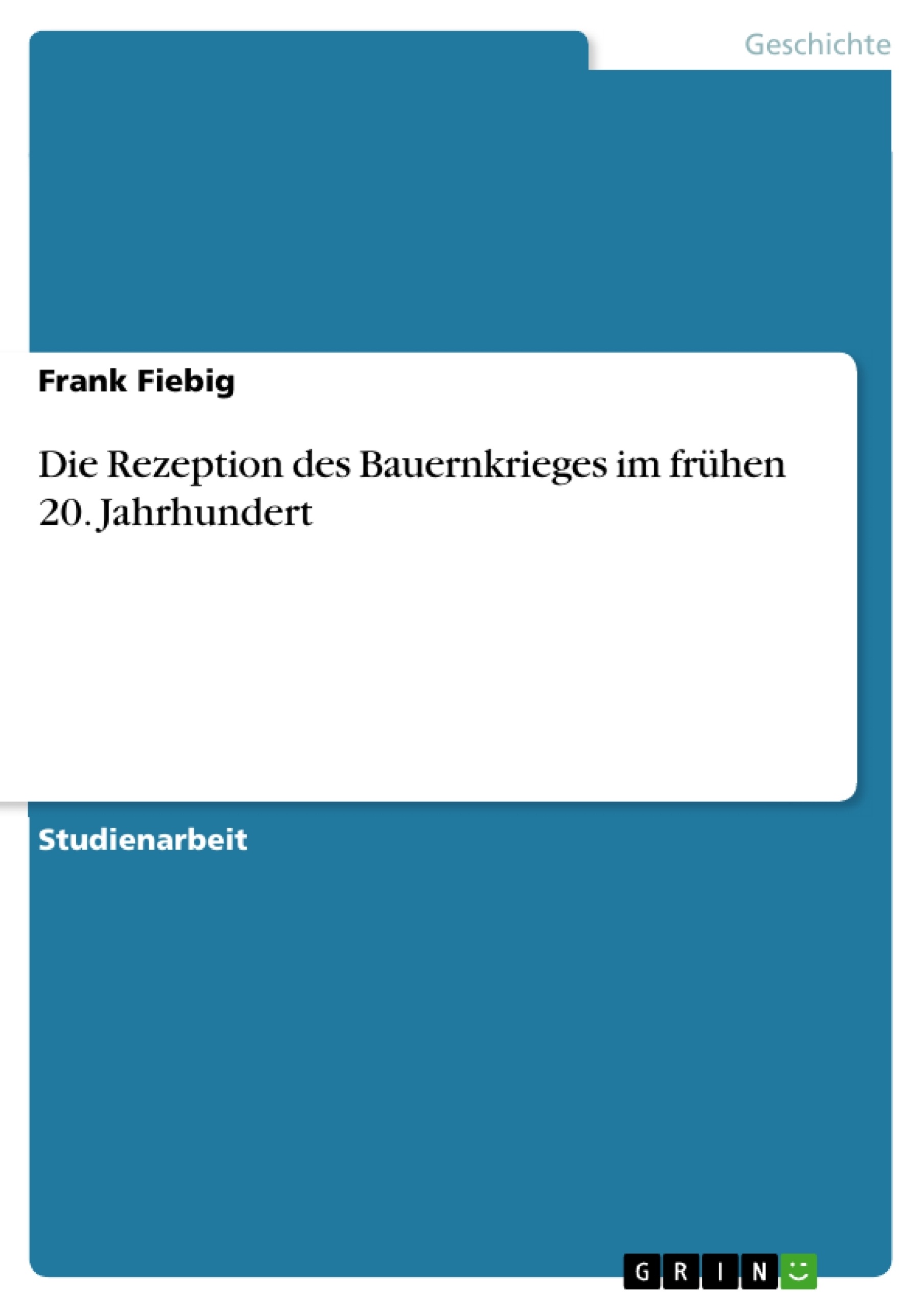In der vorliegenden Arbeit wird zum Einstieg in das Thema der Rezeptionsstand des Bauernkrieges um den Zeitpunkt der Gründung des Deutschen Reiches 1871 gewählt. Dies ist methodisch möglich, da sich der Beginn des 20. Jahrhunderts für das Territorium des späteren Deutschen Reiches bereits hier verorten lässt. Der Reichsbildungsprozess endete mit einem Krieg, als dessen Resultat das Deutsche Reich offiziell gegründet wurde und endete mit dem Untergang infolge des II.Weltkrieges.
Der Umfang des Zweiten Kapitels - der Zeitraum wird bis ca. 1914 reichen - ist nötig, um zu verstehen, wie die allgemeine gesellschaftliche Situation zu diesem Zeitpunkt beschaffen war und durch welche Variablen sie beeinflusst wurde. In den folgenden Kapiteln wird diese dann eine existente, aber zu vernachlässigende Größe darstellen. So ist nachzusehen, dass der Leser mit einem Gros von Informationen gespeist wird, welche nicht primär mit der Rezeptionsgeschichte des Bauernkrieges in Verbindung stehen. Es besteht m.E. jedoch die Notwendigkeit, diese in die Arbeit einzubringen, um bestimmte Sachverhalte klären zu können, um die „cognition historica“, die Zirkularität von Externalisierung, Objektivierung und Internalisierung, welche Giambattista Vico schon 1725 entdeckte zu beachten.
Furet äußerte sich in diesem Kontext 1978, dass sich die Interpretation von geschichtlichen Ereignissen immer nur durch den gesellschaftlichen Hintergrund zur Zeit der Interpretation erklären lässt, da sich die subjektive Meinung zwangsläufig in dem Beschriebenen widerspiegelt. Infolge dessen sei die Objektivität des Historikers nur dadurch herstellbar, dass dieser zeigt, von welcher Ebene politischen Bewusstseins er redet und wie er methodisch vorgeht. So verhält es sich auch bei Leopold von Ranke, dessen lang anhaltende historische Objektivität in Bezug auf den Bauernkrieg nicht mehr angenommen wird und die somit den Ausgangspunkt der Arbeit bildet.
Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- Einleitung
- „Deutsche Identitätssuche“
- VON LUTHER ZU BISMARCK
- BESINNUNG AUF GERMANENTUM UND RASSE ALS NATIONENBILDENDES ELEMENT.
- KONFLIKTLINIE STADT - LAND.
- ZWISCHENFAZIT
- Neuinterpretation des Bauernkrieges
- NEUFINDUNG
- MOS GERMANIUM VS. IUS ROMANUM
- DIE BAUERNKRIEGSINTERPRETATION IN FOLGE EINES PARADIGMENWECHSELS.
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rezeption des Deutschen Bauernkrieges im frühen 20. Jahrhundert, beginnend mit der Reichsgründung 1871 bis ca. 1914. Sie analysiert, wie die gesellschaftliche Situation und die Interpretationen der deutschen Geschichte diese Rezeption beeinflussten.
- Die Suche nach einer „deutschen Identität“ und ihre Auswirkungen auf die Rezeption des Bauernkrieges.
- Die Rolle des Germanentums und der Rasse als nationenbildende Elemente in der frühen Interpretation des Bauernkrieges.
- Der Konflikt zwischen Stadt und Land und seine Bedeutung für die Rezeption des Bauernkrieges.
- Der Einfluss von Paradigmenwechseln in der Geschichtsforschung auf die Interpretation des Bauernkrieges.
- Die Bedeutung des Bauernkrieges als „Naturereignis“ im Kontext der deutschen Geschichte und seine Relevanz für die nationale Identität.
Zusammenfassung der Kapitel
- Prolog: Der Prolog stellt die Rezeption des Bauernkrieges um die Zeit der Reichsgründung 1871 in den Kontext der deutschen Geschichte. Er führt die methodische Herangehensweise und die Bedeutung der gesellschaftlichen Situation für die Interpretation von historischen Ereignissen ein.
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Deutschen Bauernkrieg als „Naturereignis“ vor und skizziert die unterschiedlichen Interpretationen des Bauernkrieges und der Reformation im 19. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Arbeiten von Leopold von Ranke und anderen Historikern, die dem Bauernkrieg eine eigene Bedeutung auf der Basis früherer Unruhen, verfassungsrechtlicher Aspekte und der sozialen Not der Bauern attestierten.
- „Deutsche Identitätssuche“: Dieser Abschnitt untersucht die Suche nach einer „deutschen Identität“ im frühen 20. Jahrhundert und ihre Auswirkungen auf die Rezeption des Bauernkrieges. Er analysiert die Rolle des Germanentums und der Rasse als nationenbildende Elemente, den Konflikt zwischen Stadt und Land und die daraus resultierenden Interpretationen des Bauernkrieges.
- Neuinterpretation des Bauernkrieges: Dieser Abschnitt beleuchtet die Veränderungen in der Interpretation des Bauernkrieges im frühen 20. Jahrhundert, insbesondere im Kontext von Paradigmenwechseln in der Geschichtsforschung. Er analysiert die Neuinterpretationen des Bauernkrieges im Hinblick auf die Frage nach einer „deutschen Identität“ und den Stellenwert des Germanentums.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Rezeption des Deutschen Bauernkrieges im frühen 20. Jahrhundert. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Deutscher Bauernkrieg, Rezeption, deutsche Identität, Germanentum, Rasse, Stadt-Land-Konflikt, Paradigmenwechsel, Historiographie, Leopold von Ranke, Reformation.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde der Bauernkrieg im frühen 20. Jahrhundert wahrgenommen?
Die Rezeption war stark von der Suche nach einer „deutschen Identität“ geprägt, wobei der Bauernkrieg oft als nationales „Naturereignis“ oder im Kontext von Rasse und Germanentum gedeutet wurde.
Welche Rolle spielte Leopold von Ranke für das Bauernkriegsbild?
Rankes Sichtweise bildete den Ausgangspunkt der Arbeit, wobei seine vermeintliche Objektivität im frühen 20. Jahrhundert zunehmend kritisch hinterfragt wurde.
Was bedeutet „cognition historica“ in diesem Zusammenhang?
Es bezieht sich auf die Zirkularität von Geschichtsdeutung, bei der die Interpretation eines Ereignisses immer durch den gesellschaftlichen Hintergrund der Zeit der Interpretation beeinflusst wird.
Warum war die Konfliktlinie Stadt-Land für die Rezeption wichtig?
Der Gegensatz zwischen der aufstrebenden urbanen Moderne und dem konservativen ländlichen Raum beeinflusste massiv, wie die Motive der Bauern von 1525 im frühen 20. Jahrhundert bewertet wurden.
Wie änderte sich die Interpretation durch Paradigmenwechsel?
Die Arbeit analysiert, wie sich die Sichtweise von einer rein verfassungsrechtlichen oder religiösen Deutung hin zu einer völkischen oder sozialpsychologischen Interpretation verschob.
- Arbeit zitieren
- Frank Fiebig (Autor:in), 2007, Die Rezeption des Bauernkrieges im frühen 20. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446690