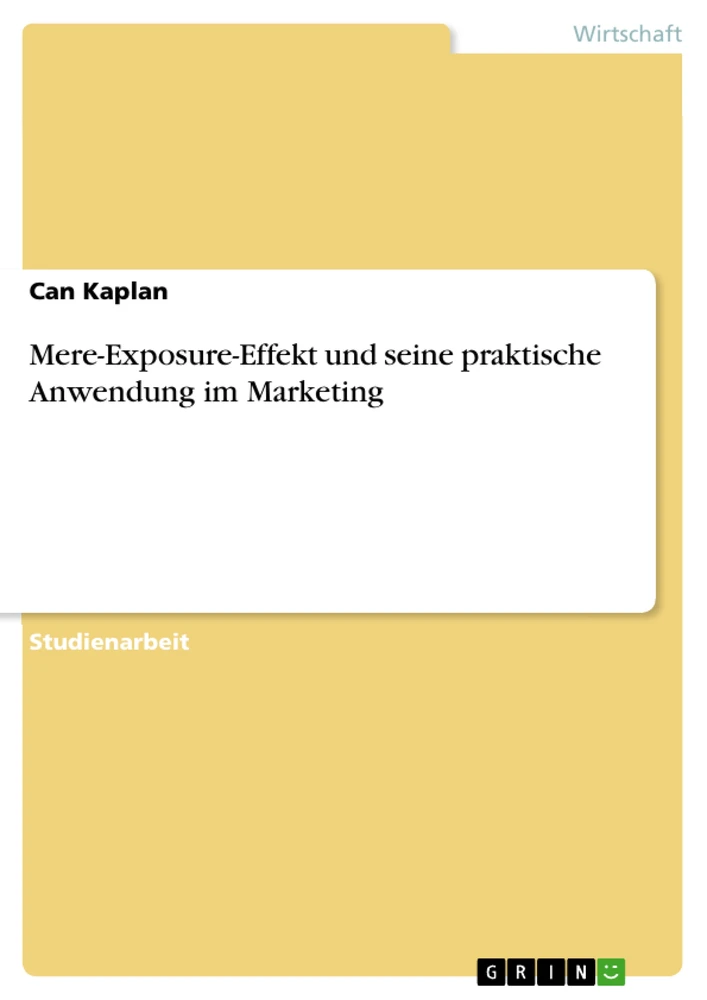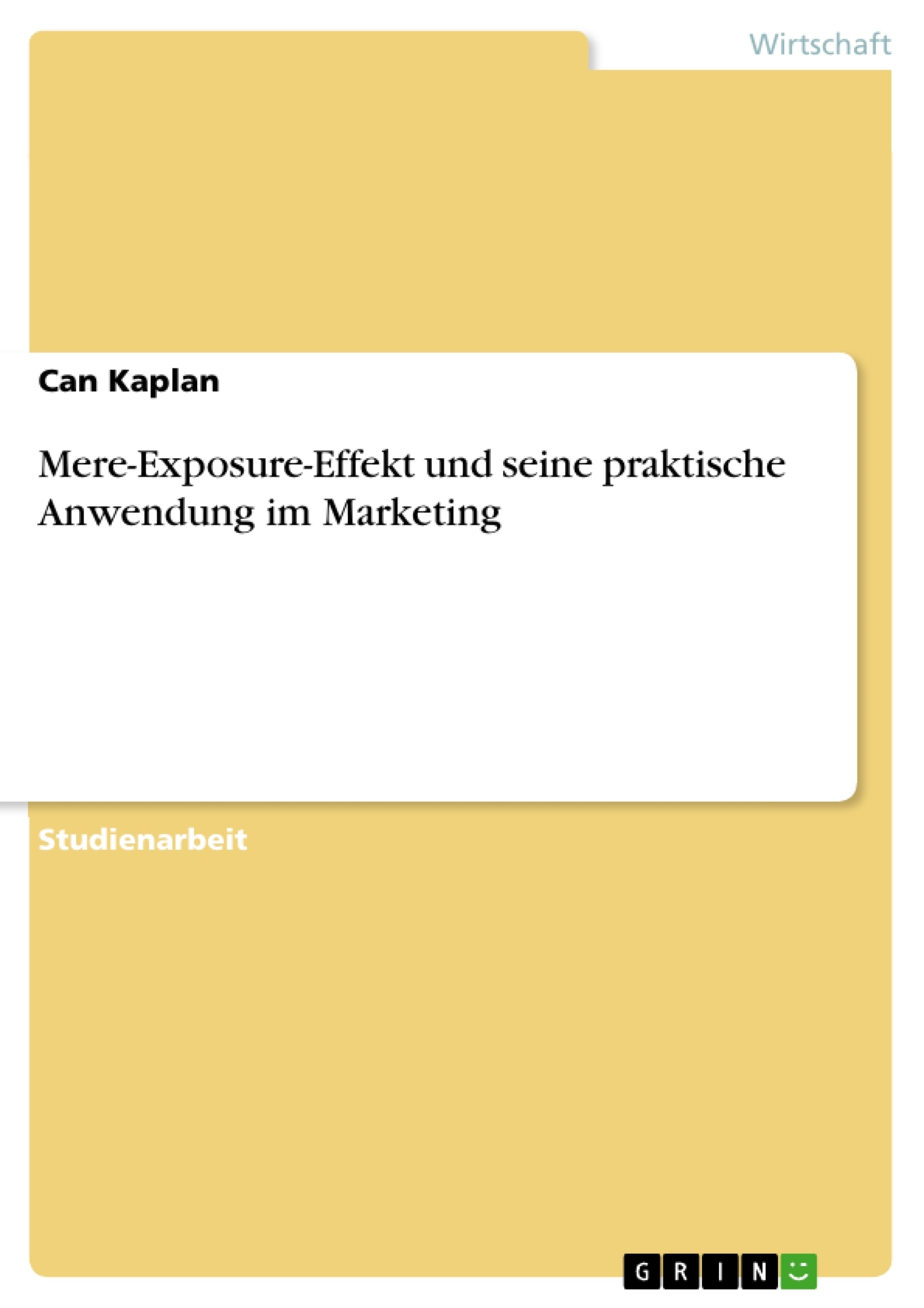Wie kann der Werbetreibende bei der derzeitigen Informationsüberlastung und der zunehmend ablehnenden Haltung der Konsumenten ein positives Image aufbauen und seine Produkte erfolgreich vermarkten? Wie kann der Konsument eine positive Einstellung gegenüber einer Marke entwickeln ohne diese bewusst wahrzunehmen? Inwieweit diese Überlegungen heute in der Werbepraxis Anwendung finden und ob eine unbewusste Beeinflussung neurologisch möglich ist, soll in dieser Seminararbeit anhand der Wirkung des Mere-Exposure-Effektes im Bereich des Product-Placements dargestellt werden.
Durch die steigende Informationsflut im Alltag einerseits und die limitierten Verarbeitungs- und Informationsaufnahmekapazitäten beim Konsumenten andererseits nehmen die Herausforderungen an die Werbetreibenden immer weiter zu. Mit der fortschreitenden Digitalisierung stellt diese Informationsüberlastung eine kaum aufzuhaltende Bewegung dar. Demnach wird es zunehmend schwieriger, die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf die Werbebotschaft von Produkten zu lenken. Große Informationsmengen werden vom Konsumenten nur partiell bewusst verarbeitet und laufen ohne Beanspruchung der Aufmerksamkeit ab. Um erfolgreich Werbung zu betreiben und somit den Werbeempfänger zum Käufer des Produktes zu machen, muss verstanden werden, warum und wie der Werbeempfänger auf die dargebotene Werbung reagiert und inwiefern seine Einstellungen bewusst gesteuert werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Mere-Exposure-Effekt und seine praktische Anwendung im Marketing. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen der Informationsüberlastung im modernen Marketing und sucht nach Wegen, die Wahrnehmung von Werbung zu erhöhen. Ein Schwerpunkt liegt auf der kritischen Bewertung der Verbindung von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und Marketingstrategien, insbesondere im Kontext von Product-Placement.
- Informationsüberlastung und eingeschränkte menschliche Informationsverarbeitungskapazität
- Der Mere-Exposure-Effekt und implizite Gedächtniseffekte
- Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse im Marketing
- Kritische Würdigung der Verbindung von Neurokognition und Marketingstrategien
- Empirische Untersuchung zur Anwendbarkeit des Mere-Exposure-Effekts
Zusammenfassung der Kapitel
Abstract: Der Abstract fasst die Kernaussagen der Seminararbeit zusammen. Er beschreibt die Problematik der Informationsüberlastung im modernen Marketing und die Notwendigkeit, strategische Marketingmaßnahmen mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zu verknüpfen, um die Wahrnehmung von Werbung zu steigern. Besonders wird der Mere-Exposure-Effekt und seine Anwendung im Kontext von Product-Placement hervorgehoben. Die Arbeit kündigt eine empirische Untersuchung an, deren Ergebnisse kritisch gewürdigt und in Handlungsempfehlungen umgesetzt werden sollen.
Schlüsselwörter
Mere-Exposure-Effekt, Marketing, Neurowissenschaften, Informationsverarbeitung, Werbung, Product-Placement, implizites Gedächtnis, empirische Untersuchung, Konsumentenverhalten.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Anwendung des Mere-Exposure-Effekts im Marketing
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Mere-Exposure-Effekt und seine praktische Anwendung im Marketing. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bewältigung von Informationsüberlastung im modernen Marketing und der Verbindung von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen mit Marketingstrategien, insbesondere im Kontext von Product-Placement.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Informationsüberlastung und die begrenzte menschliche Informationsverarbeitungskapazität, den Mere-Exposure-Effekt und implizite Gedächtniseffekte, die Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse im Marketing, eine kritische Würdigung der Verbindung von Neurokognition und Marketingstrategien sowie eine empirische Untersuchung zur Anwendbarkeit des Mere-Exposure-Effekts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis mit Abstract, Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis. Sie umfasst eine detaillierte Zielsetzung und Beschreibung der Themenschwerpunkte, eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselbegriffen.
Was wird im Abstract zusammengefasst?
Der Abstract fasst die Kernaussagen der Arbeit zusammen. Er beschreibt die Problematik der Informationsüberlastung im Marketing und die Notwendigkeit, Marketingmaßnahmen mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zu verknüpfen, um die Werbewirkung zu steigern. Der Mere-Exposure-Effekt und seine Anwendung im Product-Placement werden hervorgehoben. Die empirische Untersuchung und deren Ergebnisse mit Handlungsempfehlungen werden angekündigt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Mere-Exposure-Effekt, Marketing, Neurowissenschaften, Informationsverarbeitung, Werbung, Product-Placement, implizites Gedächtnis, empirische Untersuchung, Konsumentenverhalten.
Welche Fragestellung wird in der empirischen Untersuchung behandelt?
Die empirische Untersuchung, deren genaue Fragestellung im Hauptteil der Arbeit erläutert wird, zielt darauf ab, die Anwendbarkeit des Mere-Exposure-Effekts zu überprüfen und zu evaluieren.
Welche praktischen Implikationen hat die Arbeit?
Die Arbeit liefert Erkenntnisse für Marketingpraktiker, die Strategien zur Steigerung der Werbewirkung unter Berücksichtigung der Informationsüberlastung und neurowissenschaftlicher Erkenntnisse entwickeln möchten. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung sollen in Handlungsempfehlungen münden.
- Quote paper
- Can Kaplan (Author), 2017, Mere-Exposure-Effekt und seine praktische Anwendung im Marketing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446709