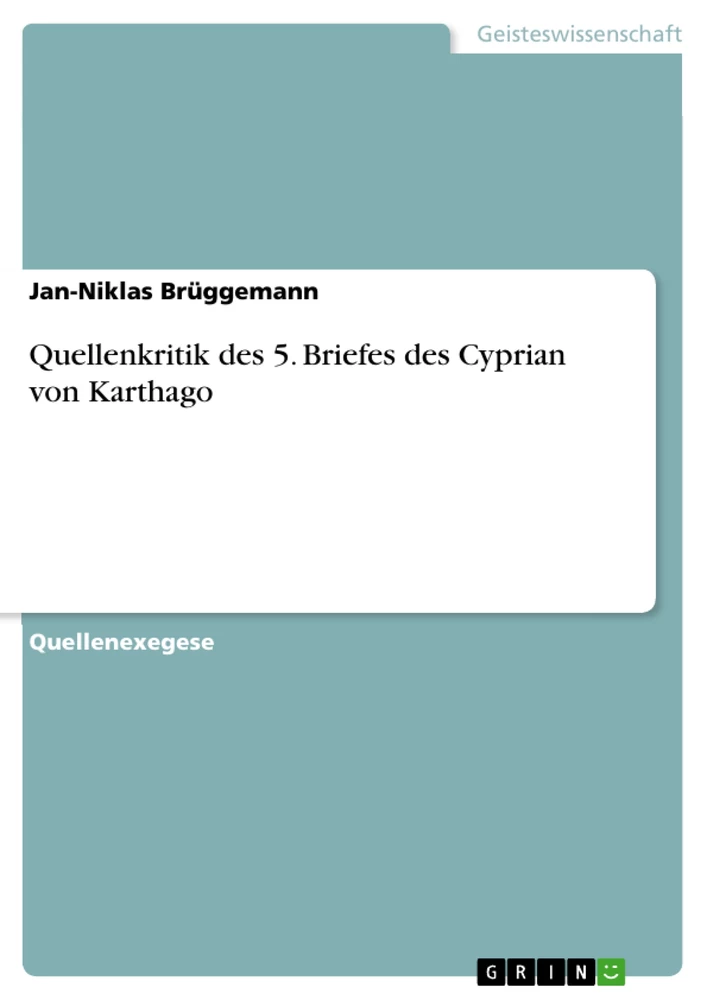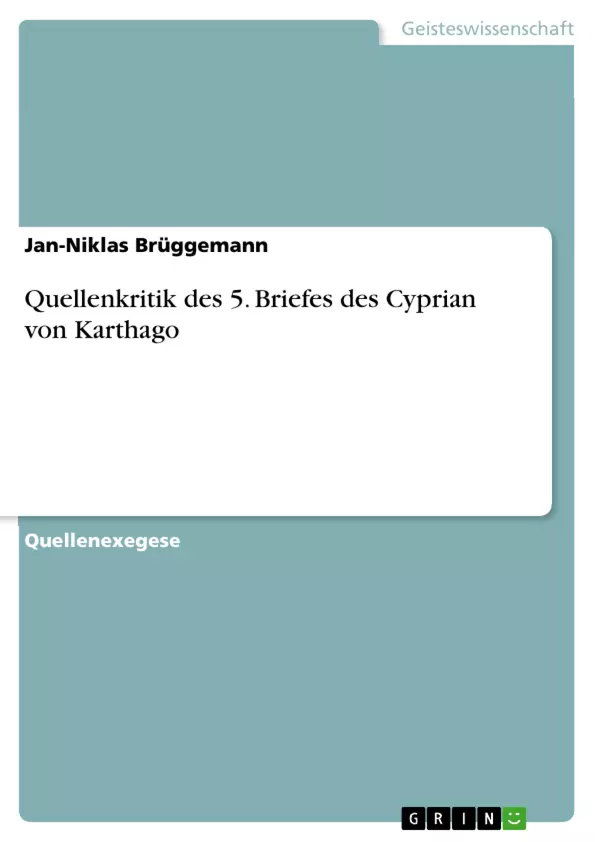1.Einführung
Diese Quellenkritik beschäftigt sich mit dem 5. Brief von Cyprian von Karthago, Bischof von Karthago. Nach einer kurzen Quellenbeschreibung kläre ich zunächst die Gegebenheiten von Ort, Zeit, Verfasser und Adressat. Es folgt anschließend die sachliche Aufschlüsselung und eine Einordnung in den historischen Hintergrund der Quelle. Dieses führt dann zu einer Inhaltsangabe und einer anschließenden Interpretation des Briefes. Letztlich erfolgt im Fazit die Reflexion der gewonnenen Ergebnisse.
Nach der Sichtung von Quelle und Literatur stellten sich zwei Fragen, die ich mit Hilfe der Quellenkritik beantworten möchte. Die erste Frage wäre „Warum mahnte Cyprian von Karthago in seinem 5. Brief an den Klerus zu Ruhe und Besonnenheit“? Die zweite Frage, die sich mir stellte war „Was lässt sich aus der Quelle über die Aufgaben der Amtsträger in der decianischen Christenverfolgung herausfinden“. Dieses sind die beiden Fragen, die ich mit Hilfe dieser Quellenkritik beantworten möchte.
2. Quellenkritik
2.1 Quellenbeschreibung
Der 5. Brief Cyprians stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Frühjahr 250 und kommt somit aus der Zeit der decianischen Christenverfolgung. Cyprian sendete den Brief aus einer unbekannten Zufluchtstätte und ist war den Klerus der Hauptstadt Karthago gerichtet. Er mahnte darin den Klerus zur Ruhe und Besonnenheit und darauf, die Bekenner, die ins Gefängnis geworfen wurden, nur unter größter Vorsicht zu besuchen. Des Weiteren legte Cyprian dem dortigen Klerus ans Herz, den Armen und Schwachen zu helfen und für sie zu sorgen. Ebenfalls kann man dem Brief auch entnehmen, wie sich der Klerus in dieser Zeit zu verhalten hatte. Seien es die alltäglichen Aufgaben im Dienst des Herrn oder auch die Versorgung und Verpflegung der Armen und Schwachen.
Eine schriftliche Kopie des besagten Briefes kann heute in der „Bibliothek der Kirchenväter“ online eingesehen werden. Ein Ausdruck dieser Kopie befindet sich im Anhang dieser Arbeit.
2.2 Äußere Quellenkritik
Thascius Caecilius Cyprianus war Mitglied einer wohlhabenden und alteingesessenen Familie aus Karthago. Er erhielt eine gute Ausbildung und wirkte als erfolgreicher Advokat, Lehrer der Rhetorik und war ein guter Redner. In seiner Wissenschaft bildete er junge Menschen aus. Das Christentum wurde Ihm durch seinen Freund Caecilianus nahegebracht. Im Jahre 246 ließ sich Cyprian taufen und wurde Priester. Nach nur drei weiteren Jahren wurde er zum Bischof von Karthago geweiht. Die
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Quellenkritik
- Quellenbeschreibung
- Äußere Quellenkritik
- Innere Quellenkritik
- Tendenzkritik
- Traditionskritik
- Redaktionskritik
- Inhaltsangabe und Quelleninterpretation
- Inhaltsangabe
- Interpretation und Beantwortung der Fragen an die Quellenkritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Quellenkritik analysiert den 5. Brief von Cyprian von Karthago, Bischof von Karthago, im Kontext der decianischen Christenverfolgung. Das Ziel der Analyse ist es, die Hintergründe des Briefes sowie die Motivation und Absichten Cyprians zu verstehen, insbesondere im Hinblick auf seine Aufforderung zum besonnenen Verhalten des Klerus in dieser schwierigen Zeit.
- Cyprians Botschaft an den Klerus
- Die Rolle der Amtsträger in der Verfolgung
- Die soziale und theologische Situation der Gemeinde in Karthago
- Cyprians Rhetorik und seine theologischen Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den Kontext und die Fragestellungen der Analyse definiert. Das zweite Kapitel widmet sich der Quellenkritik und liefert detaillierte Informationen zur Quelle, ihrer Entstehung und zum Verfasser Cyprian von Karthago. Es umfasst die äußere Quellenkritik, die den historischen Rahmen des Briefes beleuchtet, sowie die innere Quellenkritik, die sich mit der Sprache, dem Stil und den Intentionen des Autors beschäftigt. Im dritten Kapitel erfolgt die Inhaltsangabe des Briefes und eine Interpretation seiner zentralen Aussagen. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und die wichtigsten Erkenntnisse aus der Quellenkritik hervorhebt.
Schlüsselwörter
Diese Quellenkritik beschäftigt sich mit zentralen Themen wie der decianischen Christenverfolgung, der Rolle der Amtsträger in der Kirche, dem Verhältnis von Laien und Klerus, Cyprians theologischem Verständnis, dem Einfluss Tertullians, der Rhetorik und der Bedeutung von Quellenkritik im historischen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der historische Kontext des 5. Briefes von Cyprian?
Der Brief entstand im Frühjahr 250 während der decianischen Christenverfolgung, als Cyprian sich in einer unbekannten Zufluchtsstätte befand.
An wen richtete sich der Brief und was war die Kernbotschaft?
Der Brief war an den Klerus von Karthago gerichtet. Cyprian mahnte zu Ruhe und Besonnenheit und gab Anweisungen zum vorsichtigen Umgang mit inhaftierten Bekennern.
Welche Aufgaben hatten die Amtsträger laut der Quelle?
Die Amtsträger sollten den Dienst des Herrn aufrechterhalten und insbesondere für die Versorgung der Armen und Schwachen in der Gemeinde sorgen.
Wer war Cyprian von Karthago?
Thascius Caecilius Cyprianus war ein ehemaliger Rhetorik-Lehrer und Advokat, der 246 Christ wurde und bereits drei Jahre später zum Bischof von Karthago geweiht wurde.
Was umfasst die innere Quellenkritik in dieser Arbeit?
Die innere Quellenkritik analysiert die Tendenz, Tradition und Redaktion des Briefes, um die Intentionen des Autors und die theologische Ausrichtung zu verstehen.
- Quote paper
- Bachelor Jan-Niklas Brüggemann (Author), 2017, Quellenkritik des 5. Briefes des Cyprian von Karthago, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446720