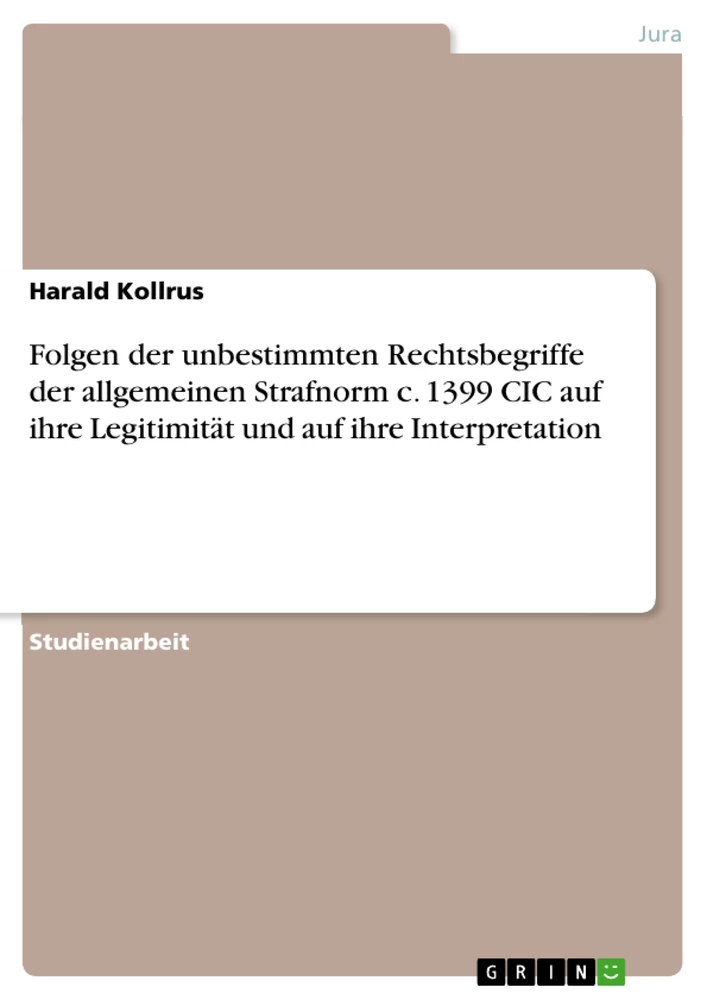Die allgemeine Strafvorschrift c. 1399 CIC regelt nur sehr allgemein, dass bei besonderer Schwere der Rechtsverletzung und Dringlichkeit für Verhütung oder Behebung eines Ärgernisses die „Verletzung eines Gesetzes mit einer gerechten Strafe belegt werden“ kann. Nach diesem Wortlaut könnte ein Richter daher unter den weiteren Voraussetzungen jede noch so geringe Verletzung von Gesetzen bestrafen. Deshalb wird vielfach sogar die Legitimität, also die Geltung dieser Strafnorm in Frage gestellt. Damit die Strafnorm Geltung beanspruchen kann, wird in der Literatur über den Wortlaut der Vorschrift hinaus verlangt, dass die Strafe vorher angedroht werden müsse. Außerdem ist umstritten, wie die unbestimmten Rechtsbegriffe interpretiert werden sollen.
Diese Hausarbeit verfolgt das Ziel, die von Literaturmeinungen gegen die Legitimität erhobenen Einwendungen sowie die unterschiedlichen Interpretation im Hinblick auf Voraussetzungen und Rechtsfolge des c. 1399 CIC zu prüfen. Spannungsverhältnisse mit widerstreitenden kanonischen Regelungen sollen im Wege der „praktischen Konkordanz“ mit dem Ziel gelöst werden, dass sich die widerstreitenden Interessen bestmöglich entfalten können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- a) Ziel der Hausarbeit
- b) Verlauf der Prüfung
- 2. Rechtstechnische Analyse der Rechtsnorm
- 3. Interpretation des objektiven Tatbestandsmerkmals der Gesetzesverletzung
- a) Verletzung des Legalitätsprinzips nulla poena sine lege
- (1) Gesetzesvorbehalt nulla poena sine lege scripta
- (2) Analogieverbot nullum crimen, nulla poena sine lege stricta
- (3) Rückwirkungsverbot nullum crimen, nulla poena sine lege praevia
- (4) Bestimmtheitsgebot nullum crimen, nulla poena sine lege certa
- b) Verletzung des Gewaltenteilungsprinzips
- c) Kanonische Gewaltenunterscheidung
- d) Rechtliche Folgen der Verletzung des Legalitätsprinzips für die Auslegung von c. 1399 CIC
- a) Verletzung des Legalitätsprinzips nulla poena sine lege
- 4. Subjektives Tatbestandsmerkmal der schweren Zurechenbarkeit im Sinne von c. 1321 § 1 CIC und das Schuldprinzip nulla poena sine culpa
- 5. Objektive Bedingungen der Strafbarkeit (Tatbestandsannex)
- 6. Rechtsfolge „gerechte Strafe“ (iusta poena)
- a) Legitime Androhung einer unbestimmten Strafe in c. 1399 CIC
- b) Verwarnung mit Aufforderung unter Fristsetzung, seine Widersetzlichkeit aufzugeben
- c) Richterlicher Ermessensspielraum für Art und Umfang der Strafe
- d) Spannungsverhältnis Rechtssicherheit für Gläubiger versus Gerechtigkeit im Hinblick auf die allgemeine Strafandrohung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die allgemeine Strafvorschrift c. 1399 CIC, insbesondere im Hinblick auf ihre Legitimität und die Herausforderungen bei ihrer Interpretation. Es werden Einwände gegen ihre Gültigkeit geprüft und verschiedene Interpretationen der Voraussetzungen und Rechtsfolgen untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Vereinbarkeit mit dem Legalitätsprinzip.
- Legitimität der allgemeinen Strafnorm c. 1399 CIC
- Interpretation der unbestimmten Rechtsbegriffe in c. 1399 CIC
- Vereinbarkeit von c. 1399 CIC mit dem Legalitätsprinzip
- Spannungsverhältnis zwischen Rechtssicherheit und Gerechtigkeit
- Anforderungen an die Auslegung von c. 1399 CIC
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Ziel der Hausarbeit – die Prüfung von Einwendungen gegen die Legitimität der allgemeinen Strafnorm c. 1399 CIC und die Analyse unterschiedlicher Interpretationsansätze. Der methodische Ansatz, der die Analyse der Rechtsnormstruktur, die Untersuchung der einzelnen Bedingungen der Vorschrift und die Lösung von Spannungsverhältnissen durch "praktische Konkordanz" umfasst, wird skizziert.
2. Rechtstechnische Analyse der Rechtsnorm: Dieses Kapitel analysiert die Struktur der Strafnorm c. 1399 CIC, indem es die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale, die objektiven Bedingungen der Strafbarkeit und die Strafandrohung identifiziert und systematisch gliedert. Es bietet eine detaillierte Zerlegung des Gesetzestextes, um die Grundlage für die spätere Interpretation zu legen und die Argumentationslinien der Literatur zu strukturieren.
3. Interpretation des objektiven Tatbestandsmerkmals der Gesetzesverletzung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Auslegung des Tatbestandsmerkmals "Gesetzesverletzung" im Kontext von c. 1399 CIC. Es analysiert kritische Punkte bezüglich des Legalitätsprinzips (nulla poena sine lege), unterteilt in die Teilprinzipien des Gesetzesvorbehalts, des Analogieverbots, des Rückwirkungsverbots und des Bestimmtheitsgebots. Die Kompatibilität von c. 1399 CIC mit diesen Prinzipien wird eingehend diskutiert, wobei insbesondere die Unbestimmtheit der Norm und die daraus resultierenden Probleme im Hinblick auf Rechtssicherheit und Gewaltenteilung hervorgehoben werden.
4. Subjektives Tatbestandsmerkmal der schweren Zurechenbarkeit im Sinne von c. 1321 § 1 CIC und das Schuldprinzip nulla poena sine culpa: Dieses Kapitel untersucht das subjektive Tatbestandsmerkmal der schweren Zurechenbarkeit gemäß c. 1321 CIC und die damit verbundenen Aspekte des Schuldprinzips (nulla poena sine culpa). Es analysiert die Anforderungen an die Zurechnung des objektiven Tatbestands aufgrund von Vorsatz oder Fahrlässigkeit, und wie diese im Zusammenhang mit c. 1399 CIC zu verstehen sind.
5. Objektive Bedingungen der Strafbarkeit (Tatbestandsannex): Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Interpretation der objektiven Bedingungen der Strafbarkeit im Zusammenhang mit c. 1399 CIC. Es erörtert die zusätzlichen Voraussetzungen, die neben dem eigentlichen Tatbestand erfüllt sein müssen, damit eine Strafe verhängt werden kann, und analysiert ihre Bedeutung für die Anwendung der Norm.
6. Rechtsfolge „gerechte Strafe“ (iusta poena): Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rechtsfolge "gerechte Strafe" in c. 1399 CIC. Es analysiert die Legitimität der Androhung einer unbestimmten Strafe, die Bedeutung der Verwarnung vor der Strafverhängung, den Ermessensspielraum des Richters und das Spannungsverhältnis zwischen Rechtssicherheit für Gläubige und Gerechtigkeit. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird als zentraler Aspekt der gerechten Strafverhängung im Kontext der Auslegung von c. 1399 CIC hervorgehoben.
Schlüsselwörter
c. 1399 CIC, Kanonisches Strafrecht, Legalitätsprinzip, Unbestimmte Rechtsbegriffe, Interpretation, Legitimität, Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Verhältnismäßigkeit, Schuldprinzip, Gewaltenteilung, Praktische Konkordanz.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Analyse der allgemeinen Strafvorschrift c. 1399 CIC
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert die allgemeine Strafvorschrift c. 1399 CIC hinsichtlich ihrer Legitimität und der Herausforderungen bei ihrer Interpretation. Es werden Einwände gegen ihre Gültigkeit geprüft und verschiedene Interpretationen der Voraussetzungen und Rechtsfolgen untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Vereinbarkeit mit dem Legalitätsprinzip.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Legitimität der Norm c. 1399 CIC, die Interpretation ihrer unbestimmten Rechtsbegriffe, ihre Vereinbarkeit mit dem Legalitätsprinzip, das Spannungsverhältnis zwischen Rechtssicherheit und Gerechtigkeit sowie die Anforderungen an ihre Auslegung.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, rechtstechnische Analyse der Norm, Interpretation des objektiven Tatbestandsmerkmals (Gesetzesverletzung), Untersuchung des subjektiven Tatbestandsmerkmals (schwere Zurechenbarkeit), Betrachtung der objektiven Bedingungen der Strafbarkeit und Analyse der Rechtsfolge „gerechte Strafe“.
Welche Aspekte des Legalitätsprinzips werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Vereinbarkeit von c. 1399 CIC mit den Teilprinzipien des Legalitätsprinzips: Gesetzesvorbehalt, Analogieverbot, Rückwirkungsverbot und Bestimmtheitsgebot. Die Unbestimmtheit der Norm und die daraus resultierenden Probleme bezüglich Rechtssicherheit und Gewaltenteilung werden eingehend diskutiert.
Wie wird das Schuldprinzip (nulla poena sine culpa) behandelt?
Die Arbeit untersucht das subjektive Tatbestandsmerkmal der schweren Zurechenbarkeit gemäß c. 1321 CIC und die damit verbundenen Aspekte des Schuldprinzips. Es wird analysiert, wie die Anforderungen an die Zurechnung des objektiven Tatbestands im Zusammenhang mit c. 1399 CIC zu verstehen sind.
Was ist der Fokus des Kapitels zur „gerechten Strafe“ (iusta poena)?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Legitimität der Androhung einer unbestimmten Strafe, die Bedeutung von Verwarnungen, den richterlichen Ermessensspielraum und das Spannungsverhältnis zwischen Rechtssicherheit für Gläubiger und Gerechtigkeit. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird als zentraler Aspekt hervorgehoben.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen methodischen Ansatz, der die Analyse der Rechtsnormstruktur, die Untersuchung der einzelnen Bedingungen der Vorschrift und die Lösung von Spannungsverhältnissen durch "praktische Konkordanz" umfasst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: c. 1399 CIC, Kanonisches Strafrecht, Legalitätsprinzip, Unbestimmte Rechtsbegriffe, Interpretation, Legitimität, Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Verhältnismäßigkeit, Schuldprinzip, Gewaltenteilung, Praktische Konkordanz.
- Arbeit zitieren
- Prof. Dr. Harald Kollrus (Autor:in), 2018, Folgen der unbestimmten Rechtsbegriffe der allgemeinen Strafnorm c. 1399 CIC auf ihre Legitimität und auf ihre Interpretation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446754