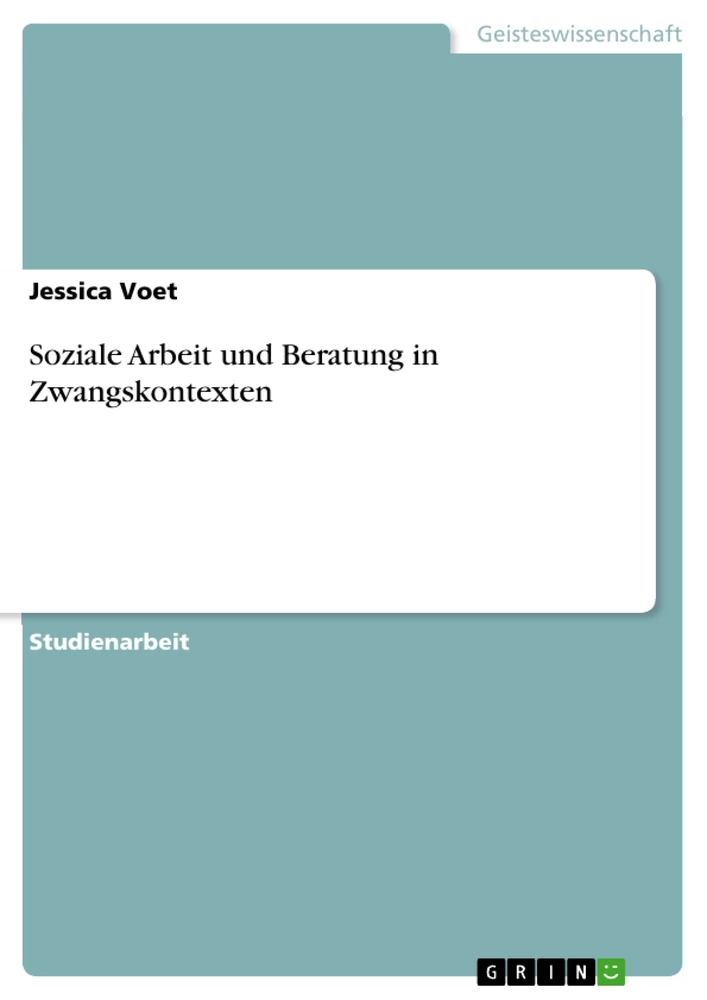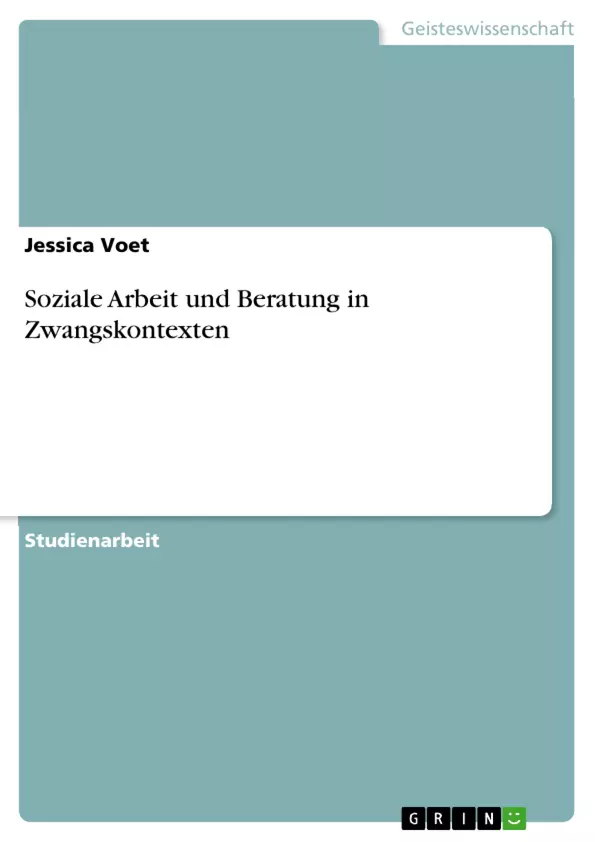Der Begriff „Zwangskontext“ wird verwendet, wenn jemand von anderen Menschen dazu gedrängt wird, einen Sozialen Dienst aufzusuchen oder dieser durch gesetzliche Regelungen zur Kontaktaufnahme verpflichtet wird.
Der Begriff Zwang wird nicht als juristischer Begriff verwendet, sondern beschreibt den Druck von außen, der die Klientinnen und Klienten zur Kontaktaufnahme mit dem Sozialen Dienst drängt. Die Initiative zur Kontaktaufnahme kann anhand einer Skala verdeutlicht werden. Das eine Ende der Skala steht für die Klientinnen und Klienten, die den Kontakt zum Sozialen Dienst aus eigener Initiative aufsuchen. Das andere Ende der Skala steht für die Klientinnen und Klienten, die nicht aus freiem Willen sondern durch eine gerichtliche Anordnung zur Kontaktaufnahme gedrängt wurden. Es wird von einem Zwangskontext gesprochen, wenn es sich um eine fremdinitiierte Kontaktaufnahme handelt. Beispiele hierfür sind, wenn die Klientin bzw. der Klient von anderen Menschen aus dem informellen oder formellen Netzwerk, beispielsweise von Verwandten, Nachbarn oder der Schule gedrängt oder durch gesetzliche Vorgaben zur Kontaktaufnahme gezwungen worden ist. Der ausgeübte Druck oder Zwang kann dabei eher gering ausfallen, wenn beispielsweise jemand seine Partnerin bzw. seinen Partner antreibt eine Beratungsstelle aufzusuchen, weil sie/er mit ihrem/seinem Gehalt nicht richtig umgehen kann. Zum anderen kann der Druck auch erheblicher sein, wenn beispielsweise Kontakte zu einem Bewährungshelfer bzw. einer Bewährungshelferin mit der Androhung der Aufhebung der Bewährungsaussetzung bestehen. Allerdings besteht der Zwang immer in der Kontaktaufnahme als solcher und nicht darin, was in diesen Kontakten geschieht. Die mit dem Kontakt verbundene Motivation wird zunächst außer Acht gelassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Definition und Merkmale eines Zwangskontextes
- 2 Zwangskontexte in der Sozialen Arbeit
- 2.1 Ambulante Jugendhilfe
- 2.2 Bewährungshilfe
- 2.3 Schwangerschaftskonfliktberatung
- 2.4 Schule
- 2.5 Geschlossene Unterbringung in einer Psychiatrie
- 3 „Unfreiwilligkeit“ und „Widerstand“
- 3.1 „Unfreiwilligkeit“ und „Widerstand“ als Lösungsverhalten
- 3.2 Umgang mit „Unfreiwilligkeit“ und „Widerstand“
- 4 Fiktiver Dialog eines Erstgesprächs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Zwangskontexte in der Sozialen Arbeit. Ziel ist es, das Phänomen des Zwangs in verschiedenen Arbeitsfeldern zu beleuchten und den Umgang damit zu analysieren. Die Arbeit fokussiert auf die Herausforderungen und die besondere Rolle der Sozialarbeiter*innen in solchen Situationen.
- Definition und Charakteristika von Zwangskontexten
- Beispiele für Zwangskontexte in unterschiedlichen Bereichen der Sozialen Arbeit
- Der Umgang mit Unfreiwilligkeit und Widerstand der Klient*innen
- Die Rolle der Sozialarbeiter*innen als Vermittler zwischen Klient*innen und Institutionen
- Der Aspekt von Hilfe und Kontrolle im Kontext von Zwang
Zusammenfassung der Kapitel
1 Definition und Merkmale eines Zwangskontextes: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Zwangskontext" und differenziert ihn vom juristischen Begriff "Zwang". Es beschreibt den externen Druck, der Klient*innen zur Kontaktaufnahme mit Sozialen Diensten zwingt, und veranschaulicht dies anhand einer Skala von eigeninitiiertem bis zu gerichtlich angeordnetem Kontakt. Die Rolle der "dritten Instanz", meist Institutionen mit sozialem Kontrollmandat, wird hervorgehoben, wobei die Sozialarbeiter*innen in einer Doppelrolle zwischen Hilfe und Kontrolle agieren – ein "Trialog" zwischen Klient*innen, Sozialarbeiter*innen und Institutionen. Der Begriff "Zwangsbeglückung" wird eingeführt, um den Widerspruch zwischen Zwang und dem Ziel der Hilfe zu verdeutlichen.
2 Zwangskontexte in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit, die durch Zwangskontexte gekennzeichnet sind. Es werden Beispiele wie die ambulante Jugendhilfe (mit dem Druck des Jugendamtes und der Androhung von Sorgerechtsentzug), die Bewährungshilfe (mit gerichtlichen Auflagen und dem Druck möglicher Haftstrafen), und die Schwangerschaftskonfliktberatung (mit gesetzlichen Vorgaben des §219 StGB) detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Formen von Druck und den spezifischen Herausforderungen für die Sozialarbeiter*innen in diesen Kontexten.
Schlüsselwörter
Zwangskontext, Soziale Arbeit, Beratung, Jugendhilfe, Bewährungshilfe, Schwangerschaftskonfliktberatung, Unfreiwilligkeit, Widerstand, Hilfe, Kontrolle, Trialog, soziale Kontrolle, institutioneller Druck, Mandat.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Zwangskontexte in der Sozialen Arbeit
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert Zwangskontexte in der Sozialen Arbeit. Es beleuchtet das Phänomen des Zwangs in verschiedenen Arbeitsfeldern und untersucht den Umgang damit, insbesondere die Herausforderungen und die Rolle der Sozialarbeiter*innen in solchen Situationen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Definition und Charakteristika von Zwangskontexten, Beispiele in verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit (ambulante Jugendhilfe, Bewährungshilfe, Schwangerschaftskonfliktberatung, Schule, Psychiatrie), den Umgang mit Unfreiwilligkeit und Widerstand der Klient*innen, die Rolle der Sozialarbeiter*innen als Vermittler und den Aspekt von Hilfe und Kontrolle im Kontext von Zwang.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Definition von Zwangskontexten und Beispiele in der Sozialen Arbeit) und eine Liste mit Schlüsselbegriffen.
Wie wird der Begriff "Zwangskontext" definiert?
Der Begriff "Zwangskontext" wird definiert und vom juristischen Begriff "Zwang" abgegrenzt. Es wird der externe Druck beschrieben, der Klient*innen zur Kontaktaufnahme zwingt, und eine Skala von eigeninitiiertem bis zu gerichtlich angeordnetem Kontakt dargestellt. Die Rolle von Institutionen mit sozialem Kontrollmandat und die Doppelrolle der Sozialarbeiter*innen zwischen Hilfe und Kontrolle (als "Trialog") werden hervorgehoben. Der Begriff "Zwangsbeglückung" verdeutlicht den Widerspruch zwischen Zwang und dem Ziel der Hilfe.
Welche Beispiele für Zwangskontexte in der Sozialen Arbeit werden genannt?
Das Dokument nennt Beispiele wie die ambulante Jugendhilfe (Druck des Jugendamtes, Androhung von Sorgerechtsentzug), Bewährungshilfe (gerichtliche Auflagen, Druck möglicher Haftstrafen), und Schwangerschaftskonfliktberatung (§219 StGB). Es werden die unterschiedlichen Formen von Druck und die spezifischen Herausforderungen für Sozialarbeiter*innen in diesen Kontexten detailliert beschrieben.
Welche Rolle spielen Sozialarbeiter*innen in Zwangskontexten?
Sozialarbeiter*innen agieren in Zwangskontexten in einer Doppelrolle zwischen Hilfe und Kontrolle. Sie fungieren als Vermittler zwischen Klient*innen und Institutionen und müssen den Spagat zwischen dem Hilfeanspruch und dem institutionellen Druck meistern. Die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, werden im Dokument ausführlich diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Schlüsselbegriffe sind unter anderem: Zwangskontext, Soziale Arbeit, Beratung, Jugendhilfe, Bewährungshilfe, Schwangerschaftskonfliktberatung, Unfreiwilligkeit, Widerstand, Hilfe, Kontrolle, Trialog, soziale Kontrolle, institutioneller Druck, Mandat.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument richtet sich an Personen, die sich akademisch mit Zwangskontexten in der Sozialen Arbeit auseinandersetzen möchten. Es dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Arbeit zitieren
- Jessica Voet (Autor:in), 2018, Soziale Arbeit und Beratung in Zwangskontexten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446760