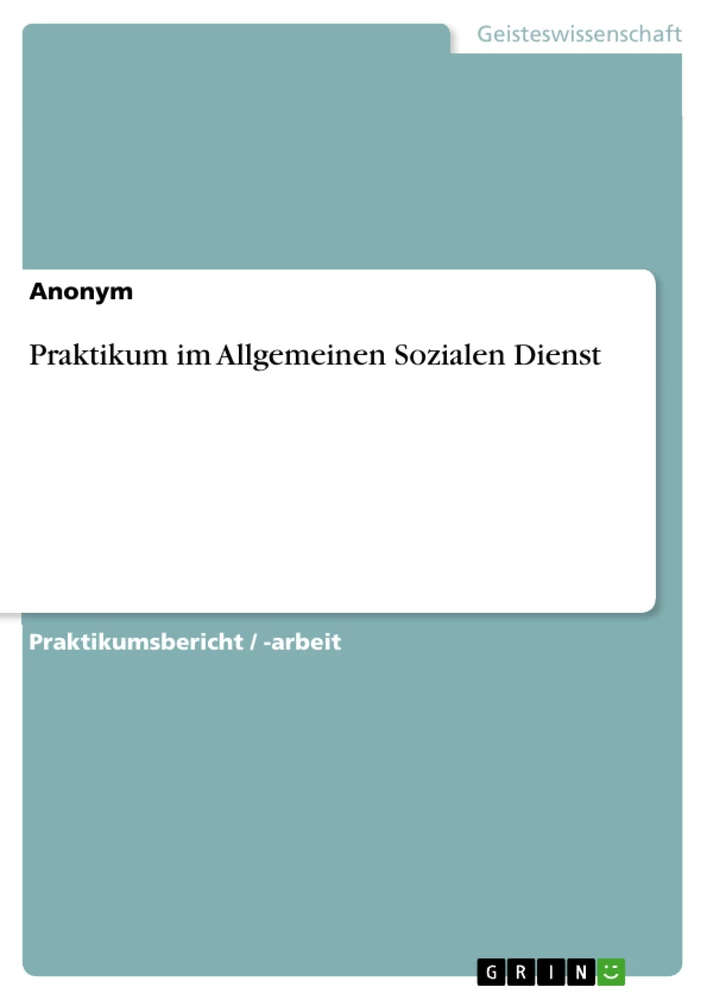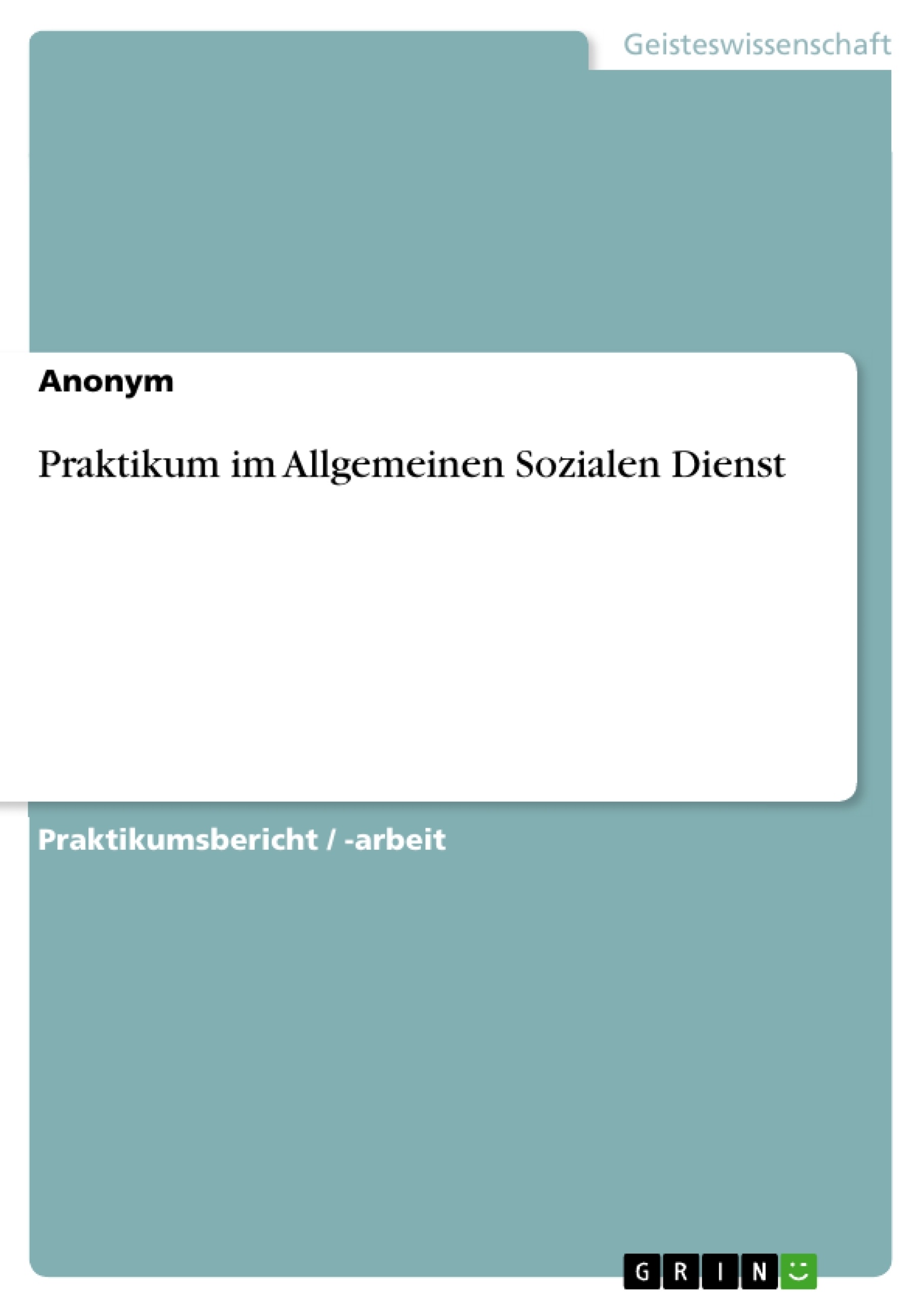Ziel dieser Arbeit ist es, einen breiten Überblick über mein Praxissemester im ASD des Landkreises X zu geben. Zunächst wird der Allgemeine Sozialdienst des Landkreises X vorgestellt. Im weiteren Verlauf erfolgt eine Darstellung der Aufgaben, der Methoden, der Kooperationspartner_innen, der Adressatinnen und Adressaten sowie der wichtigsten Rechtsgrundlagen. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Beschreibung der eigenen Tätigkeiten sowie der Reflexion des Praxissemesters.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Der Allgemeine Sozialdienst des Landkreises [Name]
- 1.1 Aufgaben des Allgemeinen Sozialdienstes
- 1.1.1 Krisenintervention, Kindeswohlgefährdung und Inobhutnahme
- 1.1.2 Sozialpädagogische Diagnostik
- 1.1.3 Hilfen zur Erziehung (§27 SGB VIII)
- 1.1.4 Das Hilfeplanverfahren (§36 SGB VIII)
- 1.2 Methodisches Repertoire
- 1.2.1 Genogramm
- 1.2.2 Netzwerkkarte
- 1.3 Adressatinnen und Adressaten
- 1.4 Kooperationspartner_innen und Netzwerke
- 2 Rechtsgrundlagen für den Allgemeinen Sozialdienst
- 3 Eigene Tätigkeiten
- 4 Reflexion des Praxissemesters
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieses Praktikumsberichts ist es, einen umfassenden Einblick in die Arbeit des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) des Landkreises [Name] zu geben. Der Bericht beleuchtet die Aufgaben, Methoden und Rechtsgrundlagen des ASD, beschreibt die eigenen Tätigkeiten während des Praxissemesters und reflektiert die Erfahrungen aus der Praxis.
- Die Aufgaben und Strukturen des Allgemeinen Sozialdienstes
- Die wichtigsten Rechtsgrundlagen für die Arbeit des ASD
- Die eigene Rolle und Tätigkeiten im ASD
- Die Reflexion des Praxissemesters und die gewonnenen Erkenntnisse
- Die Bedeutung des Kinderschutzes und die Herausforderungen in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Berichts beschreibt die Motivation und die Zielsetzung des Praxissemesters im ASD. Der erste Teil stellt den Allgemeinen Sozialdienst des Landkreises [Name] vor, beleuchtet seine Aufgaben, Methoden, Adressatinnen und Adressaten sowie wichtige Kooperationspartner_innen und Netzwerke. Anschließend werden die wichtigsten Rechtsgrundlagen für die Arbeit des ASD erläutert. Der dritte Teil widmet sich den eigenen Tätigkeiten während des Praxissemesters und dem direkten Kontakt mit Klientinnen und Klienten. Abschließend werden die Erfahrungen des Praxissemesters reflektiert und die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt.
Schlüsselwörter
Der Praktikumsbericht fokussiert sich auf den Allgemeinen Sozialdienst (ASD), Kinderschutz, Hilfen zur Erziehung, Sozialpädagogische Diagnostik, Netzwerkkarte, Genogramm, Rechtsgrundlagen, Praxissemester, Reflexion, Kooperationspartner_innen, Klientinnen und Klienten. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Arbeit im ASD und die Bedeutung der Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren im Bereich der sozialen Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptaufgaben des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD)?
Zu den Aufgaben gehören Krisenintervention, Kinderschutz, Inobhutnahmen, sozialpädagogische Diagnostik sowie die Planung von Hilfen zur Erziehung.
Was ist ein Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII?
Es ist ein strukturierter Prozess, bei dem gemeinsam mit den Betroffenen der Bedarf an Unterstützung ermittelt und die Durchführung der Hilfen koordiniert wird.
Welche Methoden nutzt der ASD in der Praxis?
Wichtige Instrumente sind das Genogramm zur Darstellung von Familienstrukturen und die Netzwerkkarte zur Analyse des sozialen Umfelds.
Auf welcher Rechtsgrundlage arbeitet der ASD?
Die wichtigste Grundlage ist das Achte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), insbesondere die Paragraphen zu Hilfen zur Erziehung und zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.
Mit welchen Partnern kooperiert der ASD?
Der ASD arbeitet eng mit Schulen, Kitas, Ärzten, der Polizei und freien Trägern der Jugendhilfe zusammen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Praktikum im Allgemeinen Sozialen Dienst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446762