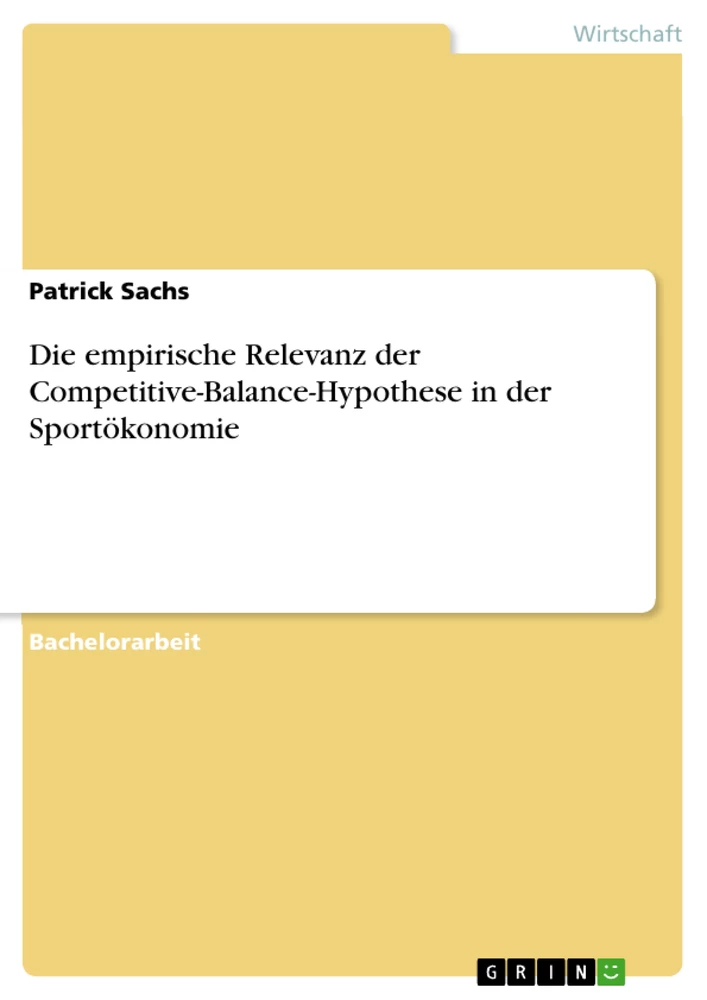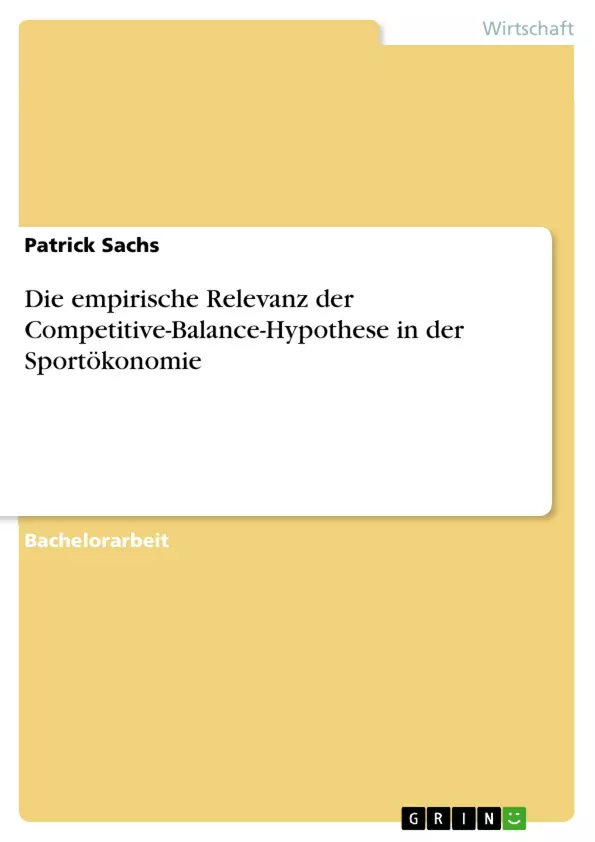"Game 1 of the NBA Finals Is Not Sold Out". Diese Schlagzeile war vor dem ersten Spiel der NBA Finals 2018 zwischen den Cleveland Cavaliers und den Golden State Warriors zu lesen. Die Finalpaarung am Ende der Saison war zum vierten Mal in Folge die Gleiche, die Favoritenrolle bei den Buchmachern war hierbei klar verteilt. Für 10€ Einsatz hätte man 11€ ausgezahlt bekommen, wenn man auf einen Sieg der Warriors in der best of seven Serie gesetzt hätte, 60€ Auszahlung waren für den gleichen Einsatz auf die Cavaliers vorgesehen. Die Ausgangslage versprach vorher also relativ wenig Spannung, das Duell war dementsprechend einseitig und endete nach vier Spielen durch vier Siege der Warriors, die sich damit den dritten Titel in den vergangenen vier Jahren sichern konnten.
All diese Aspekte führen zu der Annahme, dass der Wettbewerb in der NBA relativ unausgeglichen sei. Zwar wurde die oben genannte Schlagzeile später von den Warriors dementiert mit Verweis auf Buchungsfehler und nicht anwesende Dauerkarteninhaber. Jedoch kamen auch Spekulationen auf, dass womöglich mangelnde Ausgeglichenheit des Wettbewerbes zu den leer gebliebenen Plätzen geführt haben könnte. Für Fans und neutrale Zuschauer sei es weniger interessant, eine Serie zu verfolgen, bei welcher die Favoritenrolle von vornherein so klar verteilt ist.
Die Diskussion über die Bedeutung der Ausgeglichenheit eines Wettbewerbes für die Zuschauer wird seit geraumer Zeit geführt. Die Frage, welche Rolle die Unsicherheit eines Spielausganges für die Konsumenten einnimmt, ist für die empirische Forschung ebenso wichtig wie für die Vermarktung einer Liga. Höhere Ausgeglichenheit wird in der Theorie gleichgesetzt mit höherem Nutzen für die Konsumenten, welche sodann bereit seien, mehr für den Konsum der Spiele auszugeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Grundzüge der Sportökonomie
- Die Wertschöpfung der Teams
- Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Sportindustrie
- Gegenüberstellung der Nachwuchssysteme in Europa und den USA
- Theoretisches Modell einer Sportliga
- Formalisierung des Modells
- Kernaussagen des Modells
- Schlussfolgerungen der Modellanalyse
- Methoden zur Messung der UOH
- Exkurs zur Regressionsanalyse
- Schätzung mit OLS und Tobit
- Competitive balance und Stadionbesucher
- Einflussfaktoren auf die Stadionnachfrage
- Bestimmung der UOO
- Competitive balance und Fernsehzuschauer
- Einflussfaktoren auf die Fernsehnachfrage
- Bestimmung der UOO
- Competitive balance anhand der CBR
- Exkurs zur Regressionsanalyse
- Bedeutung der CB
- Ergebnisse für Stadionbesucher
- Ergebnisse für Fernsehzuschauer
- Ergebnisse anhand der CBR
- Institutionen zur Sicherstellung der CB
- Institutionen in den USA
- Regulierungen am Beispiel der MLB
- Institutionen in der deutschen Fußball-Bundesliga
- Institutionen in den USA
- Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die empirische Relevanz der Competitive-Balance-Hypothese in der Sportökonomie. Das Hauptziel ist es, die Bedeutung der Unsicherheit des Spielausganges (UOH) für die Zuschauernachfrage zu analysieren. Dabei werden verschiedene Methoden zur Messung der Competitive Balance (CB) und zur Erklärung der Zuschauernachfrage betrachtet. Die Ergebnisse werden anschließend interpretiert und mit den Institutionen zur Sicherstellung der CB in den USA und der deutschen Fußball-Bundesliga verglichen.
- Die Grundzüge der Sportökonomie und deren theoretische Modellierung
- Methoden zur Messung der Competitive Balance und der Unsicherheit des Spielausganges
- Die Auswirkungen der Competitive Balance auf die Zuschauernachfrage im Stadion und im Fernsehen
- Institutionen zur Sicherstellung der Competitive Balance in verschiedenen Sportligen
- Die empirische Relevanz der Competitive-Balance-Hypothese für die Sportökonomie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 bietet einen Überblick über die grundlegenden Werke der Sportökonomie, die die Grundlage für das Forschungsfeld legen. Es beleuchtet die Wertschöpfung von Sportteams, die Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Sportindustrie und die Unterschiede zwischen den Nachwuchssystemen in Europa und den USA.
Kapitel 3 stellt ein theoretisches Modell einer Sportliga vor, das die Formalisierung der Competitive-Balance-Hypothese ermöglicht. Es analysiert die Kernaussagen des Modells und zieht daraus Schlussfolgerungen für die Bedeutung der CB.
Kapitel 4 betrachtet verschiedene Methoden zur Messung der UOH und der CB. Es erläutert die Regressionsanalyse und zeigt, wie die CB anhand von Stadionbesuchern, Fernsehzuschauern und der Competitive Balance Ratio (CBR) gemessen werden kann. Die Kapitel beleuchten außerdem die Einflussfaktoren auf die Zuschauernachfrage.
Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der verschiedenen Ansätze zur Messung der CB und deren Bedeutung für die Zuschauernachfrage im Stadion und im Fernsehen sowie anhand der CBR. Die Ergebnisse werden interpretiert und im Kontext der verschiedenen Institutionen zur Sicherstellung der CB in den USA und der deutschen Fußball-Bundesliga diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Competitive-Balance-Hypothese (CB), die Unsicherheit des Spielausganges (UOH), die Zuschauernachfrage, die Methoden zur Messung der CB (Regressionsanalyse, Stadionbesucher, Fernsehzuschauer, CBR) und Institutionen zur Sicherstellung der CB in den USA und der deutschen Fußball-Bundesliga.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Competitive-Balance-Hypothese?
Sie besagt, dass ein ausgeglichener Wettbewerb (Unsicherheit über den Spielausgang) das Zuschauerinteresse und damit die Nachfrage steigert.
Wie wird Competitive Balance gemessen?
Gängige Methoden sind die Regressionsanalyse der Zuschauerzahlen, die Analyse der Gewinnverteilung und die Competitive Balance Ratio (CBR).
Warum ist die Unsicherheit des Spielausganges (UOH) wichtig?
Für Fans ist ein Spiel weniger attraktiv, wenn der Sieger von vornherein feststeht. UOH sorgt für Spannung und höhere Zahlungsbereitschaft.
Wie unterscheiden sich Sportligen in den USA und Europa?
US-Ligen nutzen oft Regulierungen wie Salary Caps oder Draft-Systeme zur Sicherung der Balance, während europäische Ligen (wie die Bundesliga) meist offenere Systeme haben.
Beeinflusst Competitive Balance auch die Fernsehzuschauer?
Ja, Studien zeigen, dass die TV-Nachfrage ebenfalls mit der Spannung und der sportlichen Ausgeglichenheit einer Liga korreliert.
- Quote paper
- Patrick Sachs (Author), 2018, Die empirische Relevanz der Competitive-Balance-Hypothese in der Sportökonomie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446848