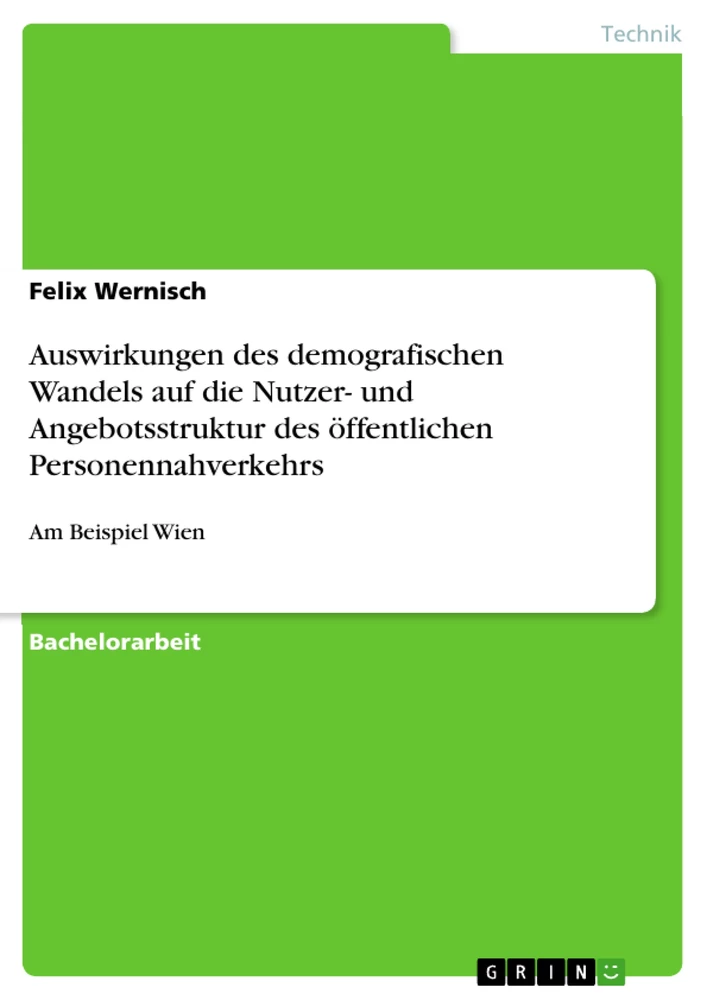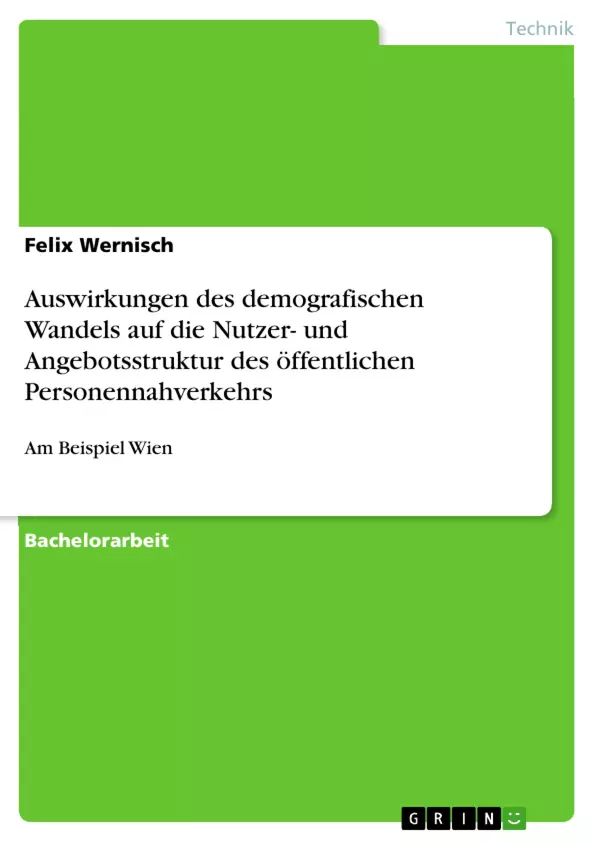Der europaweit evidente demografische Wandel zeichnet sich in Wien anhand einer überproportional wachsenden alten Bevölkerung (über 75-Jährige), einer in Europa vergleichsweise rapiden Bevölkerungsentwicklung aller Altersklassen und einer „Umpolung“ der Altersverteilung von den Wiener Innenbezirken in die Stadtperipherie ab. Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen dieser demografischen Vorgänge auf die Struktur der Nutzer im öffentlichen Personennahverkehr und zeigt auf, welche Ansprüche künftige Nutzergruppen an das öffentliche Verkehrsnetz Wiens haben werden. Um die Eingangsthese zu bestätigen, werden ÖV-Nutzer erst anhand ihres überwiegenden Mobilitätsmotivs kategorisiert. Nachdem eruiert werden konnte, welche Nutzergruppen den größten Einfluss auf die Verkehrsnachfrage im öffentlichen Personennahverkehr haben, werden demografische Trends in einen räumlichen Kontext gebracht, um sich weiters mit der Frage auseinanderzusetzen, vor welchen Herausforderungen der öffentliche Personennahverkehr der Stadt steht. Schließlich werden Handlungserfordernisse zur Anpassung des Angebots im öffentlichen Personennahverkehr anhand von räumlichen, zeitlichen und betrieblichen Aspekten vorgelegt.
Das Ziel der Arbeit ist es, basierend auf den Bestrebungen der Stadt Wien zur Verbesserung des Modal-Splits, einen Situationsüberblick zu schaffen und mögliche Wege in Richtung einer zukunftsfähigen Gestaltung der Angebotsstruktur im öffentlichen Personennahverkehr zu weisen.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Abstract
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung, These und Forschungsfrage
- 1.2 Aufbau und Methodik
- 1.3 Ziele, Umfang und Abgrenzung
- 2. Alltagsmobilität im urbanen Raum mit Blick nach Wien
- 2.1 Begriffserklärung „Mobilität“
- 2.2 Definition und Bedeutung des ÖPNV
- 2.3 Geschichte und Trends des Mobilitätsverhaltens in Wien
- 3. Die Nutzerstruktur des öffentlichen Personennahverkehrs in Wien
- 3.1 Einflüsse der Bevölkerungsstruktur auf die Verkehrsnachfrage im ÖPNV
- 3.2 Einflüsse auf die Verkehrsmittelwahl im Alltag
- 3.2.1 Objektive Einflüsse
- 3.2.2 Subjektive Einflüsse
- 3.3 Nutzergruppen des ÖPNV
- 3.3.1 Wahlfreie Nutzergruppen
- 3.3.2 ÖV-gebundene Nutzergruppen
- 4. Bevölkerungsstrukturen und der demografische Wandel in Wien
- 4.1 Begriffserklärung „Demografie“ und „demografischer Wandel“
- 4.2 Europaspezifische demografische Trends
- 4.3 Die Bevölkerungsstruktur und der demografische Wandel in Wien
- 4.3.1 Bevölkerungsentwicklung
- 4.3.2 Altersentwicklung, Fertilität und Lebenserwartung
- 4.3.3 Migration
- 5. Auswirkungen der neuen Nutzerstruktur auf die öffentliche Verkehrsnachfrage in Wien
- 5.1 Neue Rahmenbedingungen für den ÖPNV in Wien
- 5.2 Verkehrsnachfrage und Nachfrageverschiebungen
- 5.2.1 Herausforderungen des demografischen Wandels für den ÖPNV
- 5.2.2 Barrierefreiheit und Sicherheit
- 6. Beispielhafte Handlungserfordernisse in der Angebotsstruktur des öffentlichen Personennahverkehrs in Wien
- 6.1 Flexible Bedienung durch den Richtungsbandbetrieb
- 6.2 Einsatz neuer Fahrzeuge und Serviceleistungen
- 6.3 Information barrierefrei gestalten und Sicherheit vermitteln
- 6.4 Barrierefreie Erschließung und Verkehrssicherheit gewährleisten
- 7. Schlussfolgerung und Chancen für die Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Nutzerstruktur des öffentlichen Personennahverkehrs in Wien. Sie untersucht die Herausforderungen, die der demografische Wandel für den ÖPNV darstellt, und analysiert die Bedürfnisse zukünftiger Nutzergruppen. Ziel ist es, einen Situationsüberblick zu schaffen und mögliche Wege in Richtung einer zukunftsfähigen Gestaltung der Angebotsstruktur im öffentlichen Personennahverkehr aufzuzeigen.
- Der demografische Wandel in Wien und seine Auswirkungen auf den ÖPNV
- Die Nutzerstruktur des ÖPNV in Wien und die Bedürfnisse zukünftiger Nutzergruppen
- Herausforderungen für den ÖPNV im Kontext des demografischen Wandels
- Mögliche Handlungserfordernisse zur Anpassung der Angebotsstruktur des ÖPNV
- Zukunftsfähige Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs in Wien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Problemstellung, die These und die Forschungsfrage definiert werden. Anschließend wird der Aufbau und die Methodik der Arbeit erläutert sowie die Ziele, der Umfang und die Abgrenzung des Themas dargelegt. In Kapitel 2 wird das Thema Alltagsmobilität im urbanen Raum mit Blick auf Wien betrachtet. Es werden die Begriffserklärung „Mobilität“, die Definition und Bedeutung des ÖPNV sowie die Geschichte und Trends des Mobilitätsverhaltens in Wien beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich der Nutzerstruktur des öffentlichen Personennahverkehrs in Wien. Es werden die Einflüsse der Bevölkerungsstruktur auf die Verkehrsnachfrage im ÖPNV, die Einflüsse auf die Verkehrsmittelwahl im Alltag sowie die Nutzergruppen des ÖPNV analysiert. Kapitel 4 behandelt die Bevölkerungsstrukturen und den demografischen Wandel in Wien. Die Begriffserklärung „Demografie“ und „demografischer Wandel“ wird dargelegt, sowie die europäischen demografischen Trends und die spezifische Entwicklung in Wien betrachtet.
Kapitel 5 beleuchtet die Auswirkungen der neuen Nutzerstruktur auf die öffentliche Verkehrsnachfrage in Wien. Es werden die neuen Rahmenbedingungen für den ÖPNV in Wien, die Verkehrsnachfrage und Nachfrageverschiebungen sowie die Herausforderungen des demografischen Wandels für den ÖPNV analysiert. In Kapitel 6 werden beispielhafte Handlungserfordernisse in der Angebotsstruktur des öffentlichen Personennahverkehrs in Wien vorgestellt.
Schlüsselwörter
Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV, demografischer Wandel, Bevölkerungsstruktur, Nutzerstruktur, Verkehrsnachfrage, Angebotsstruktur, Wien, Mobilität, Modal-Split, Barrierefreiheit, Sicherheit, Richtungsbandbetrieb, Fahrzeugkonzepte, Informationssysteme, Zukunftsgestaltung
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert der demografische Wandel den ÖPNV in Wien?
Die Zunahme der über 75-Jährigen und die Verschiebung der Altersverteilung an die Stadtperipherie erfordern Anpassungen bei der Barrierefreiheit und der Linienführung.
Was sind "wahlfreie Nutzergruppen" im ÖPNV?
Dies sind Personen, die über ein eigenes Auto verfügen, sich aber aufgrund von Komfort, Kosten oder Umweltbewusstsein aktiv für den öffentlichen Verkehr entscheiden.
Was ist ein Richtungsbandbetrieb?
Ein flexibles Bedienkonzept im ÖPNV, das sich besser an schwankende Nachfragen in weniger dichten Gebieten anpassen kann als starre Linienfahrpläne.
Warum ist Barrierefreiheit für die Zukunft des ÖPNV zentral?
Da der Anteil älterer Menschen mit Mobilitätseinschränkungen steigt, ist Barrierefreiheit nicht mehr nur ein Zusatzangebot, sondern eine Grundvoraussetzung für die Sicherung der Fahrgastzahlen.
Welche Rolle spielt die Migration für die Wiener Bevölkerungsstruktur?
Migration trägt zur rapiden Bevölkerungsentwicklung Wiens bei und beeinflusst die Nutzerstruktur, da verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse haben.
Was versteht man unter dem Modal-Split?
Der Modal-Split beschreibt die Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel (z.B. ÖPNV, Auto, Fahrrad). Ziel Wiens ist es, den Anteil des ÖPNV stetig zu erhöhen.
- Quote paper
- B.Sc. Felix Wernisch (Author), 2018, Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Nutzer- und Angebotsstruktur des öffentlichen Personennahverkehrs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446862