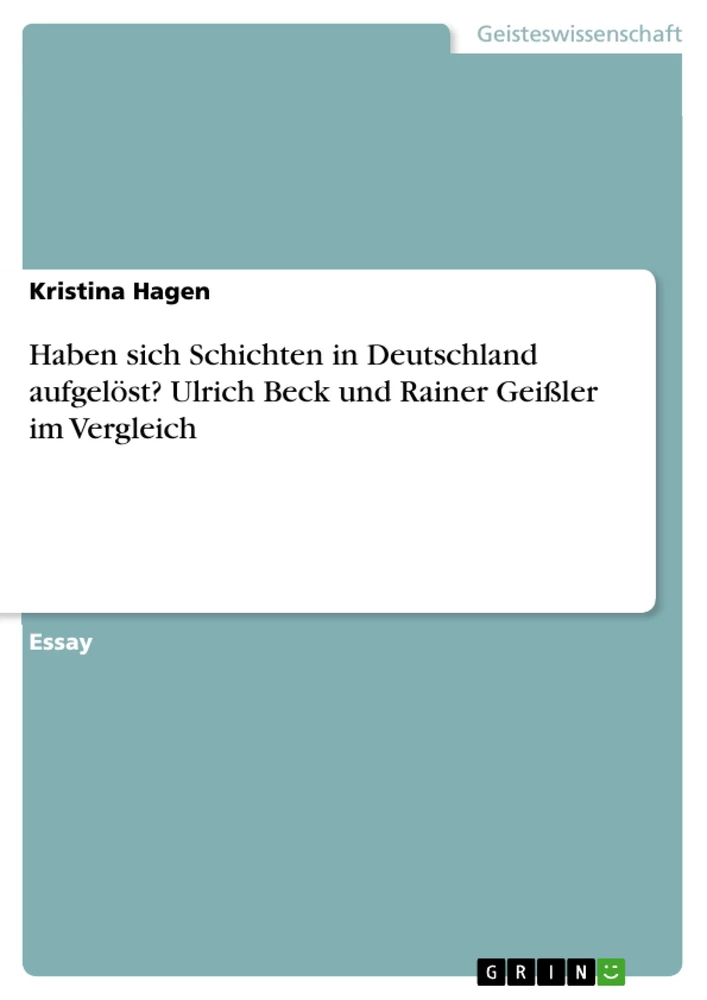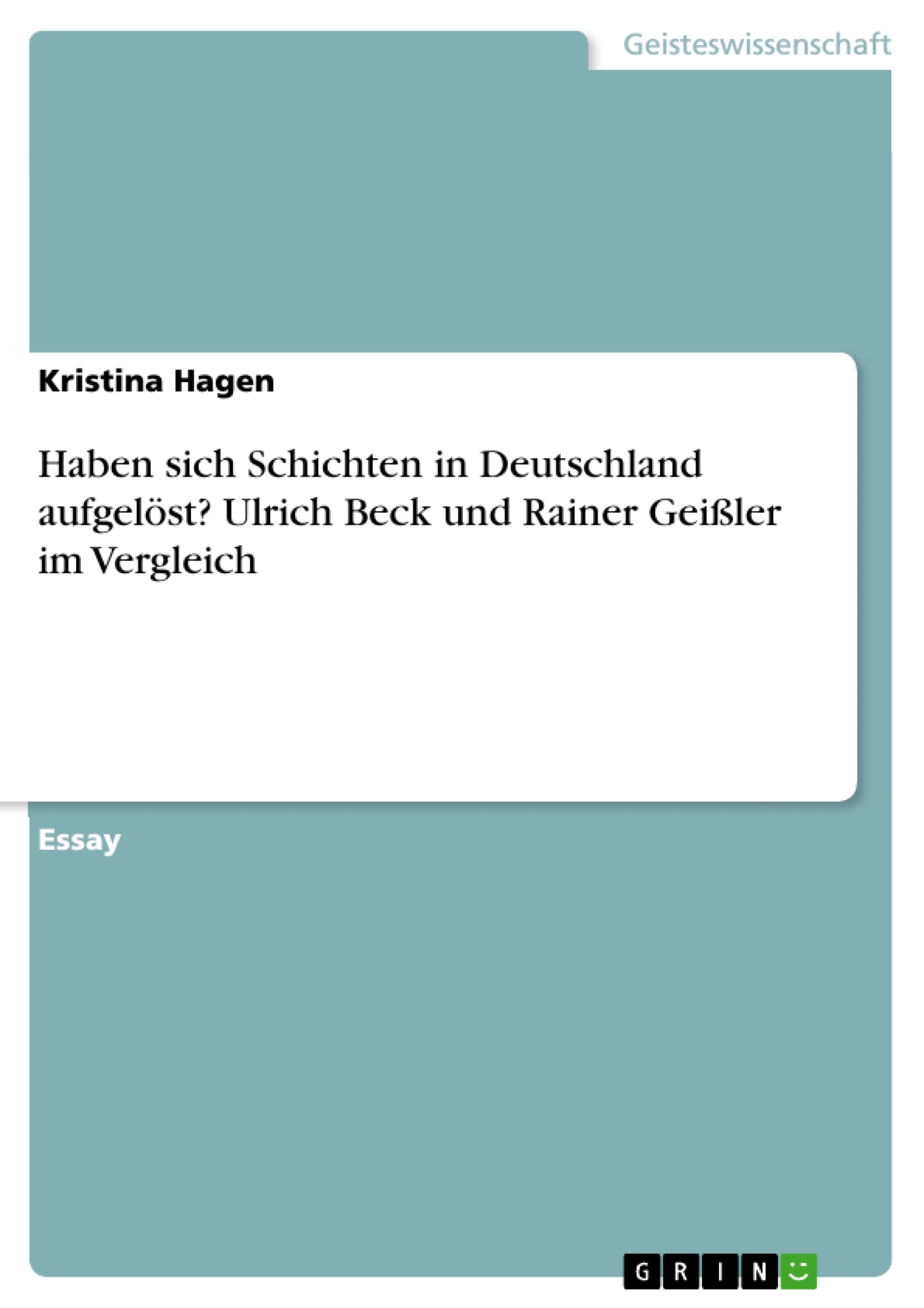Seit dem 19. Jahrhundert beschäftigen sich Soziologen mit der deutschen Gesellschaftsstruktur und der gesellschaftlichen Differenzierung. Der wohl bekannteste von ihnen ist Karl Marx, der die Gesellschaft in zwei Klassen aufteilte – die Bourgeoisie und das Proletariat. Mit der Zeit sammelten sich viele Theorien und Denkansätze zur deutschen Sozialstruktur. Der deutsche Soziologe Ulrich Beck stellte die These auf, dass sich im Zuge der Individualisierung Klassen- und Schichtstrukturen auflösen bzw. sich bereits aufgelöst haben. Diese These sorgte für viel Aufsehen sowie Diskussionsmöglichkeiten. Es bildete sich ein Gegenpol von Soziologen. Einer von ihnen war Rainer Geißler, der die Auflösungsthese ablehnte. In dieser Arbeit soll die Frage beantwortet werden, ob sich Schichten in Deutschland aufgelöst haben oder ob sie weiterhin bestehen.
Im Folgendem soll sich lediglich auf den Begriff der Schicht bezogen werden. Nach Geiger ist die Klasse eine historische Sonderausprägung der Schicht. Daher wird der Einheitlichkeit halber nur der Begriff der Schicht verwendet. Außerdem bezieht Beck bei seiner Annahme über die Auflösung von sozialen Großgruppen keine genaue Begrifflichkeit mit ein.
Nach einer kurzen Vorstellung beider Positionen wird durch die Suche nach Plausibilität für beide Positionen sich für die zutreffendere Position entschieden und somit die Frage, ob sich Schichten in Deutschland aufgelöst haben oder nicht, beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Becks These zur Auflösung von Schichten
- Geißlers Gegenposition
- Empirische Daten und Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob sich soziale Schichten in Deutschland aufgelöst haben, indem sie die gegensätzlichen Thesen von Ulrich Beck und Rainer Geißler vergleicht. Die Arbeit analysiert die Argumente beider Soziologen und bewertet deren Plausibilität anhand empirischer Daten.
- Auflösung von Schichtstrukturen im Zuge der Individualisierung
- Der Einfluss von Bildungsexpansion und Wohlfahrtsstaat auf soziale Ungleichheit
- Analyse der "Fahrstuhl-Effekt"-These
- Bewertung der Bedeutung von Beruf und Bildung als Schichtindikatoren
- Kritische Auseinandersetzung mit empirischen Daten zur sozialen Mobilität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der sozialen Schichtung in Deutschland ein und stellt die Forschungsfrage nach der Auflösung von Schichten in den Mittelpunkt. Sie präsentiert die gegensätzlichen Positionen von Ulrich Beck und Rainer Geißler, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden. Der Fokus liegt auf dem Begriff der "Schicht" im Gegensatz zu "Klasse" und die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz.
Becks These zur Auflösung von Schichten: Dieses Kapitel präsentiert Becks These zur Auflösung von Schichtstrukturen aufgrund von Individualisierung und Niveauverschiebungen. Beck argumentiert, dass durch wirtschaftlichen Aufschwung und Bildungsexpansion alle Schichten profitierten, was zu einem "Fahrstuhl-Effekt" führte und traditionelle Schichtidentitäten abschmolzen. Obwohl soziale Ungleichheiten bestehen bleiben, postuliert Beck eine schichtlose Gesellschaft mit neuen Formen individueller Existenz. Der Fokus liegt auf den positiven Auswirkungen des Wohlfahrtsstaates und der damit verbundenen Verbesserung der Lebensbedingungen aller Schichten.
Geißlers Gegenposition: Dieses Kapitel stellt Geißlers Gegenposition zu Becks These dar. Geißler räumt ein, dass Individualisierung und Pluralisierung stattgefunden haben, bestreitet aber die Auflösung von Schichtstrukturen. Er argumentiert, dass schichttypische Unterschiede in Lebenschancen, insbesondere im Hinblick auf Beruf und Bildung, bestehen bleiben und der "Fahrstuhl-Effekt" ungleichmäßig wirkte. Geißler verweist auf fortbestehende Ungleichheiten in Bezug auf politische Teilhabe und Kriminalität, um seine These zu untermauern.
Empirische Daten und Analyse: Dieser Abschnitt analysiert empirische Daten zur Bildungsexpansion und sozialen Mobilität, um die Thesen von Beck und Geißler zu überprüfen. Die Analyse konzentriert sich auf die Entwicklung der Studienanfängerzahlen aus verschiedenen Herkunftsgruppen und die Selbstrekrutierungsraten in Berufen. Die Daten werden kritisch bewertet und zeigen, dass sich Bildungschancen zwar verbessert haben, aber schichttypische Ungleichheiten bestehen bleiben. Der Abschnitt diskutiert auch die Grenzen der Individualisierungsthese und die Schwierigkeit, diese empirisch zu belegen. Beispiele für die anhaltende Bedeutung von Schichtzugehörigkeit für Bildungs- und Lebenschancen werden aufgezeigt, inklusive der unterschiedlichen Nutzung neuer Technologien.
Schlüsselwörter
Soziale Schichtung, Individualisierung, Bildungsexpansion, Wohlfahrtsstaat, Ulrich Beck, Rainer Geißler, soziale Ungleichheit, Lebenschancen, Schichtstrukturen, Fahrstuhl-Effekt, soziale Mobilität, empirische Daten.
FAQ: Analyse der These zur Auflösung sozialer Schichten in Deutschland
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die gegensätzlichen Thesen von Ulrich Beck und Rainer Geißler zur Auflösung sozialer Schichten in Deutschland. Sie analysiert ihre Argumente und bewertet deren Plausibilität anhand empirischer Daten.
Welche Thesen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die These von Ulrich Beck, der eine Auflösung von Schichtstrukturen aufgrund von Individualisierung und Niveauverschiebungen postuliert, mit der Gegenposition von Rainer Geißler, der die Fortbestehen von Schichtstrukturen betont.
Was ist Becks These zur Auflösung von Schichten?
Beck argumentiert, dass wirtschaftlicher Aufschwung und Bildungsexpansion zu einem „Fahrstuhl-Effekt“ führten, wodurch traditionelle Schichtidentitäten abschmolzen. Obwohl Ungleichheiten bestehen bleiben, sieht er eine schichtlose Gesellschaft mit neuen Formen individueller Existenz.
Was ist Geißlers Gegenposition zu Becks These?
Geißler räumt Individualisierung und Pluralisierung ein, bestreitet aber die Auflösung von Schichtstrukturen. Er argumentiert, dass schichttypische Unterschiede in Lebenschancen bestehen bleiben und der „Fahrstuhl-Effekt“ ungleichmäßig wirkte. Er verweist auf Ungleichheiten in politischer Teilhabe und Kriminalität.
Welche empirischen Daten werden analysiert?
Die Arbeit analysiert empirische Daten zur Bildungsexpansion und sozialen Mobilität, wie die Entwicklung der Studienanfängerzahlen aus verschiedenen Herkunftsgruppen und die Selbstrekrutierungsraten in Berufen. Die Daten werden kritisch bewertet.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Analyse zeigt, dass sich Bildungschancen zwar verbessert haben, aber schichttypische Ungleichheiten bestehen bleiben. Die Arbeit diskutiert die Grenzen der Individualisierungsthese und die Schwierigkeit, diese empirisch zu belegen. Beispiele für die anhaltende Bedeutung von Schichtzugehörigkeit werden aufgezeigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Soziale Schichtung, Individualisierung, Bildungsexpansion, Wohlfahrtsstaat, Ulrich Beck, Rainer Geißler, soziale Ungleichheit, Lebenschancen, Schichtstrukturen, Fahrstuhl-Effekt, soziale Mobilität, empirische Daten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Becks These, ein Kapitel zu Geißlers Gegenposition und einen Abschnitt zur Analyse empirischer Daten.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Untersuchung der Frage, ob sich soziale Schichten in Deutschland aufgelöst haben, durch den Vergleich der gegensätzlichen Thesen von Beck und Geißler und die Bewertung anhand empirischer Daten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist für alle relevant, die sich mit sozialer Schichtung, Ungleichheit und den Auswirkungen von Individualisierung und Bildungsexpansion auf die deutsche Gesellschaft auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Kristina Hagen (Autor:in), 2018, Haben sich Schichten in Deutschland aufgelöst? Ulrich Beck und Rainer Geißler im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446918