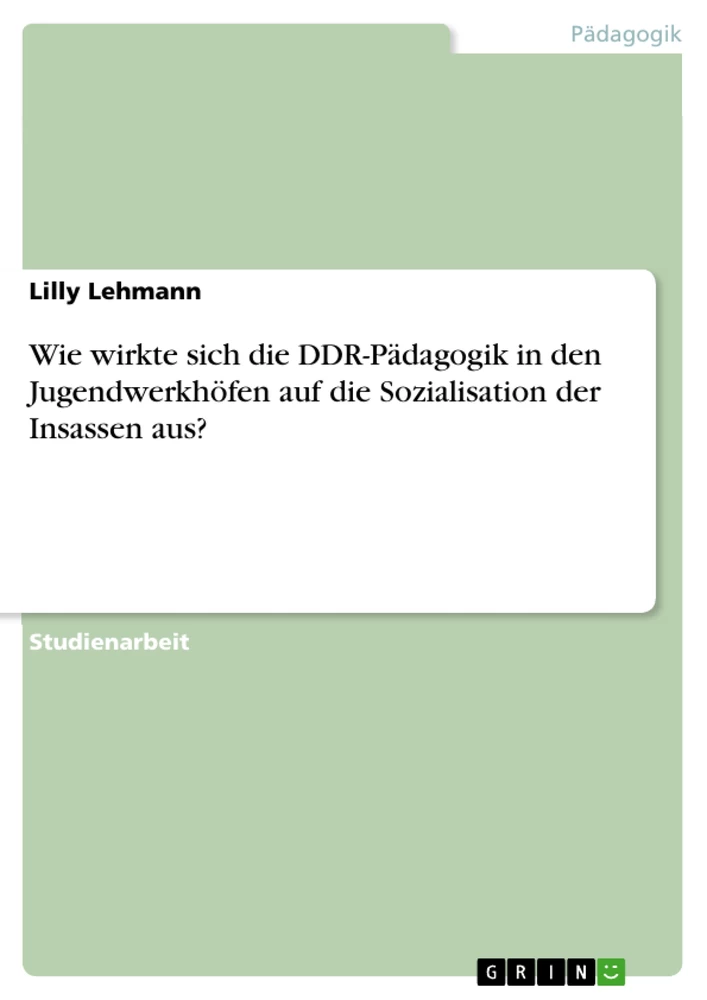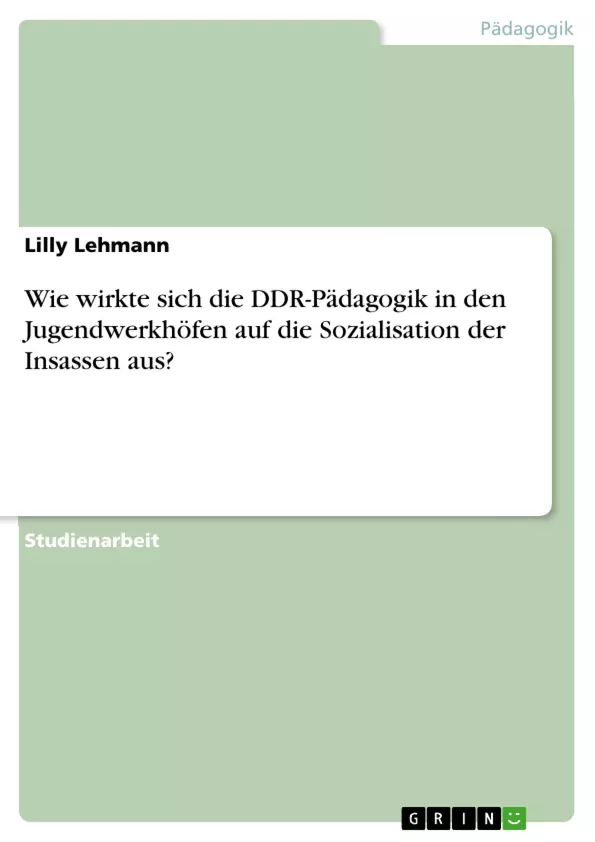Diese wissenschaftliche Hausarbeit beschäftigt sich mit Grundlagen, Intentionen und Wirkungen jener Pädagogik, die in den Jugendwerkhöfen zur Zeiten der DDR vermittelt und durchgeführt wurde, ebenso wie mit dem Einfluss, den diese Pädagogik auf den Sozialisationsprozess der ehemaligen Insassen ausübte.
Diese Ausarbeitung soll dem Leser sowohl einen Einblick in geschichtliche Aspekte der DDR-Pädagogik geben, als auch einen gezielteren Einblick in Erziehungsmethoden und Erziehungskonzepte, die in den Jugendwerkhöfen der DDR vertreten wurden. Zusätzlich soll der Leser einen Zusammenhang zwischen den verübten Erziehungsmaßnahmen und den Nachwirkungen auf den Sozialisationsprozess der ehemaligen Insassen erkennen und verstehen.
Außerdem soll mit dieser Arbeit ein Beitrag zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit geleistet werden, da dieser Bereich der Pädagogik weitab von der öffentlichen Wahrnehmung stand und ein Zeichen des Unrechtes ist, dass vielen Menschen in der DDR widerfahren ist. Um diese Ziele zu erreichen, wird zunächst ein Überblick über die Begriffe „Jugendwerkhof“ und „Sozialisation“ gegeben, die den Rahmen dieser wissenschaftlichen Hausarbeit ausmachen.
Danach folgt der geschichtliche Verlauf der Jugendwerkhöfe, die Beschreibung des Aufenthaltes in einem solchen Jugendwerkhof, wie auch das Aufzeigen der verübten Erziehungsmethoden.
Letztlich wird gezeigt, wie sich die gelebte DDR-Pädagogik auf die Sozialisation der ehemaligen Insassen auswirkte und inwiefern heute eine Aufarbeitung der Geschehnisse, auch unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage, geschieht. Es ist kritisch zu betrachten und zu hinterfragen, welche Mittel und Methoden die DDR-Pädagogen bei der Umerziehung von Jugendlichen zu sozialistischen Persönlichkeiten anwandten und wie diese zu den proklamierten Bildungs- und Erziehungszielen der DDR passten. Das damalige Verständnis für Begriffe wie Kollektiv, Ordnung und Pflicht muss dabei ebenso hinterfragt werden. Wichtig für das Verstehen ist allerdings nicht nur die Einsicht in die sozialistische Ideologie der DDR, sondern auch die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der Betroffenen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Jugendwerkhof
- Definition Sozialisation
- Das Teufelswerk der Jugendwerkhöfe
- Geschichte der Jugendwerkhöfe
- Aufenthalt und Erziehungsmethoden in den Jugendwerkhöfen
- Nachwirkungen der Erziehungsmethoden auf die Sozialisation
- Aufarbeitung und aktuelle Gesetzeslage
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Pädagogik in den Jugendwerkhöfen der DDR und deren Einfluss auf die Sozialisation der ehemaligen Insassen. Dabei geht es um die historischen Aspekte der DDR-Pädagogik, die angewandten Erziehungsmethoden und die langfristigen Auswirkungen auf die Betroffenen. Die Arbeit will zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit beitragen und die kritische Betrachtung der Mittel und Methoden der Umerziehung in den Jugendwerkhöfen fördern.
- Geschichtliche Entwicklung der Jugendwerkhöfe in der DDR
- Analyse der Erziehungsmethoden und -konzepte in den Jugendwerkhöfen
- Bedeutung der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung der ehemaligen Insassen
- Nachwirkungen der DDR-Pädagogik auf die Sozialisation der Betroffenen
- Aktuelle Aufarbeitung und gesetzliche Rahmenbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Thematik der Hausarbeit und deren Zielsetzung vor. Sie erläutert die Bedeutung der DDR-Pädagogik in den Jugendwerkhöfen und den Fokus auf die Auswirkungen auf die Sozialisation der ehemaligen Insassen.
- Das zweite Kapitel definiert den Begriff "Jugendwerkhof" und erläutert die Rolle dieser Einrichtungen in der DDR-Jugendhilfe. Es wird auf die Zielsetzung der Umerziehung zur sozialistischen Persönlichkeit und die spezifischen Bedingungen der Jugendwerkhöfe eingegangen.
- Das dritte Kapitel behandelt die Definition von "Sozialisation" und erklärt die Bedeutung dieses Prozesses für die Entwicklung des Individuums in einer Gesellschaft.
- Das vierte Kapitel, "Das Teufelswerk der Jugendwerkhöfe", beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der Jugendwerkhöfe, beschreibt den Aufenthalt und die Erziehungsmethoden innerhalb dieser Einrichtungen, analysiert die Nachwirkungen der Erziehungsmethoden auf die Sozialisation der ehemaligen Insassen und beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der Vergangenheit und der aktuellen Gesetzeslage.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen DDR-Pädagogik, Jugendwerkhöfe, Sozialisation, Umerziehung, sozialistische Persönlichkeit, Erziehungsmethoden, Nachwirkungen, Aufarbeitung, aktuelle Gesetzeslage.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Zweck der Jugendwerkhöfe in der DDR?
Die Einrichtungen dienten der Umerziehung von Jugendlichen, die als „schwererziehbar“ galten, zu „sozialistischen Persönlichkeiten“.
Welche Erziehungsmethoden wurden dort angewandt?
Die Methoden waren oft repressiv und basierten auf strengem Kollektivismus, Ordnung, Pflicht und teils harten Disziplinierungsmaßnahmen.
Wie beeinflusste die DDR-Pädagogik die Sozialisation der Insassen?
Die erzwungene Anpassung und der psychische Druck führten bei vielen Betroffenen zu langfristigen Störungen in der Identitätsentwicklung und sozialen Integration.
Was versteht man unter „sozialistischer Umerziehung“?
Es beschreibt das Ziel, individuelle Bedürfnisse der staatlichen Ideologie und dem Kollektiv unterzuordnen.
Wie sieht die heutige Aufarbeitung dieser Geschehnisse aus?
Die Arbeit beleuchtet die aktuelle Gesetzeslage zur Rehabilitierung der Opfer und die Bemühungen, das erlittene Unrecht öffentlich anzuerkennen.
- Citation du texte
- BA Lilly Lehmann (Auteur), 2017, Wie wirkte sich die DDR-Pädagogik in den Jugendwerkhöfen auf die Sozialisation der Insassen aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446968