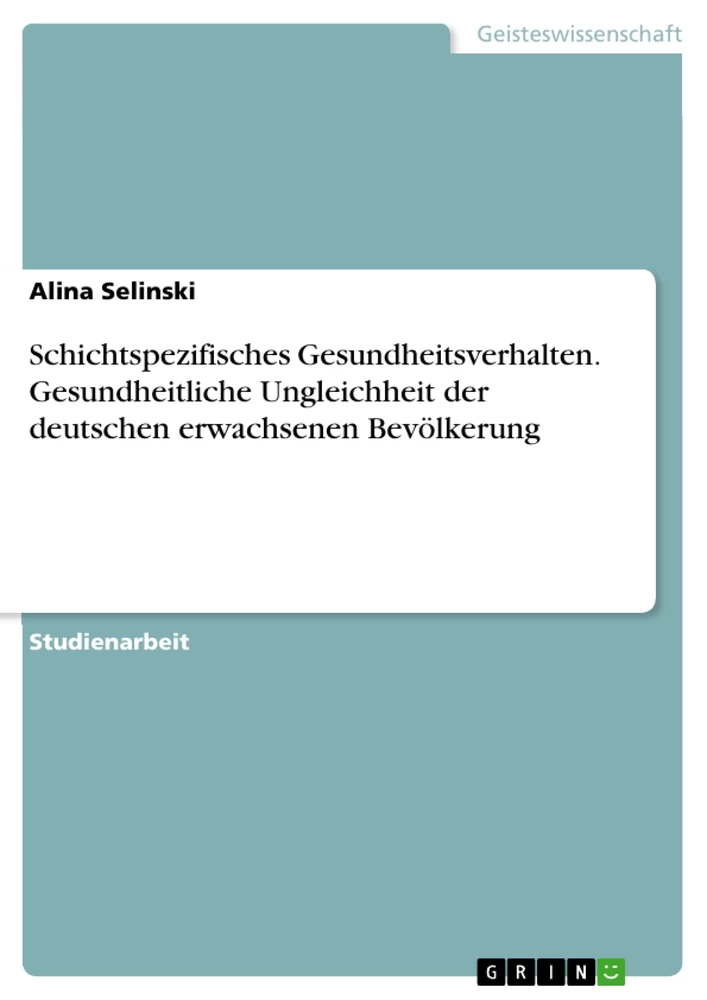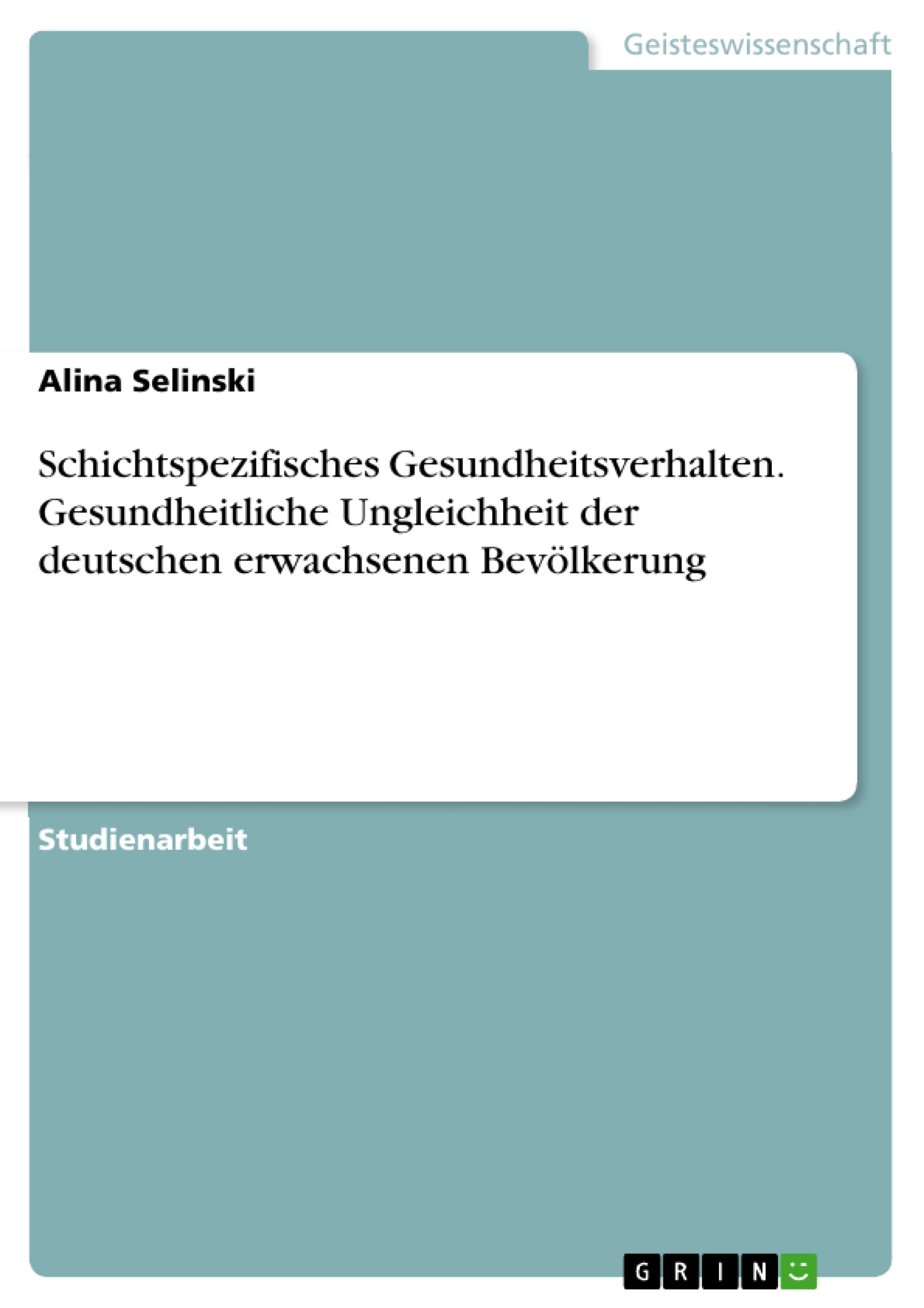Grundlage dieser Arbeit ist die Leitfrage "Gibt es signifikante Differenzen zwischen Personen mit einem niedrigen und einem hohen Sozialstatus bezüglich des Gesundheitsverhaltens?"
Die Konfrontation mit der Thematik der sozialen Ungleichheit lässt sich heutzutage nicht mehr vermeiden. Von den Medien wie dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und auch von Freunden, Bekannten und Kollegen wird dieses Thema angesprochen. Bestimmte Lebensweisen und Gesundheitsverhalten der sozialschwächeren (in Sendungen wie „Mitten im Leben“) und sozialstärkeren Bevölkerungsgruppen (in Sendungen wie „Die Geissens“ oder Zeitschriften und Magazinen wie „Gala“) werden den Menschen aufgedrängt.
Nicht verwunderlich, dass viele Vorurteile wie „die ärmeren Bevölkerungsschichten ernähren sich schlechter, rauchen häufiger und achten allgemein eher weniger auf ihre Gesundheit“ in den Köpfen der Gesellschaft entstehen. Gesundheitsschädliche Verhaltensweisen wie Bewegungsmangel, Fehlernährung, Alkoholmissbrauch, fehlende Compliance in Krankenhäusern und Nichtbefolgen von Sicherheitsregeln werden den Personen der sozialschwächeren Gruppe nachgesagt.
Gleichzeitig hat das Thema Gesundheit heutzutage einen derart hohen Stellenwert wie noch nie. „Wir leben [heutzutage] in einer gesundheitsbesessenen Welt.“ Es existiert eine kaum mehr überschaubare Vielzahl von Informationen bezüglich der Thematik Gesundheit und allem, was damit zu tun hat. Das beweisen unter anderem unzählige Zeitschriften und Magazine oder Online Ratgeber, die regelmäßig neue gesundheitsrelevante Themen zur Verfügung stellen. Der soziale Status eines Individuums hat neben weiteren Einflussfaktoren vermeintlich ausschlaggebende Einflüsse auf das persönliche Gesundheitsverhalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Leitfrage
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Hypothese
- 1.4 Zielsetzung
- 1.5 Methodisches Vorgehen
- 2. Begriffserklärungen
- 2.1 Soziale Schicht
- 2.3 Gesundheitsverhalten
- 3. Schichtspezifisches Gesundheitsverhalten
- 3.1 GEDA - Studie: Gesundheit in Deutschland aktuell (2012)
- 3.2 DEGS1 - Studie
- 4. Diskussion
- 5. Schlussformulierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozialem Status und Gesundheitsverhalten. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob signifikante Unterschiede zwischen Personen mit niedrigem und hohem Sozialstatus im Hinblick auf ihr Gesundheitsverhalten bestehen.
- Definition und Abgrenzung von sozialer Schicht und Gesundheitsverhalten
- Analyse der Auswirkungen von sozialer Ungleichheit auf das Gesundheitsverhalten
- Präsentation empirischer Studien, die schichtspezifische Unterschiede im Gesundheitsverhalten beleuchten
- Diskussion der Ursachen und Folgen von gesundheitlicher Ungleichheit
- Entwicklung möglicher Lösungsansätze zur Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Leitfrage, die Problemstellung, die Hypothese, die Zielsetzung und das methodische Vorgehen. Im Anschluss werden die Begriffe „Soziale Schicht“ und „Gesundheitsverhalten“ definiert. Das dritte Kapitel beleuchtet schichtspezifische Unterschiede im Gesundheitsverhalten anhand von empirischen Studien wie der GEDA- und der DEGS1-Studie.
Schlüsselwörter
Soziale Schicht, Gesundheitsverhalten, gesundheitliche Ungleichheit, GEDA-Studie, DEGS1-Studie, empirische Forschung, soziale Determinanten von Gesundheit, Gesundheitsförderung, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es einen Zusammenhang zwischen sozialem Status und Gesundheit?
Ja, Studien zeigen signifikante Differenzen im Gesundheitsverhalten. Personen mit niedrigerem Sozialstatus rauchen statistisch häufiger, bewegen sich weniger und achten oft weniger auf gesunde Ernährung.
Was ist die GEDA-Studie?
GEDA steht für „Gesundheit in Deutschland aktuell“. Es ist eine regelmäßige Studie, die Daten zum Gesundheitszustand und -verhalten der erwachsenen Bevölkerung liefert.
Wie wird „Gesundheitsverhalten“ definiert?
Es umfasst alle Verhaltensweisen eines Individuums, die seine Gesundheit fördern oder schädigen können, wie Ernährung, Sport, Alkoholkonsum und die Einhaltung ärztlicher Ratschläge (Compliance).
Was sind soziale Determinanten von Gesundheit?
Das sind Faktoren wie Bildung, Einkommen und beruflicher Status (soziale Schicht), die maßgeblich beeinflussen, welche Gesundheitschancen ein Mensch hat.
Warum ist gesundheitliche Ungleichheit ein gesellschaftliches Problem?
Weil sie zu einer ungleichen Lebenserwartung führt und das Gesundheitssystem vor die Herausforderung stellt, Prävention gezielt in sozial schwächeren Schichten zu verankern.
- Quote paper
- Alina Selinski (Author), 2018, Schichtspezifisches Gesundheitsverhalten. Gesundheitliche Ungleichheit der deutschen erwachsenen Bevölkerung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446978