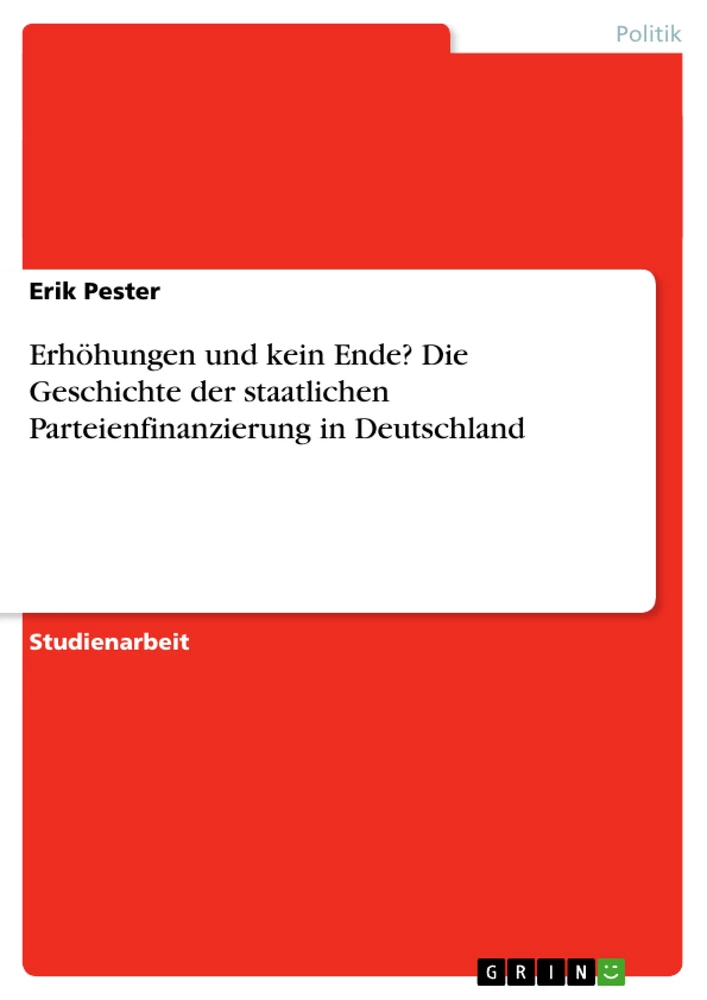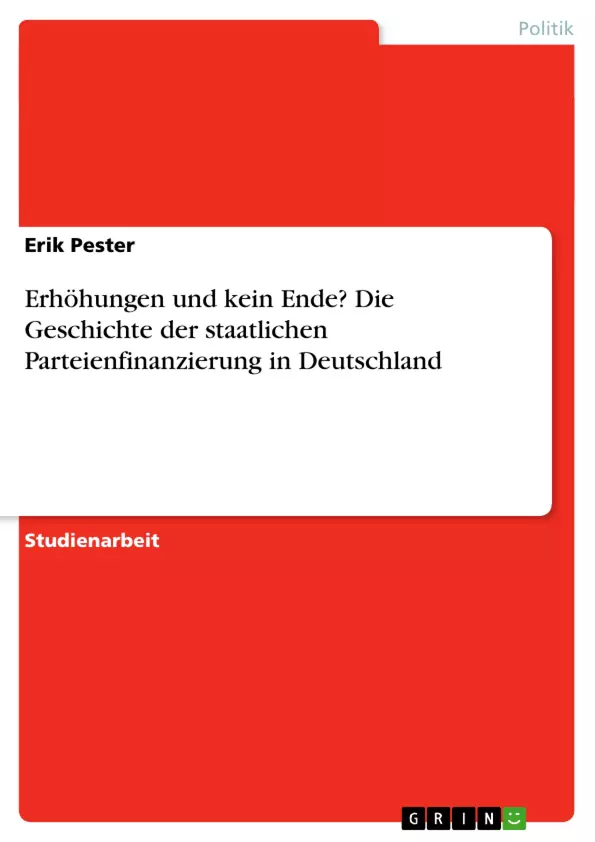Die Parteienlandschaft in Deutschland steht vor ernsthaften Problemen. Insbesondere die etablierten Parteien sehen sich mit einer Situation konfrontiert, die im Begriff ist krisenhafte Züge anzunehmen. Dabei beunruhigen nicht etwa die gegenwärtigen Befunde, sondern die jeweiligen Tendenzen, die diese aufweisen. Sämtliche Statistiken, die als Indikatoren für die gesellschaftliche Verankerung von oder die Zufriedenheit mit Parteien dienlich sein könnten, zeigen ganz deutlich: Die etablierten Parteien haben ein Imageproblem. Egal ob Wahlbeteiligung, Konzentrationsgrad, allgemeines Wählerverhalten, Vertrauen in die Arbeit politischer Parteien, Entwicklung der Mitgliederzahlen oder politisches Interesse insbesondere in der jüngeren Bevölkerung – all diese Daten weisen in eine Richtung, die den sonst so ungelenken Begriff der Politik- oder Parteienverdrossenheit immer mehr zu bestätigen scheinen (v. Alemann 2003: 187-192, Sontheimer/Bleek 2002: 259 -265)
Die Gründe für diese „Entkoppelung von Parteienstaat und Gesellschaft“ (Wiesendahl 2004: 24) sind derart vielschichtiger Natur, dass es nicht möglich ist sie hier im Einzelnen zu erörtern. Naheliegend ist stattdessen jedoch Strukturen des deutschen Parteiensystems zu überdenken und - falls notwendig - aufzubrechen, um dieser drohenden Krise aktiv zu begegnen. Gerade in einer Zeit, in der die politische Öffentlichkeit maßgeblich durch Symbolik geprägt wird, wäre es sinnvoll Schritte zu unternehmen, die dem Begriff der Reform im Sinne einer wirklichen Neuordnung gerecht werden. Insbesondere, wenn sich dies auf die politische Führung selbst bezieht. Eine umfassende Neugestaltung der Parteienfinanzierung könnte dies leisten, ohne die Grundsätze des demokratischen Rechtsstaats in Frage stellen. Selbstverständlich nur dann, wenn diese Neugestaltung angesichts allgemeiner Sparzwänge der öffentlichen und privaten Haushalte mit einer generellen Reduzierung der staatlichen Zuschüsse verbunden wäre. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass die Geschichte der staatlichen Parteienfinanzierung in der Bundesrepublik nach einer derartigen Reformierung nahezu schreit. Betrachtet man sich die einzelnen Schritte, die zur öffentlichen Finanzierung der Parteien in ihrer jetzigen Form geführt haben, drängt sich die Frage auf, ob es nicht opportun wäre, ein grundlegend neues Parteiengesetz zu schaffen ohne wie bisher die öffentliche Finanzierung der politischen Parteien auszuweiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung öffentlicher Parteienfinanzierung in Deutschland
- Grundlegendes
- Zeit der Gesetzlosigkeit 1949 – 1967
- Ausweitung der staatlichen Finanzierung 1967 - 1989
- Umgestaltung des Parteiengesetzes
- Kritikpunkte
- Reduzierung der öffentlichen Mittel?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der öffentlichen Parteienfinanzierung in Deutschland und untersucht, ob eine Reformierung des Parteiengesetzes notwendig ist, um der vermeintlichen Krise der etablierten Parteien entgegenzuwirken. Die Analyse fokussiert auf die Geschichte der staatlichen Parteienfinanzierung und deren Auswirkungen auf das politische System.
- Entwicklung der öffentlichen Parteienfinanzierung in Deutschland
- Kritikpunkte an der aktuellen Finanzierung
- Mögliche Reformoptionen des Parteiengesetzes
- Bedeutung der öffentlichen Finanzierung für die politische Stabilität
- Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in der Gestaltung der Parteienfinanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung thematisiert die aktuelle Krise der etablierten Parteien in Deutschland und führt die Problematik der Parteienverdrossenheit ein. Sie argumentiert, dass eine Reform der Parteienfinanzierung notwendig ist, um dieser Krise entgegenzuwirken.
1. Die Entwicklung öffentlicher Parteienfinanzierung in Deutschland
Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der staatlichen Parteienfinanzierung in Deutschland und beschreibt die verschiedenen Formen der offenen und verdeckten Finanzierung. Es wird auf die ständige Erhöhung der an die Parteien fließenden Mittel und die sich verändernden Berechnungsmodi hingewiesen. Außerdem wird die Rolle des Bundesverfassungsgerichts bei der Gestaltung der Parteienfinanzierung beleuchtet.
1.1 Grundlegendes
Dieser Abschnitt erklärt die verschiedenen Formen der staatlichen Parteienfinanzierung, wie Wahlkampfkostenerstattung, Zuwendungsanteil, Zuschüsse an Fraktionen und steuerliche Begünstigung privater Spenden.
1.2 Zeit der Gesetzlosigkeit 1949 - 1967
Dieser Abschnitt beschreibt die frühen Formen der staatlichen Leistungen an die Parteien in der Bundesrepublik, die durch einen hohen Mangel an Transparenz geprägt waren. Es werden die Entwicklung der Kreditvergabe an Parteien, die Steuerbegünstigung von Spenden und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in dieser Phase beleuchtet.
1.3 Ausweitung der staatlichen Finanzierung 1967-1989
In diesem Abschnitt wird die Ausweitung der staatlichen Finanzierung der Parteien in den Jahren 1967 bis 1989 dargestellt. Es werden die verschiedenen Formen der Finanzierung und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts bei der Gestaltung der Finanzierung erläutert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind: öffentliche Parteienfinanzierung, Parteiengesetz, Parteienverdrossenheit, politische Stabilität, Bundesverfassungsgericht, Wahlkampfkostenerstattung, Spenden, Steuerbegünstigung, Transparenz, Demokratie, Reform.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Parteienverdrossenheit?
Es beschreibt das sinkende Vertrauen der Bevölkerung in politische Parteien, was sich in sinkenden Mitgliederzahlen und geringerer Wahlbeteiligung äußert.
Wie hat sich die staatliche Parteienfinanzierung entwickelt?
Von einer „Zeit der Gesetzlosigkeit“ (1949-1967) entwickelte sie sich über ständige Ausweitungen bis hin zum heutigen komplexen System der Wahlkampfkostenerstattung.
Welche Rolle spielt das Bundesverfassungsgericht?
Das Bundesverfassungsgericht hat durch zahlreiche Urteile die Grenzen und Formen der Parteienfinanzierung in Deutschland maßgeblich mitgestaltet.
Was sind die Kritikpunkte an der aktuellen Finanzierung?
Kritisiert werden mangelnde Transparenz, die ständige Erhöhung der Mittel und die Entkoppelung der Parteien von der Gesellschaft.
Wäre eine Reduzierung der staatlichen Mittel sinnvoll?
Die Arbeit diskutiert, ob eine Reduzierung der Zuschüsse im Rahmen einer Reform die Parteien dazu zwingen könnte, sich wieder stärker an der Basis zu orientieren.
- Arbeit zitieren
- Erik Pester (Autor:in), 2005, Erhöhungen und kein Ende? Die Geschichte der staatlichen Parteienfinanzierung in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44764