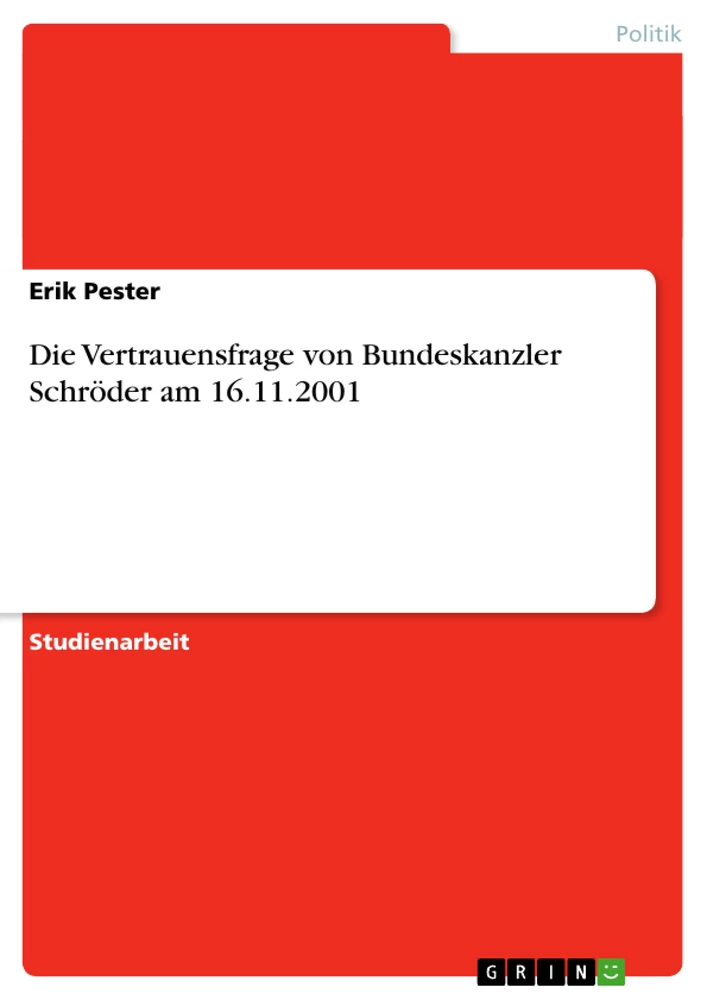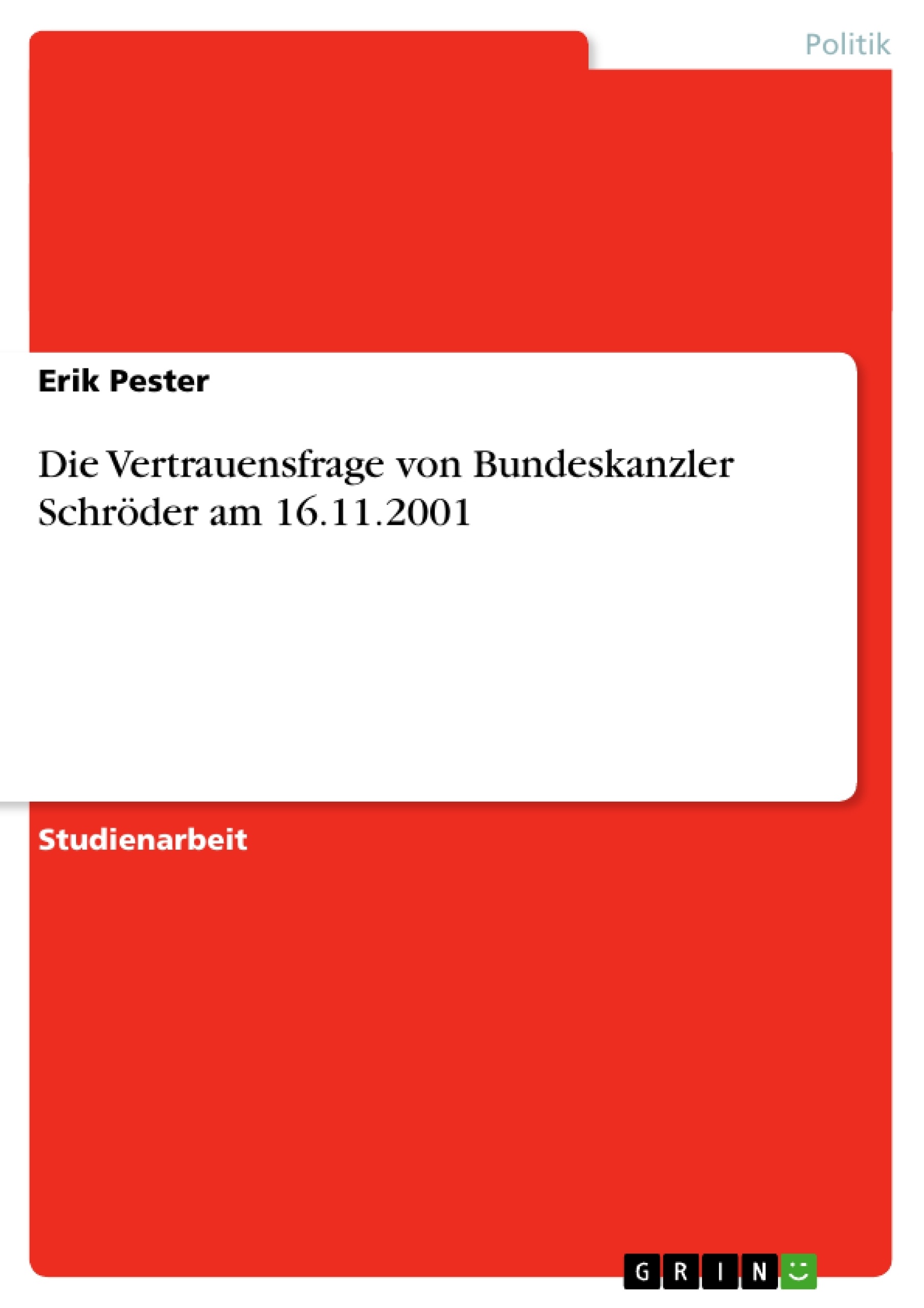Einleitung
Am 16. November 2001 stellte Bundeskanzler Gerhard Schröder dem Parlament die Vertrauensfrage. Er hatte diese mit dem Antrag zum Bundeswehreinsatz im Antiterrorkampf verknüpft. Die zuvor an die amerikanische Regierung abgegebene Zusicherung der „uneingeschränkten Solidarität“ nach den Anschlägen vom 11. September 2001 nötigte den Kanzler dazu, breite Zustimmung im Parlament insbesondere in den Regierungsfraktionen zu erwirken. Da diese sich im Vorfeld der Abstimmung als ungewiss erwies, entschloss sich Schröder dazu, die Abgeordneten zu disziplinieren, indem er die Entscheidung über den Antiterroreinsatz mit der Vertrauensfrage verband. Diese in der bundesdeutschen Geschichte bisher einmalige Anwendung eines solchen Mittels erwies sich in Schröders Sinne als erfolgreich. Wie ist sie aber zu bewerten? Am Montag, den 19.11. titelte „Der Spiegel“: Schröder hätte einen „mit Brachialgewalt erzwungenen Abstimmungssieg“ errungen. Doch stellt diese Form der Disziplinierung wirklichen „Zwang“ dar? Dieser Frage soll im Folgenden nachgegangen werden. Dabei will ich versuchen mich der Thematik von drei Seiten zu nähern. Zum einen soll versucht werden, Klarheit in die Begrifflichkeiten des Zwanges und insbesondere des Fraktionszwanges zu bringen. Dabei soll versucht werden diesen so häufig verwendeten Begriff zu entzaubern. Anschließend werden die rechtlichen Voraussetzungen für Schröders Vorstoß, sowie dessen Rechtmäßigkeit erläutert. Weiterhin werden die Ereignisse um den 16.11.2001 chronologisch dargestellt. Abschließend wird geprüft, ob es sich bei der Verknüpfung einer Sachentscheidung mit der Vertrauensfrage um Fraktionszwang gehandelt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines zum Fraktionszwang
- Verfassungsrechtliche Voraussetzungen zu Schröders Vorstoß
- Die Vertrauensfrage im Grundgesetz
- Rechtmäßigkeit der Verbindung mit einer Sachentscheidung
- Chronologie der Ereignisse um den 16.11.2001
- Der 16.11. als Beispiel für indirekt ausgeübten Fraktionszwang?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ereignisse um die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Gerhard Schröder am 16. November 2001, insbesondere im Hinblick auf die Frage des Fraktionszwangs. Ziel ist es, den viel diskutierten Begriff des Fraktionszwangs zu klären und dessen Anwendung im konkreten Fall zu analysieren.
- Begriffsbestimmung und Entmythologisierung des Fraktionszwangs
- Verfassungsrechtliche Grundlagen der Vertrauensfrage
- Chronologische Darstellung der Ereignisse vom 16. November 2001
- Analyse der Verbindung von Vertrauensfrage und Sachentscheidung
- Bewertung der Handlungsweise Schröders im Kontext des Fraktionszwangs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die umstrittene Verbindung der Vertrauensfrage durch Bundeskanzler Schröder mit dem Antrag zum Bundeswehreinsatz im Antiterrorkampf am 16. November 2001. Es wird der Frage nachgegangen, ob diese Handlungsweise als "Fraktionszwang" zu werten ist und analysiert die damit verbundenen verfassungsrechtlichen und politischen Aspekte. Die Arbeit verspricht eine differenzierte Betrachtung des Begriffs "Fraktionszwang" und eine detaillierte Analyse der Ereignisse.
Allgemeines zum Fraktionszwang: Dieses Kapitel befasst sich mit der weit verbreiteten, aber oft missverständlichen Verwendung des Begriffs "Fraktionszwang" in der öffentlichen und politischen Debatte. Es wird argumentiert, dass der Begriff oft zu vereinfachend und irreführend verwendet wird, und ein differenzierteres Verständnis der komplexen Entscheidungsprozesse innerhalb von Fraktionen notwendig ist. Beispiele aus der Medienberichterstattung und Äußerungen von Politikern veranschaulichen die weitverbreitete, aber ungenaue Verwendung des Begriffs. Die Arbeit betont die Bedeutung der präzisen Verwendung von Begriffen und kritisiert die vereinfachende Darstellung der innerparteilichen Entscheidungsfindung.
Verfassungsrechtliche Voraussetzungen zu Schröders Vorstoß: Dieser Abschnitt analysiert die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Vertrauensfrage nach Artikel 68 des Grundgesetzes. Es werden die Möglichkeiten des Bundeskanzlers im Falle einer Ablehnung der Vertrauensfrage erläutert, einschließlich der Antragstellung auf Auflösung des Bundestages oder der Erklärung des Gesetzgebungsnotstands. Die Ausführungen bieten einen soliden verfassungsrechtlichen Rahmen für die Bewertung von Schröders Vorgehen.
Schlüsselwörter
Fraktionszwang, Vertrauensfrage, Bundeskanzler Schröder, Bundeswehr, Antiterrorkampf, Verfassungsrecht, Grundgesetz, Parlamentarische Entscheidungsfindung, Politische Disziplinierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Vertrauensfrage von Bundeskanzler Schröder am 16. November 2001
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Ereignisse um die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Gerhard Schröder am 16. November 2001, insbesondere im Hinblick auf die Frage des Fraktionszwangs. Sie untersucht die Verbindung der Vertrauensfrage mit dem Antrag zum Bundeswehreinsatz im Antiterrorkampf und bewertet die damit verbundenen verfassungsrechtlichen und politischen Aspekte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffsbestimmung und Entmythologisierung des Fraktionszwangs, verfassungsrechtliche Grundlagen der Vertrauensfrage, chronologische Darstellung der Ereignisse vom 16. November 2001, Analyse der Verbindung von Vertrauensfrage und Sachentscheidung, Bewertung der Handlungsweise Schröders im Kontext des Fraktionszwangs, sowie die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen der Vertrauensfrage nach Artikel 68 des Grundgesetzes.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, den viel diskutierten Begriff des Fraktionszwangs zu klären und dessen Anwendung im konkreten Fall des 16. November 2001 zu analysieren. Es soll ein differenzierteres Verständnis der komplexen Entscheidungsprozesse innerhalb von Fraktionen geschaffen und die Handlungsweise Schröders im Kontext des Fraktionszwangs bewertet werden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Allgemeines zum Fraktionszwang, Verfassungsrechtliche Voraussetzungen zu Schröders Vorstoß (inkl. Unterkapiteln zur Vertrauensfrage im Grundgesetz und der Rechtmäßigkeit der Verbindung mit einer Sachentscheidung), Chronologie der Ereignisse um den 16.11.2001, Der 16.11. als Beispiel für indirekt ausgeübten Fraktionszwang? und Fazit.
Wie wird der Begriff "Fraktionszwang" behandelt?
Die Arbeit kritisiert die oft vereinfachende und irreführende Verwendung des Begriffs "Fraktionszwang" in der öffentlichen und politischen Debatte. Sie betont die Notwendigkeit eines differenzierteren Verständnisses der komplexen Entscheidungsprozesse innerhalb von Fraktionen und analysiert die Verwendung des Begriffs anhand von Beispielen aus der Medienberichterstattung und Äußerungen von Politikern.
Welche Rolle spielt das Grundgesetz?
Das Grundgesetz, insbesondere Artikel 68, bildet die verfassungsrechtliche Grundlage für die Analyse der Vertrauensfrage und der Handlungsweise Schröders. Die Arbeit erläutert die Möglichkeiten des Bundeskanzlers im Falle einer Ablehnung der Vertrauensfrage, einschließlich der Antragstellung auf Auflösung des Bundestages oder der Erklärung des Gesetzgebungsnotstands.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fraktionszwang, Vertrauensfrage, Bundeskanzler Schröder, Bundeswehr, Antiterrorkampf, Verfassungsrecht, Grundgesetz, Parlamentarische Entscheidungsfindung, Politische Disziplinierung.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die zentralen Argumente und Erkenntnisse jedes Kapitels kurz und prägnant darstellen. Die Zusammenfassung der Einleitung beispielsweise hebt die Untersuchung der umstrittenen Verbindung der Vertrauensfrage mit dem Antrag zum Bundeswehreinsatz hervor und kündigt eine differenzierte Betrachtung des Begriffs "Fraktionszwang" und eine detaillierte Analyse der Ereignisse an.
- Citation du texte
- Erik Pester (Auteur), 2005, Die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Schröder am 16.11.2001, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44767