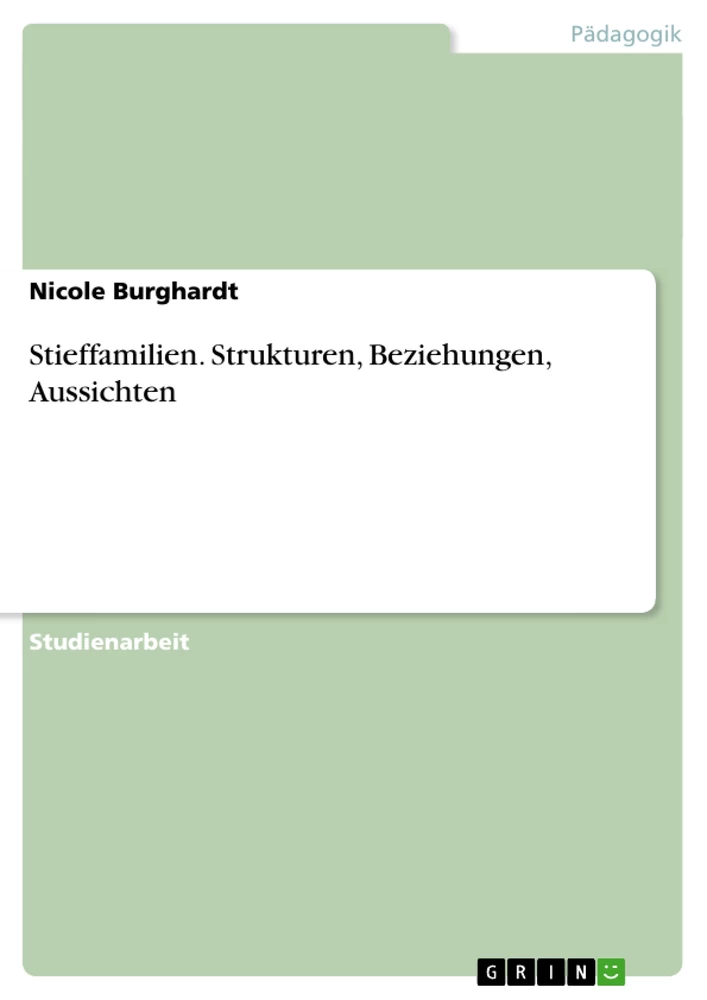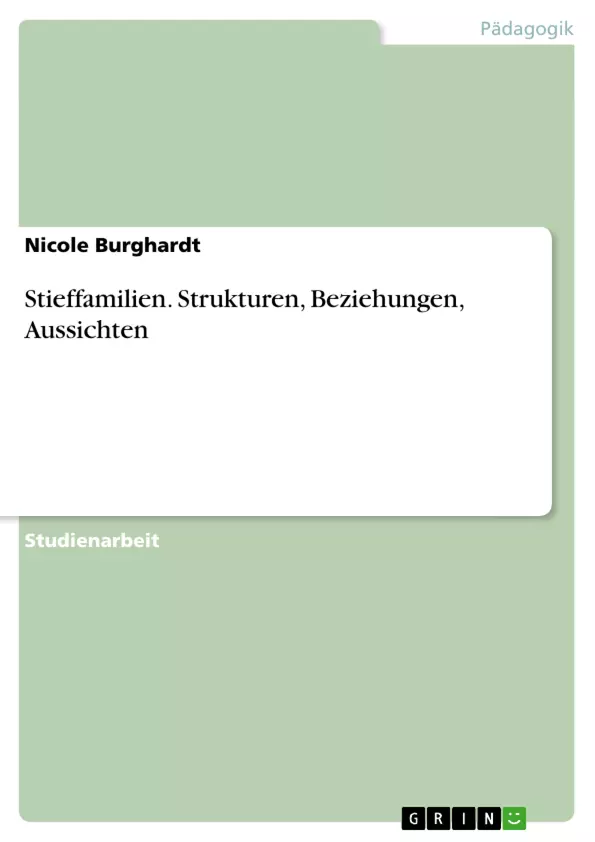Im Jahr 2001 wurden in Deutschland 389 429 Ehen geschlossen und 197 498 geschieden, dabei waren 153 000 minderjährige Kinder betroffen (Pressemitteilung statistisches Bundesamt, 27.08.2002, auf www.stieffamilien.de). Von den minderjährigen Kindern leben aktuell 6% mit einem Stiefelternteil zusammen, wobei Ostdeutsch-land mit etwas mehr als 10% einen doppelt so hohen Anteil an Stiefkindern wie Westdeutschland aufweist. Dabei leben Zwei Drittel der Kinder in ehelichen Stieffamilien, der Rest in Lebensgemeinschaften (www.cgi.dji.de).
In der vorliegenden Arbeit wird es hauptsächlich um die Form der primären Stieffamilie (Erklärung hierzu im zweiten Teil) gehen, da diese die Hauptform in Deutschland darstellt und ich selber in solch einer aufgewachsen bin. Ich werde erläutern was eine Stieffamilie ist, wie sie sich entwickelt, ihre „Vor- und Nachteile “, die einzelnen Mitglieder sowie deren Positionen und Beziehungen zueinander und welche Rolle der außerhalb lebende Elternteil spielt.
2. Was ist eine Stieffamilie?
Um auf das Thema der Stieffamilie einzugehen, muss erst einmal klar sein, was eine Stieffamilie überhaupt ist, was sie ausmacht und was sie kennzeichnet.
„Stief“ ist abgeleitet aus der althochdeutschen Vorsilbe „stiof“ und bedeutet soviel wie „hinterblieben“, „verwaist“ und „beraubt“.
Visher und Visher (1987, S. 27) definieren Stieffamilien als jene Familien „in der mindestens ein Erwachsener ein Stiefelternteil ist“. Ein weiteres Merkmal ist nach Friedl/Meier-Aichen (1991), das ein leiblicher Elternteil des Kindes außerhalb der Stieffamilie lebt und das neben der schon bestehenden Eltern- Kind- Beziehung der Stiefelternteil eine eigenständige Beziehung zu seinem Stiefkind aufbauen muss. Die Stieffamilie ist eine „familiäre Lebensgemeinschaft, die in einer Phase des Wandels für sich eine neue Struktur suchen und neue Formen der Alltagsorganisation entwickeln muss“.
Zentrale Themen der meisten Stieffamilien sind die Übernahme der Stiefelternrolle sowie die Gestaltung der Stiefelternteil- Stiefkind - Beziehung. Stiefelternteile haben Schwierigkeiten, ein stabiles Muster dafür zu entwickeln, wie sie für ihre Stiefkinder fühlen, wie sie über sie denken und wie sie sich ihnen gegenüber verhalten sollen. Häufig sind beide Parteien nicht bereit, eine enge Beziehung zueinander aufzubauen. Gute oder schlechte Rollenerfüllung hängt im Wesentlichen davon ab, ob Stiefkind und Ehepartner diese Rollenübernahme akzeptieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist eine Stieffamilie
- Sekundäre und primäre Stieffamilien
- Die Unterschiede zur Kernfamilie
- Die Entwicklung einer Stieffamilie
- Stieffamilien als Problem
- Stieffamilie als Gewinn
- Die Beziehung zwischen Kindern und ihren Stiefeltern
- Die Stiefmutter
- Der Stiefvater
- Die Position des Stiefvaters in der Familie
- Das Stiefkind
- Der leibliche Elternteil
- Der externale Elternteil
- Der internale Elternteil
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Struktur und Dynamik von Stieffamilien in Deutschland. Sie beleuchtet die Unterschiede zur Kernfamilie, die Herausforderungen und Chancen des Zusammenlebens, sowie die Beziehungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern. Der Fokus liegt dabei auf der primären Stieffamilie.
- Definition und Typologie von Stieffamilien
- Vergleich von Stieffamilien und Kernfamilien
- Beziehungen zwischen Stiefeltern, Stiefkindern und leiblichen Eltern
- Entwicklungsphasen von Stieffamilien
- Herausforderungen und positive Aspekte des Stieffamilienlebens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert die steigende Anzahl von Stieffamilien in Deutschland aufgrund der hohen Scheidungsrate und beleuchtet den Fokus der Arbeit auf die primäre Stieffamilie, basierend auf den persönlichen Erfahrungen der Autorin.
2. Was ist eine Stieffamilie?: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Stieffamilie“ etymologisch und anhand verschiedener wissenschaftlicher Definitionen. Es werden die zentralen Herausforderungen bei der Übernahme der Stiefelternrolle und der Gestaltung der Beziehung zwischen Stiefeltern und Stiefkindern hervorgehoben. Die Bedeutung der Akzeptanz dieser Rollen von beiden Seiten wird betont.
2.1. Sekundäre und primäre Stieffamilien: Dieser Abschnitt differenziert zwischen sekundären und primären Stieffamilien, wobei der Fokus auf der dauerhaften Zusammenlebensform der primären Stieffamilie liegt. Statistische Daten zu den jeweiligen Anteilen in Ost- und Westdeutschland werden präsentiert, um die Verbreitung der verschiedenen Formen zu veranschaulichen.
2.2. Die Unterschiede zur Kernfamilie: Der Vergleich mit der Kernfamilie hebt die Unterschiede in Bezug auf Zusammenhalt, Kommunikation, Konfliktniveau und Geschwisterbeziehungen hervor. Die Gründung einer Stieffamilie wird als der Beginn eines neuen Familienzyklus beschrieben, der mit dem alten synchronisiert werden muss, und es wird ein Zeitraum von etwa fünf Jahren für das Zusammenwachsen der Familie angegeben.
2.3. Die Entwicklung einer Stieffamilie: Die Entwicklungsphasen einer Stieffamilie (Abschied, Teilfamilie, neue Partnerschaft) werden nach Krähenbühl et al. (1986) dargestellt. Die Bedeutung der vorherigen Familiengeschichte, der Trennungs- und Nachscheidungsphase sowie der Einelternschaft für die Entwicklung der neuen Familienkonstellation wird hervorgehoben.
3. Stieffamilien als Problem: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext. Eine Zusammenfassung muss hier eingefügt werden, wenn der Originaltext vorhanden ist.)
4. Stieffamilie als Gewinn: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext. Eine Zusammenfassung muss hier eingefügt werden, wenn der Originaltext vorhanden ist.)
5. Die Beziehung zwischen Kindern und ihren Stiefeltern: Dieses Kapitel analysiert die Beziehungen zwischen Stiefkindern und Stiefeltern, unterteilt nach Stiefmüttern und Stiefvätern. Es wird die besondere Rolle und Position des Stiefvaters innerhalb der Familie detailliert behandelt. Die Herausforderungen beim Aufbau einer positiven Beziehung zwischen Stiefkindern und Stiefeltern werden angesprochen.
6. Der leibliche Elternteil: Dieser Abschnitt betrachtet die Rolle des leiblichen Elternteils, der außerhalb der Stieffamilie lebt, und differenziert zwischen externen und internen Elternteilen. Die Bedeutung der Beziehung zwischen dem nicht im Haushalt lebenden Elternteil und dem Kind für die Dynamik der Stieffamilie wird hervorgehoben. (Die Unterkapitel 6.1 und 6.2 werden hier nicht einzeln zusammengefasst.)
Schlüsselwörter
Stieffamilie, Patchworkfamilie, Stiefeltern, Stiefkinder, Kernfamilie, Familienentwicklung, Beziehungen, Herausforderungen, Chancen, Kommunikation, Konfliktlösung, Elternrolle, Zusammenleben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Struktur und Dynamik von Stieffamilien in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Struktur und Dynamik von Stieffamilien in Deutschland. Sie beleuchtet die Unterschiede zur Kernfamilie, die Herausforderungen und Chancen des Zusammenlebens, sowie die Beziehungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern. Der Fokus liegt auf der primären Stieffamilie. Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Arten von Stieffamilien werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen primären und sekundären Stieffamilien. Primäre Stieffamilien zeichnen sich durch ein dauerhaftes Zusammenleben aus, während sekundäre Stieffamilien weniger stabil sind. Der Fokus liegt auf den primären Stieffamilien. Statistische Daten zur Verbreitung beider Formen in Ost- und Westdeutschland werden (vermutlich) im Kapitel 2.1 präsentiert.
Wie werden Stieffamilien im Vergleich zu Kernfamilien dargestellt?
Die Arbeit vergleicht Stieffamilien mit Kernfamilien hinsichtlich Zusammenhalt, Kommunikation, Konfliktniveau und Geschwisterbeziehungen. Es wird hervorgehoben, dass die Gründung einer Stieffamilie den Beginn eines neuen Familienzyklus darstellt, der mit dem alten synchronisiert werden muss. Es wird ein Zeitraum von etwa fünf Jahren für das Zusammenwachsen der Familie angegeben.
Welche Entwicklungsphasen werden bei Stieffamilien beschrieben?
Die Entwicklungsphasen einer Stieffamilie werden nach Krähenbühl et al. (1986) dargestellt und umfassen Abschied, Teilfamilie und neue Partnerschaft. Die Bedeutung der vorherigen Familiengeschichte, der Trennungs- und Nachscheidungsphase sowie der Einelternschaft für die Entwicklung der neuen Familienkonstellation wird betont.
Wie werden die Beziehungen zwischen Stiefeltern und Stiefkindern behandelt?
Das Kapitel 5 analysiert die Beziehungen zwischen Stiefkindern und Stiefeltern, unterteilt nach Stiefmüttern und Stiefvätern. Die besondere Rolle und Position des Stiefvaters innerhalb der Familie wird detailliert behandelt. Die Herausforderungen beim Aufbau einer positiven Beziehung zwischen Stiefkindern und Stiefeltern werden angesprochen.
Welche Rolle spielt der leibliche Elternteil, der nicht im Haushalt lebt?
Die Arbeit betrachtet die Rolle des leiblichen Elternteils, der außerhalb der Stieffamilie lebt, und differenziert zwischen externen und internen Elternteilen. Die Bedeutung der Beziehung zwischen dem nicht im Haushalt lebenden Elternteil und dem Kind für die Dynamik der Stieffamilie wird hervorgehoben.
Welche Herausforderungen und Chancen werden im Zusammenhang mit Stieffamilien diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet sowohl die Herausforderungen (z.B. im Aufbau von Beziehungen, Kommunikation und Konfliktlösung) als auch die Chancen des Zusammenlebens in einer Stieffamilie. Die Kapitel 3 ("Stieffamilien als Problem") und 4 ("Stieffamilie als Gewinn") gehen detaillierter auf diese Aspekte ein (allerdings fehlen im gegebenen Auszug die jeweiligen Zusammenfassungen).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Stieffamilie, Patchworkfamilie, Stiefeltern, Stiefkinder, Kernfamilie, Familienentwicklung, Beziehungen, Herausforderungen, Chancen, Kommunikation, Konfliktlösung, Elternrolle, Zusammenleben.
- Quote paper
- Nicole Burghardt (Author), 2004, Stieffamilien. Strukturen, Beziehungen, Aussichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44795