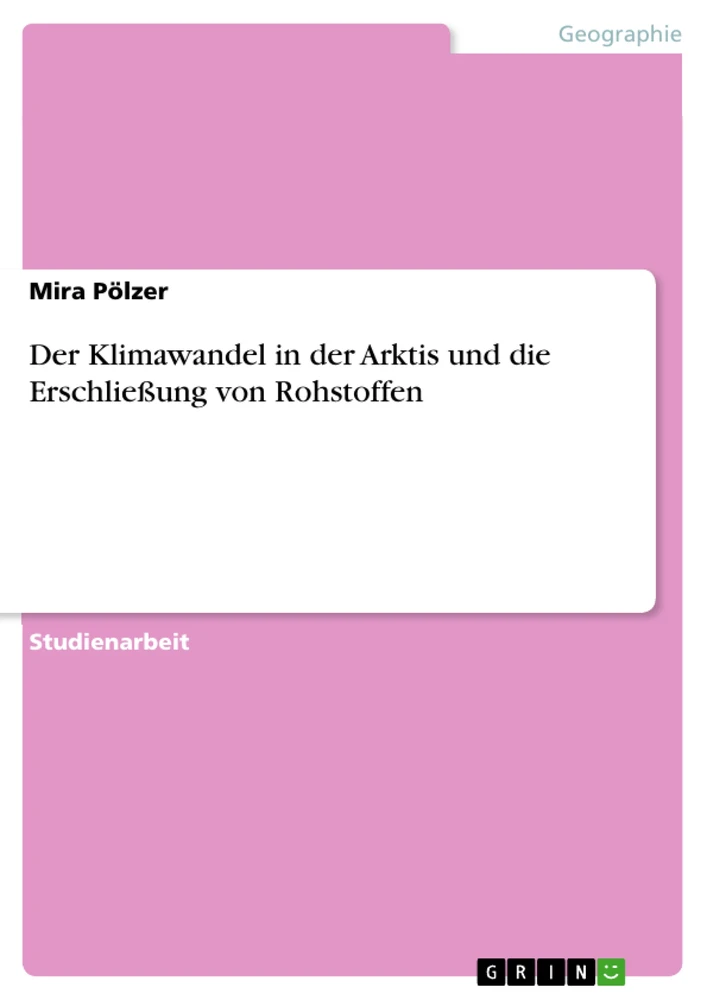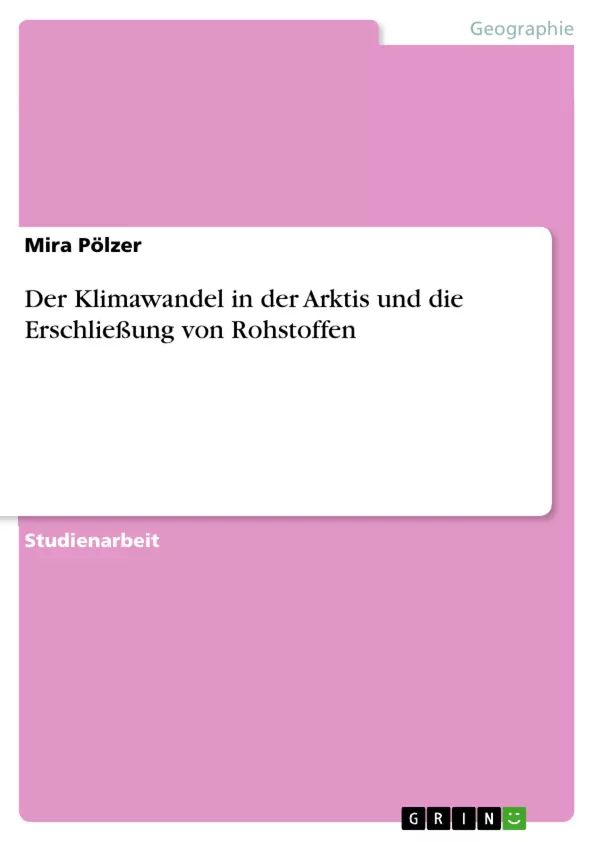Die Arktis ist für die meisten Menschen nur ein fernes und vermeintlich wirtschaftlich uninteressantes Gebiet, doch wie die restliche Welt befindet sich auch die Arktis in einem enormen Wandlungsprozess: Zwar strahlte das ewige Eis der Polkappen unserer Erde schon immer eine enorme Anziehungskraft auf die meisten Abenteurer und Entdecker aus aber auch wirtschaftliches Interesse in Form von Walfang und Pelzhandel gehören - vor allem in Grönland - zur Geschichte der Region.
Doch die Aufmerksamkeit und Faszination der Forscher heute erregt das Nordpolargebiet auf eine ganz andere und viel bedeutendere Weise. Die ersten Expeditionen, welche ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts starteten, waren noch von Erfolg und Ruhm getrieben, so dass ein regelrechter Wettlauf zum nördlichsten Punkt der Erde entstand - viele mussten allerdings dies mit ihrem Leben bezahlen. Der Sieger blieb allerdings bis heute ungeklärt, denn nachdem 1909 der US-Amerikaner Robert Peary behauptete, als erster Mensch den Nordpol erreicht zu haben verkündete, ein weiterer US-Amerikaner, Frederick Albert Cook, sogar schon ein Jahr früher das Unmögliche geschafft zu haben.
Doch ob er diese Herausforderung tatsächlich meisterte ist aufgrund fehlender Dokumente ungewiss. Seit das Polareis allerdings seine Ewigkeit zu verlieren scheint, starten Forschungsreisen, wie zum Beispiel die russische Expedition „Artika 2007“, nur noch mit dem untergeordneten Ziel sich dadurch mit Erfolg rühmen zu können. Stattdessen wollen Forscher nun die verborgenen Schätze des Gebiets finden: Neben Silber, Zink, Diamanten, Gold und weiteren kostbaren Bodenschätzen dieser Art werden von den meisten Wissenschaftlern knapp ein Fünftel der weltweit vorhandenen Öl- und Gasvorkommen unter dem Eis vermutet. Doch diese vielen Ressourcen in mitten des hoch fragilen Ökosystems der Arktis bringen nicht nur heikle politische und umwelttechnische Themen auf, sondern bedürfen auch einer höchst komplexen Logistik. Laut einigen Experten, wie zum Beispiel dem britischen Militärexperten der Zeitschrift „Jane's Intelligence Review“, wäre sogar eine erneute Militarisierung des Nordpolargebiets möglich, so dass dieser Konflikt zu einer Neuauflage des Kalten Kriegs führen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Die Arktis im Wandel der Zeit - Vom Niemandsland zum Pulverfass
- Die Abgrenzung der Arktis
- Klimawandel: Rückgang des Eises und die dadurch entstehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten
- Ressourcen werden zu Reserven
- Gebietsansprüche
- Seerechtsübereinkommen
- Arktischer Rat
- Multilaterale Konventionen
- Mögliche Militarisierung in der Arktis
- Beteiligte Staaten
- Mögliche Neuauflage des kalten Krieges
- Gebietsansprüche
- Der Einfluss des Ressourcenabbaus auf die indigenen Völker (Sacchalin-2-Projekt)
- Umweltschutz in der Arktis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Klimawandel in der Arktis und dessen Auswirkungen auf die Erschließung von Rohstoffen. Sie beleuchtet die historischen und aktuellen Entwicklungen in der Arktis, die geopolitischen Interessen der Anrainerstaaten und die Herausforderungen des Umweltschutzes in diesem sensiblen Ökosystem.
- Historische Entwicklung der Arktisforschung und -erschließung
- Geopolitische Interessen und Gebietsansprüche in der Arktis
- Der Einfluss des Klimawandels auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen
- Die Auswirkungen des Ressourcenabbaus auf die Umwelt und indigene Bevölkerungsgruppen
- Möglichkeiten und Herausforderungen des Umweltschutzes in der Arktis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arktis im Wandel der Zeit - Vom Niemandsland zum Pulverfass: Die Arktis, einst ein vermeintlich uninteressantes Gebiet, erlebt einen enormen Wandel. Während frühere Expeditionen von Ruhm und Abenteuerlust getrieben waren, rücken heute die vermuteten enormen Öl- und Gasvorkommen sowie andere Rohstoffe in den Mittelpunkt. Dieser Wandel birgt nicht nur wirtschaftliche Chancen, sondern auch politische und ökologische Risiken, bis hin zur möglichen Militarisierung der Region und einer Neuauflage des Kalten Krieges, wie von einigen Experten befürchtet.
Die Abgrenzung der Arktis: Die Definition der Arktis ist nicht eindeutig. Früher wurde der Polarkreis als Grenze verwendet, heute orientiert man sich an der nördlichen Baumgrenze oder der 10°-Juli-Isotherme. Die verschiedenen Ansätze führen zu einer ähnlichen Flächengröße von etwa 20 Millionen Quadratkilometern, die Anrainerstaaten Russland, USA, Kanada, Norwegen, Island und Grönland beanspruchen Anteile dieser Region aufgrund des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen. Die Diskussion über die Abgrenzung unterstreicht die komplexen geopolitischen Herausforderungen in der Arktis.
Klimawandel: Rückgang des Eises und die dadurch entstehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten: Der Rückgang des arktischen Eises eröffnet neue wirtschaftliche Möglichkeiten, vor allem im Bereich des Rohstoffabbaus. Der leichter zugängliche Zugang zu den Ressourcen führt zu verstärktem Interesse der Anrainerstaaten, birgt aber auch erhebliche Risiken für das fragile Ökosystem der Arktis und die indigene Bevölkerung. Die Kapitel diskutiert die wirtschaftlichen Chancen und Herausforderungen des Klimawandels in der Arktis.
Ressourcen werden zu Reserven: Dieses Kapitel befasst sich mit den Gebietsansprüchen der Anrainerstaaten auf die Ressourcen der Arktis, dem Seerechtsübereinkommen, dem Arktischen Rat und multilateralen Konventionen. Die zunehmende Bedeutung der arktischen Ressourcen und die damit verbundenen geopolitischen Spannungen werden ausführlich dargestellt, einschließlich der potenziellen Militarisierung und dem Risiko eines neuen Kalten Krieges. Die verschiedenen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für die Erschließung der Ressourcen werden analysiert.
Der Einfluss des Ressourcenabbaus auf die indigenen Völker (Sacchalin-2-Projekt): Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Auswirkungen des Ressourcenabbaus, insbesondere am Beispiel des Sacchalin-2-Projekts, auf die indigene Bevölkerung der Arktis. Es untersucht die Herausforderungen und Konflikte, die sich aus der Erschließung der Ressourcen für die traditionellen Lebensweisen und Kulturen der indigenen Völker ergeben. Die sozialen und kulturellen Folgen der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Arktis werden kritisch betrachtet.
Schlüsselwörter
Arktis, Klimawandel, Rohstoffabbau, Geopolitik, Umweltschutz, indigene Völker, Seerechtsübereinkommen, Arktischer Rat, Militarisierung, Ressourcenkonflikte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Die Arktis im Wandel
Was ist der Inhalt der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Klimawandel in der Arktis und seine Auswirkungen auf die Rohstofferschließung. Sie beleuchtet historische und aktuelle Entwicklungen, geopolitische Interessen der Anrainerstaaten und Herausforderungen des Umweltschutzes in diesem sensiblen Ökosystem. Die Arbeit umfasst die historische Entwicklung der Arktisforschung, geopolitische Interessen und Gebietsansprüche, den Einfluss des Klimawandels auf Rohstoffe, Auswirkungen des Ressourcenabbaus auf Umwelt und indigene Bevölkerung sowie Möglichkeiten und Herausforderungen des Umweltschutzes.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Die historische Entwicklung der Arktis vom Niemandsland zum Gebiet mit geopolitischer Bedeutung; die Abgrenzung der Arktis und die damit verbundenen Definitionsprobleme; den Klimawandel und den Rückgang des Eises als wirtschaftliche Chance und ökologisches Risiko; die Gebietsansprüche der Anrainerstaaten, das Seerechtsübereinkommen, den Arktischen Rat und multilaterale Konventionen; die potenzielle Militarisierung der Arktis und das Risiko eines neuen Kalten Krieges; den Einfluss des Ressourcenabbaus (am Beispiel des Sacchalin-2-Projekts) auf indigene Völker; und schließlich die Möglichkeiten und Herausforderungen des Umweltschutzes in der Arktis.
Welche Kapitel gibt es in der Seminararbeit?
Die Seminararbeit ist in Kapitel unterteilt, die sich mit der historischen Entwicklung der Arktis, ihrer Abgrenzung, dem Klimawandel und seinen wirtschaftlichen Folgen, den Ressourcen und den Gebietsansprüchen, den Auswirkungen des Ressourcenabbaus auf indigene Völker und dem Umweltschutz befassen. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Themas.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, den komplexen Zusammenhang zwischen Klimawandel, Rohstofferschließung, Geopolitik und Umweltschutz in der Arktis zu analysieren. Sie untersucht die Herausforderungen und Konflikte, die sich aus der zunehmenden wirtschaftlichen Nutzung der Arktis ergeben, insbesondere für die indigene Bevölkerung und das sensible Ökosystem.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Arktis, Klimawandel, Rohstoffabbau, Geopolitik, Umweltschutz, indigene Völker, Seerechtsübereinkommen, Arktischer Rat, Militarisierung, Ressourcenkonflikte.
Wie ist die Arktis abgegrenzt?
Die Abgrenzung der Arktis ist nicht eindeutig definiert. Es werden verschiedene Kriterien verwendet, wie der Polarkreis, die nördliche Baumgrenze oder die 10°-Juli-Isotherme. Trotz unterschiedlicher Ansätze ergibt sich eine ähnliche Flächengröße von ca. 20 Millionen Quadratkilometern, auf die Anrainerstaaten wie Russland, USA, Kanada, Norwegen, Island und Grönland Gebietsansprüche erheben.
Welche Rolle spielt das Seerechtsübereinkommen?
Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen spielt eine wichtige Rolle bei der Regelung der Gebietsansprüche in der Arktis. Es bildet die rechtliche Grundlage für die Ansprüche der Anrainerstaaten auf Ressourcen und Seegebiete in der Arktis.
Welche Rolle spielt der Arktische Rat?
Der Arktische Rat ist ein zwischenstaatliches Forum, das die Zusammenarbeit der Anrainerstaaten in der Arktis fördert. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Diskussion und Regelung von Fragen des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung in der Arktis.
Wie werden die Auswirkungen des Ressourcenabbaus auf indigene Völker behandelt?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen des Ressourcenabbaus auf indigene Völker, insbesondere am Beispiel des Sacchalin-2-Projekts. Sie analysiert die sozialen und kulturellen Folgen der wirtschaftlichen Aktivitäten und die Herausforderungen für die traditionellen Lebensweisen und Kulturen der indigenen Bevölkerung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zeigt die komplexen Wechselwirkungen zwischen Klimawandel, Rohstofferschließung, Geopolitik und Umweltschutz in der Arktis auf. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit einer nachhaltigen und umweltverträglichen Entwicklung, die die Rechte und Interessen der indigenen Bevölkerung berücksichtigt.
- Citar trabajo
- Mira Pölzer (Autor), 2017, Der Klimawandel in der Arktis und die Erschließung von Rohstoffen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448173